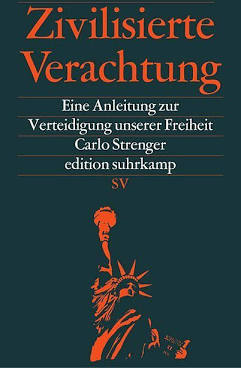
«Zivilisierte Verachtung» entstand 2014, also vor «Abenteuer Freiheit» (siehe Buchbesprechung 2017-2) Schon aus den Untertiteln ergibt sich, dass die beiden Essays ein ähnliches Thema, oder das gleiche Thema aus unterschiedlichen Gesichtspunkten behandeln, dass also einige Redundanz zu erwarten ist. Die ist auch tatsächlich vorhanden. Immerhin weisen beide Bücher eine wohltuende Kürze auf (123 beziehungsweise 104 Seiten, inklusive Fussnoten und Anmerkungen).
In beiden Büchern geht es um die Verteidigung der Freiheit, oder um die schwindende Bereitschaft der Gesellschaften der westlichen Zivilisation, für ihre Freiheit einzustehen, sie zu verstehen, zu begründen und zu verteidigen.
In «Zivilisierte Verachtung» baut Strenger auf der These auf, dass die politische Korrektheit die Hauptursache für die Gefährdung der Freiheit ist. Die Verteidigung der Freiheit, die wir im Wesentlichen der Aufklärung verdanken, setzt die Bereitschaft voraus, Position zu beziehen. Das kollidiert mit der politischen Korrektheit, die genau das Gegenteil will, nämlich keine Position zu beziehen, weil jede Position berechtigt und gleich berechtigt ist. Positionen zu kritisieren – das geht nicht; es ist einerseits überheblich (vor allem, wenn es vom ‚bösen weissen Mann’ kommt), und anderseits für die Kritisierten verletzend und herabsetzend.
Strengers Rezept ist die ‚zivilisierte Verachtung’. Darunter versteht er die Haltung, «aus der heraus Menschen Glaubenssätze, Verhaltensweisen und Wertsetzungen verachten dürfen oder gar sollen, wenn sie diese aus substanziellen Gründen für irrational, unmoralisch, inkohärent oder unmenschlich halten. Zivilisiert ist diese Haltung unter zwei Bedingungen: Sie muss erstens auf Argumenten beruhen, die zeigen, dass derjenige, der sie vorbringt, sich ernsthaft darum bemüht hat, den aktuellen Wissensstand in relevanten Disziplinen zu reflektieren; dies ist das Prinzip der verantwortlichen Meinungsbildung. Zweitens muss sie sich gegen Meinungen, Glaubensinhalte oder Werte richten und nicht gegen die Menschen, die sie vertreten. Deren Würde und grundlegenden Rechte müssen stets gewahrt bleiben und dürfen ihnen unter keinen Umständen abgesprochen werden. Zivilisierte Verachtung ist die Fähigkeit, zu verachten, ohne zu hassen oder zu dehumanisieren. Dies ist das Prinzip der Menschlichkeit. Von der Geisteshaltung der Inquisition oder der iranischen Ayatollahs unterscheidet sich die zivilisierte Verachtung also insofern fundamental, als niemand aufgrund seines Glaubens, seiner Werte oder einer Meinungsäusserung zu Freiheitsentzug, Folter oder gar zum Tod verurteilt werden darf. Der Begriff bezeichnet vielmehr die Fähigkeit, Zivilisationsnormen auch gegenüber jenen aufrechtzuerhalten, deren Glaubens- und Wertesystem man nicht akzeptiert.»
Besonders wichtig ist für Strenger auch die Bereitschaft, Kränkungen, die durch eine Kritik am eigenen Wertesystem verursacht werden, auszuhalten und als ‚Normalfall’ zu akzeptieren; denn ein wesentliches Element der von Strenger postulierten Aufgeklärtheit ist das Bewusstsein, dass niemand den Anspruch erheben darf, die allein seligmachende Wahrheit zu besitzen. Er vertritt aber gleichzeitig dezidiert den Standpunkt und begründet dies auch einleuchtend, dass die westliche Zivilisation (mit den Hauptmerkmalen Freiheit, Primat des Säkularen, Wissenschaftlichkeit, Gleichberechtigung) von keinem anderen gesellschaftlichen Wertesystem übertroffen wird und deshalb vorbehaltlos verdient, verteidigt zu werden – auch wenn dies, entgegen allen Regeln der politischen Korrektheit, Kritik an anderen Zivilisationen oder Wertesystemen impliziert.
Der Essay reflektiert die Entstehung und Geschichte der politischen Korrektheit eingehend und behandelt dann das Konzept der zivilisierten Verachtung aus verschiedenen Gesichtspunkten. Er liest sich leicht und flüssig. Dank zahlreicher Beispiele ist die Lektüre auch sehr anschaulich und lehrreich.
Das Buch ist meines Erachtens eine MUSS-Lektüre für alle, die sich mit unserer Gesellschaftsform, deren inneren und äusseren Anfeindungen sowie deren Erhaltung befassen wollen. Es wäre ein idealer Stoff auch für junge Menschen; ich werde versuchen, meine Enkel zur Lektüre anzuregen (gilt ebenfalls für Strengers «Abenteuer Freiheit»).
Problematisch ist für mich – im Titel und natürlich erst recht in Strengers Konzept –der Begriff ‚Verachtung’. Das ist für mich zu polemisch, zu negativ und abwertend und letztlich kontraproduktiv. Meines Erachtens wären Begriffe wie ‚Ablehnung’, ‚Widerstand’ oder ‚Kritik’ vorzuziehen.