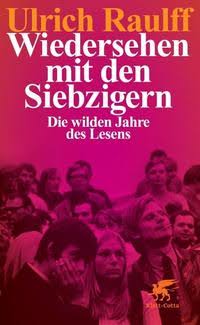
Über eine vielversprechende Buchbesprechung in der NZZ bin ich auf dieses Buch gestossen (leider ist diese zurzeit in meinem diesen Namen nicht verdienenden Archiv nicht auffindbar).
Allein schon die Person des Autors (gemäss Klappentext) ist anmächelig: geboren 1950; Studium der Philosophie und Geschichte in Marburg, Frankfurt und Paris; forschte in Europa und den USA (wie sich aus dem Buch schliessen lässt, mindestens teilweise als freier Forscher, d.h. ohne auf ein Einkommen angewiesen zu sein), lebte in Berlin, Frankfurt und München; Feuilleton-Chef FAZ, Leitender Redaktor SZ; seit 2004 Direktor des Deutschen Literaturarchivs in Marburg.
Nochmals der Klappentext:
«Im Unterschied zu den Sechzigern» haben die siebziger Jahre keine gute Presse. Die Sechziger gelten als cool und heroisch, sie tragen das Gesicht von John F. Kennedy und den Sound von Miles Davis. Die Männer fuhren schnell und bewegten sich sparsam, die Frauen waren intellektuell und trugen Mähne. Alles war noch auf Anfang gestellt, alles war vintage. Die Siebziger stehen im Ruf der Wiederholung und im Zeichen der Dekadenz, sie waren zu bunt, zu laut, zu formlos. In Deutschland mündeten sie in die Katastrophe der RAF-Morde, international in die letzte, harte Phase des Kalten Krieges. Ästhetisch hinterliessen sie Betonwüsten, bildungspolitisch die reformierte Massenuniversität. Ihr Farbspektrum war nicht besser als ihr politisches und moralisches Design. Es ist nicht leicht, die Siebziger zu mögen. Ausser wenn man sie intensiv erlebt hat und auf dem Weg war, ein Intellektueller zu werden.»
Das Buch besteht aus angenehm kurzen Kapiteln und ist hervorragend geschrieben: exzellenter Stil, kreativ und einfallsreich. Es ist eine Sammlung von kleinen Essays, die um die persönlichen Erinnerungen des Autors an sein ‚Erwachsenwerden‘ im Verlauf der 1970er Jahre kreisen – also seine persönlichen 20er Jahre – und um einige Erinnerungsflashes aus seiner Kindheit. Es ist strukturlos und hat keine eigentliche Botschaft; es vertritt weder eine Ideologie noch eine bestimmte wissenschaftliche Theorie. Bedingt durch den Zeitraum und die Orte, die Raulff ‚heimgesucht‘ hat, spielen Strömungen wie die Frankfurter Schule oder Strukturalismus und Poststrukturalismus eine bedeutende Rolle. Für jemanden wie ich, der die 70er Jahre gut 10 Jahre älter als der Autor erlebt hat, ist die Lektüre spannend und anregend. Raulff zeigt einem, was man als ‚nicht-intellektueller‘, aber am Zeitgeschehen hochgradig interessierter Mensch und gleichzeitig als in einem technischen Gebiet mehr als 100%-ig berufstätiger Mensch im geistig-philosophischen Bereich verpasst haben könnte.
Heute sage ich ohne Scham, deshalb möglicherweise als hochnäsig oder banausisch angesehen zu werden: nicht viel. Die philosophischen Strömungen dieser Zeit haben – auch nachdem ich mich jetzt im Buch und wegen dieses Buchs auch in Wikipedia et al – ein wenig damit auseinandergesetzt und hineingedacht habe, wenig bleibende Relevanz und Bedeutung. Mir kommt Vieles davon wie ein Luxusproblem vor, dessen Studium weitgehend überflüssig und verzichtbar wäre, oder wie eine Banalität, die auf ziemlich esoterisch und abgehobene Art und Weise hinter einer inhaltsleeren Dunstwolke versteckt wird.
Ich bereue die Lektüre trotzdem nicht, denn sie vermittelt einen Einblick in eine Welt, die ich kaum kenne, in der ich mich aber offensichtlich nie wohl gefühlt hätte.
Im Buch erlebte ich Wiederbegegnung mit Schauplätzen, die ich in den 70-er Jahren gut kannte und häufig besuchte (vor allem Paris und London), die mir aber so, wie sie Raulff beschreibt, völlig fremd vorkamen. Auch dies bestätigt, dass die Welt der Strukturalisten und deren Nachkommen neben – oder über? – der realen Welt lebten. Vielleicht ist das der Unterschied zwischen Feuilleton (und Flunkerei) und ‚echter‘ Philosophie wie derjenigen von Kant; Kant erklärte die Welt und den Menschen, und mit dem, was die Such der Menschen nach Antworten auf seine berühmten drei einfachen Fragen auslösten, veränderte er sie.
PS – ein letzter Giftpfeil:
Das Buch bestätigt in meiner unmassgeblichen Sicht auch, wie provinziell entweder ich selbst bin, oder wie provinziell die akademische Welt Deutschlands ist: Raulff wirft nur so mit Namen von angeblich gescheiten oder massgebenden Denkern und Schreibern um sich, von denen ich noch nie gehört habe, und die heute ziemlich sicher in Vergessenheit geraten sind.
Gemäss diesem Buch ist Raulff – und mit ihm zahllose weitere junge Deutsche – vorwiegend in Deutschland und mit deutschen Gelehrten, einer Prise Frankreich und noch weniger angelsächsischer Kultur und Geschichte sozialisiert worden – von anderen Kulturräumen wie etwa Asien kein Wort! Er ist auch geschichtlich ziemlich kurzatmig: was er nicht an zeitaktuellem Stoff gelernt und aufgenommen hat, existiert kaum.
Jedenfalls vermisse ich eine Aussage, was denn die Strukturalisten und deren Nachfahren Neues (und Besseres als deren Vorfahren) gebracht haben, von dem man heute noch zehren könnte. Es entsteht der Eindruck, dass etwas, das anders ist als bisher, schon allein deswegen gut und interessant sein muss. Etwas viel l’art pour l’art…