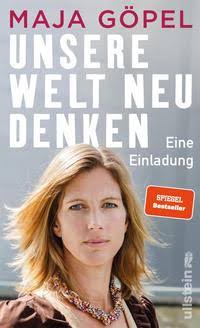
Ein schönes Kontrastprogramm!
- Hier Maja Göpel: eine kluge, belesene und beredte Anklägerin des deplorablen Zustands unserer Welt, die drauf und dran ist, die Lebensgrundlagen der Spezies Mensch durch kontinuierliche Übernutzung der begrenzten natürlichen Ressourcen zu zerstören; die aber unter dem Motto «Unsere Welt neu denken» nicht viel mehr zu bieten hat als einen Katalog aller gesellschaftlichen Missetaten sowie den hilflosen und inhaltsleeren Appell »Es muss alles anders werden».
- Dort Bill Gates («How to avoid a climate disaster»; siehe vorangehende Buchbesprechung): ein älterer weisser heterosexueller Mann,
- der den Siegeszug des PC an führender Stelle ermöglicht und mitgestaltet hat,
- der vor vielen Jahren die Führungsposition in seiner Firma aufgegeben und zusammen mit seiner Frau Melinda eine unsäglich reiche philanthropische Stiftung aufgebaut hat und diese weltweit für die Lösung drängender Menschheitsprobleme einsetzt,
- der aber die gleichen Probleme wie Göpel sieht, deren Ausmass und die unermessliche Anstrengung, die es zur Lösung braucht, konkret benennt und in klarer, einfacher Sprache verständlich darlegt;
- der dann aber mit Unternehmergeist und Optimismus Lösungen sucht und solche in einer Kombination von wissenschaftlichen Durchbrüchen, technischen Innovationen, Unternehmergeist sowie nachvollziehbar begründeten Postulaten zur kreativen und gezielten politischen Steuerung auch findet.
- Europäische Jeremiade versus amerikanischen «Let’s go and do it!»-Spirit.
Anders gesagt: «How to avoid a climate disaster» ist ein Sachbuch, das klar und deutlich sagt, was das Problem und dessen Haupttreiber sind, welches Ziel anzustreben ist («netto null»), welche Lösungsmöglichkeiten heute schon bestehen oder innert den kommenden Jahrzehnten neu zu erfinden und entwickeln sind, und welche zielwidrigen regulatorischen Anreize zu beseitigen und durch zielbezogen richtige zu ersetzen sind. Im Gegensatz dazu ist «Unsere Welt neu denken – Eine Einladung» ein Gebetsbuch, genauer ein ‚Gesund-Betbuch‘; die Autorin zelebriert in episodischer Breite und in unscharf voneinander abgegrenzten Kapiteln Zivilisations- und Wirtschaftskritik und begnügt sich letztlich mit dem naiven und wirkungslos verpuffenden Appell des ‚Neu Denkens‘. Sie impliziert, dass die Menschen – freiwillig – neue Menschen werden müssen, die plötzlich uneigennützig auf Wohlstands-Besitzstände verzichten, primär nur noch dem Gemeinwohl verpflichtet leben, – und dann wird alles gut. Dabei verzichtet sie auf jeden Versuch zu definieren, was denn nun das ‚Gemeinwohl‘ sein könnte, wer mit welcher Autorität oder demokratischen Legitimität dies festlegen und anschliessend auf Dauer und mit welchen Mitteln durchsetzen könnte.
Zur Illustration einige wenige willkürlich ausgewählte Beispiele:
Schluss des Kapitels «Technologischer Fortschritt» (Seite 117):
«Technologischer Fortschritt gilt als sichtbarstes Zeichen menschlicher Fortentwicklung. Solange wir aber die Einbettung von Technik in Umwelt und Gesellschaft nicht mitdenken, fehlt uns der Blick dafür, wo sie uns hintreibt. Um in der neuen Realität gut zusammenleben zu können, müssen wir auch unsere Vorstellung von Fortschritt ändern, sonst verschieben wir die Probleme einfach weiter in die Zukunft.»
Meine Kritik:
- Technologischer Fortschritt gilt als sichtbarstes Zeichen menschlicher Fortentwicklung. Was soll diese Feststellung, die an sich schon sehr problematisch und im Kontext von Göpel auch nicht begründet wird, ist?
- wir: Wer ist wir?
- Einbettung von Technik in Umwelt und Gesellschaft nicht mitdenken: Göpel meint offensichtlich, dass die Einbettung von Technik in Umwelt und Gesellschaft a priori ‚designed‘ werden kann oder muss; die Vorstellung, dass beim Zusammenspiel von Technik und Umwelt oder Gesellschaft Prozesse wirken, die auf Risiko, Zufall und ‚Versuch und Irrtum‘ basieren, scheint ihr fremd zu sein.
- wo sie uns hintreibt: Widerspruch zu mitdenken; entweder denken wir die Einbettung von Technik mit, oder sie treibt uns irgendwo hin.
- neuen Realität gut zusammenleben: Was ist die ‚neue Realität‘? Wer bestimmt, was ‚gut zusammenleben‘‘ konkret bedeutet?
- unsere Vorstellung von Fortschritt: Wie sieht diese Vorstellung aus? Wer hat sie entwickelt und festgelegt? Wenn schon ändern, wie soll die neue Vorstellung aussehen?
Das ganze Buch besteht aus Texten wie diesem. Für mich ist das Schall und Rauch: tönt zwar klug und gut, bleibt aber inhaltsleer und ohne jeden Bezug auf zielgerichtetes Handeln. Das ist schade, denn das Problem, das Göpel anspricht und auch in seiner Tragweite anerkennt, ist real, dringend und bedarf grösster Anstrengung der Weltgemeinschaft, wenn es innert nützlicher Frist zu einer Lösung kommen soll. Gesundbeten bringt uns da leider nicht weiter. Da ist meines Erachtens der pragmatische, konkrete, fakten- und zielorientierte Ansatz von Gates wesentlich wirkungsvoller. Sogar falls sich herausstellen sollte, dass dieser Ansatz illusorisch ist, wird man ihm nicht vorwerfen können, einem weltverbesserischen Wunschtraum verfallen zu sein.
Das Buch hat einige weitere Schwächen, die ich nur summarisch ansprechen will:
- Bösewicht-Rolle der Wirtschaft: Göpel stellt die Wirtschaft als Treiber der unserem Wirtschaftssystem inhärenten Wachstums- und Konsumsucht dar. Gemäss Göpel werden die Menschen von der Wirtschaft gezwungen, immer mehr und immer wieder die neusten deren Produkte zu kaufen. Ich halte dies für problematisch bis falsch, weil für mich die Balance oder die Suche nach Balance zwischen Angebot und Nachfrage ein Wechselspiel zwischen Produzenten (Innovatoren eingeschlossen) und Konsumenten ist. Die Konsumenten, die – freiwillig und ohne Zwang – immer wieder das neuste iPhone, die neusten Modekleider, die spektakulärere Ferienreise der Kolleginnen oder Kollegen oder das grössere Auto als der Nachbar haben wollen, tragen mindestens so viel zum Wachstum bei wie die Industrie, die ihre Produkte vermarkten will. Jedes Unternehmen, das sich nicht auf die Nachfrage einstellt, sondern meint, seine Produkte den Kunden aufzwingen zu können, ist auf dem Pfad zum Untergang.
Ausserdem gab es, als die Menschen von den Bäumen herunterkletterten und im aufrechten Gang ein besseres Leben suchten, noch keine verführerische Wirtschaft oder Werbung. Neugier, Wunsch nach Wachstum, besseren Lebensumständen, Konkurrenz sind natürliche Grundelemente aller Lebewesen und Treiber der evolutionären Entwicklung.
Das Gegeneinander-Ausspielen von Wirtschaft und Menschen ist ohnehin abwegig, denn die Menschen als Konsumenten, Arbeitnehmer, Unternehmer, Pensionäre, Aktionäre oder Wissenschaftler sind genauso Teil der Wirtschaft wie die produzierende Industrie.
- Schmalspuriges Verständnis für ‚Nachhaltigkeit‘: Der moderne Begriff von ‚Nachhaltigkeit‘ postuliert ein ausgewogenes Verhältnis der drei Faktoren Ökologie, Ökonomie und Soziales. Göpel fordert an mehreren Stellen eine Balance zwischen Ökologie und Sozialem (u.a. Seiten 163, 179) als Voraussetzung für Gerechtigkeit oder nachhaltige Wirtschaftsweise. Bei ihr fehlt das Ökonomische, leider ohne jeden Hinweis darauf, wie eine Wirtschafts- oder Gesellschaftsordnung ohne die ökonomische Dimension funktionieren können soll.
- Staat als Innovator, Privatwirtschaft als Trittbrettfahrer (Kapitel «Markt, Staat und Gemeingut», Seite 142ff): Unter Bezugnahme auf Mariana Mazzucato ortet Göpel bei vielen wichtigen Innovationen der Technik den Hauptbeitrag bei der vom Staat finanzierten Grundlagenforschung; der Beitrag von Firmen wie Apple liege im Marketing und Design. Sie zitiert Mazzucato, gemäss der in Wahrheit «der tollkühne Initiator von Innovationen» der Staat ist, der «Entrepreneurial State».
So sehr dies in bestimmten Bereichen zutrifft, so sehr verkennen Mazzucato und Göpel, dass zahllose private Hochschulen wesentliche Beiträge zur Grundlagenforschung leisten und auch private Unternehmungen massiv in Grundlagenforschung investieren (gerade im Bereich der Informations- und Telekommunikationstechnologie; Beispiele: IBM Research Labs, Bell Labs, Xerox Palo Alto Research Center), und dass die Übergänge von Grundlagenforschung zu angewandter Forschung sehr fliessend sind (siehe Start-up-Förderung von Hochschulen), und dass die beiden Forschungsebenen sich gegenseitig in einem dauerhaften Austauschprozess befruchten.
Grundlagenforschung ist nota bene per definitionem nicht ‚entrepreneurial‘, denn sie ist im weitesten Sinn zweckfrei. Es ist nicht der Grundlagenforscher, sondern der Unternehmer, der unternehmerische Wissenschaftler, Ingenieur oder Kaufmann, der in einer Entdeckung der Grundlagenforschung das Potential für ein neues Produkt, für eine neuartige und bessere Lösung von Problemen, welche die Gesellschaft beschäftigen, erkennt und den Prozess zur Entwicklung von marktfähigen Anwendungen initiiert und steuert.
- Feindbild ‚Bill Gates‘: Göpel sieht Bill Gates mehrfach als abschreckendes Beispiel für verantwortungsloses In-der-Welt-Herumfliegen (und dann noch mit Privatjet). Am einzigen Ort, wo sie auch erwähnt, was er mit seiner Herumfliegerei, beziehungsweise er und seine Frau mit ihrer Stiftung tatsächlich tun (Seiten 168-169), serviert sie umgehend die sauren Trauben von fehlender demokratischer Kontrolle und anzunehmendem Motiv des Ablasshandels. Ihre Implikation, die Milliarden der Gates-Stiftung würden auf bessere Ziele ausgerichtet und effizienter investiert, wenn Gates sie als Steuern abliefern müsste und sie danach von Bürokratien verwaltet würden, begründet sie nicht einmal ansatzweise.
- Name Dropping: Maja Göpel begleitet unzählige ihrer Aussagen oder Behauptungen mit Zitaten; in einer mündlichen Konversation würde man dies als Name Dropping bezeichnen. Das ist bemühend, ermüdend und auch erstaunlich:
- Bemühend, weil sie voraussetzt, dass ihre Leserinnen und Leser mit diesen – aus meiner Sicht häufig obskuren – Namen etwas anfangen können. Denn sie liefert keinerlei Information über den Stellenwert und die Bedeutung der von ihr zitierten Personen (mit Ausnahme von John Maynard Keynes, den sie dafür mit ex cathedra-Anspruch als bedeutendsten Ökonomen des 20. Jahrhunderts einstuft, allerdings ohne Begründung oder Hinweis auf ihre Einstufungskriterien).
- Ermüdend, weil die Zitate selten etwas zur Anreicherung der damit unterstützten Aussagen beitragen; sie sind überdies meistens genauso schwammig und definitionsfrei wie die Aussagen Göpels.
- Erstaunlich, weil kaum eines der Zitate von einer Frau stammt. Dies erweckt den Eindruck, dass Frauen bisher wenig bis nichts zur Entwicklung oder zur Theorie unserer Wirtschaftssysteme beigetragen haben (frei nach dem kolportierten Weckruf der Ehefrau von Erich Mende – ehemaliger FDP-Chef und Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland: «Aufstehen, Erich, Karriere machen!» Dabei wäre es interessant zu erfahren, welche Rolle die Frauen beispielsweise als Treiber der exzessiven materiellen und statusmässigen Orientierung ihrer Männer gespielt haben könnten.
- «Die Donut-Ökonomie. Endlich ein Wirtschaftsmodell, das den Planeten nicht zerstört» von Kate Raworth: Dieses Buch wird von Maja Göpel in ihrem Anhang «Wer weitermachen will» als Anregung zum «Weiter denken» aufgeführt, mit folgendem Text:
«Das Donut Symbol mit planetaren Ober- und sozialen Untergrenzen hat 2012 einen Durchbruch bei Diskussionen um die Grüne Ökonomie bei den Vereinten Nationen ermöglicht, und Kate Raworth hat in diesem Buch eine neue Ökonomie für den Korridor zwischen den beiden Grenzen vorgestellt.»
Da Göpel offensichtlich das Buch empfiehlt, kann angenommen werden, dass sie sich inhaltlich damit identifiziert. Das ist nicht erstaunlich, da Raworth – wie Göpel – den ‚homo oeconomicus‘ als auf die Maximierung seines Eigennutzens fixierte Wurzel des Übels der Übernutzung der Natur brandmarkt und einen neuen Menschen postuliert.
(Ich habe das Buch nicht gelesen und beziehe mich auf dessen Besprechung durch Alain Zucker in der NZZ am Sonntag vom 11. April 2021.)
Schluss jetzt.
Wer davon überzeugt ist, dass die Rettung unseres Planeten eine Frage der Moral ist, findet im Buch von Maja Göpel reichlich Nahrung. Wer – bei aller Wertschätzung von Moral – überzeugt ist, dass rationales, praktisches, zielbezogenes Handeln, das vom gegebenen Menschen mit seinen Schwächen und Stärken ausgeht, mehr Erfolg verspricht, ist beim Buch von Bill Gates besser aufgehoben. Auch er denkt unsere Welt neu; aber er geht von den bekannten Fakten aus, ordnet die Haupt-Treiber der bekannten Umweltprobleme, insbesondere des Treibhauseffekts, nach der Grösse ihres Anteils am Problem, beurteilt bestehende Techniken bezüglich ihres Lösungspotentials, identifiziert Hemmschwellen gegen deren Verwendung, schlägt Lösungen vor, und er präsentiert eine Auslegeordnung von Problembereichen, in denen neue, noch nicht entwickelte Techniken gefragt sind, mit denen das übergeordnete Ziel ‚netto null‘, innert nützlicher Zeit, d.h. bis Ende des 21. Jahrhunderts, erreicht werden könnte. Und er zeigt, dass der von ihm vorgeschlagene Lösungsweg auch für den ‚homo oeconomicus‘ attraktiv und erstrebenswert ist, weil er in letzter Konsequenz nicht nur für die Erhaltung der Lebensgrundlagen der Menschheit, sondern auch dem Eigennutz dient.