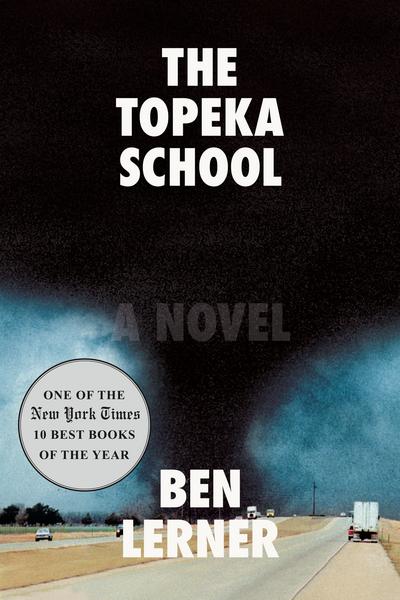
Endlich komme ich dazu, den dritten Teil der Trilogie von Ben Lerner zu lesen, deren Besprechung in der NZZ mich überhaupt auf den Autor Lerner geführt hat. Die beiden ersten Bände sind «Leaving the Atocha Station» und «10:04» (siehe Besprechungen 2020-20 und 2021-01; insbesondere «Mitten ins Herz von Amerika» von Andrea Köhler in 2020-20).
Die Story:
«Adam Gordon is a Senior at Topeka High School, class of ’97. His mother, Jane, is a famous feminist author; his father, Jonathan, is an expert at getting ‚lost boys‘ toopen up.They both work at a psychiatric clinic that has attracted staff and patients from around the world. Adam is a renowned debater, expected to win. a national championship before he heads to college. He is one of the cool kids, ready to fight or, better, freestyle about fighting if it keeps his peers from thinking of him as weak. Adam is also one of the seniors who bring the loner Darren Eberheart – who is, unbeknownst to Adam his father’s patient – into the social scene, to disastrous effects.
Deftly shifting perspectives and time periods, The Topeka School is the story of one’s family struggles and strengths: Jane’s reckoning with the legacy of an abusive father, Jonathan’s marital transgressions, the challenge of raising a good son in a culture of toxic masculinity. It is also a riveting prehistory of the present: the collapse of public speech, the trolls and tyrants of the New Right, and the ongoing crisis of identity among white men.» (Zitat aus Klappentext der Taschenbuchausgabe bei Picador – Farrar, Strauss and Giroux, 2020)
Auch der dritte Band der Adam-Gordon-Trilogie ist sehr anspruchsvoll geschrieben: Ben Lerner neigt dazu, bei der Wahl von mehreren Varianten, einen Sachverhalt zu beschreiben oder zu benennen, die literarisch gewählteste oder das fremdeste Fremdwort einzusetzen. Wenn Musik vorkommt, geht es kaum unter Debussy oder Rimsky-Korsakov (Schreibweise Lerner); und wenn deutschsprachige Literatur eine Rolle spielt, dann muss es natürlich – typisch für Amerikaner, die im mittleren Westen leben – Hesse sein. Hesses Kurzgeschichte «A Man by the Name of Ziegler» (siehe einschlägigen Internet-Eintrag am Ende dieser Besprechung) und die märchenhafte Fähigkeit der Hauptfigur Ziegler, dank einer sonderbaren Pille plötzlich die Sprache der Tiere zu verstehen, gleichzeitig die eigene Sprache sowie das überhebliche Gefühl, als Mensch die Krone der Schöpfung zu sein, zu verlieren und schliesslich im Irrenhaus zu landen, dient ihm dabei als Metapher für das Schicksal, wenn nicht der Menschheit, dann mindestens einiger seiner Protagonisten.
Die Besprechung von Andrea Köhler – eine gründliche und umfassende Bewertung des Romans – ergänze ich nur mit folgenden Hinweisen und Eindrücken:
Die Zusammenfassung von Andrea Köhler, oder auch der Klappentext, macht den Eindruck, die Geschichte würde einigermassen folgerichtig erzählt. Der Roman besteht aber aus lauter kleinen. manchmal grösseren Episoden, die ohne erkennbaren Zusammenhang und ohne chronologische Abfolge aneinandergereiht sind. Das macht es den Lesern manchmal schwer, den roten Faden nicht zu verlieren – oder überhaupt zu finden.
Insgesamt halte ich das Buch für eine zwar intelligente, aber letztlich artifizielle, von der Wirklichkeit abgehobene Kopfgeburt.
Die zentralen Elemente des Romans sind:
- die ‚Foundation‘, eine landesweit renommierte psychiatrische Institution, die sowohl Lehre betreibt als auch psychisch geschädigte Patienten, in erster Linie Kinder und Jugendliche, betreut
- Die ‚Foundation‘ ist ein weitgehend auf sich selbst zentriertes Biotop von Psychologen und Psychotherapeuten, in dem – entgegen von professionellen – Grundsätzen jede(r) jede(n) analysiert oder therapiert; soziale Distanz und Respekt vor individuellen Abgrenzungen fehlen weitgehend
- Adam Gordon, Sohn von Jonathan und Jane Gordon
- Jonathan, Psychotherapeut, der sich erfolgreich und vor allem um sogenannte ‚lost boys‘ kümmert
- Jane, ebenfalls Psychotherapeut, die als Publizistin von psychotherapeutischen Büchern berühmt wird
- Jonathan und Jane, bereits ein Paar, ziehen als Post-Docs von New York nach Topeka, um in der ‚Foundation‘ ihre akademische Entwicklung abzuschliessen; als New Yorker Bohemians sind sie im Milieu des Mittleren Westens Exoten.
- Klaus, ein verstorbener Holocaust-Überlebender, fand in Topeka seine zweite Heimat, war mit Adams Eltern befreundet und für Adam und dessen Eltern eine Art geistiger Übervater; er gibt immer wieder aus dem Off seine Meinung zum Geschehen.
- Darren Eberheart, ex-Schulkollege von Adam, Sohn einer alleinerziehenden Mutter, ist geistig minderbemittelt, fliegt aus der High School und lebt in Topeka als sozialer Einzelgänger und Sonderling; er wird von Adam und Altersgenossen in ihrem letzte High School-Jahr wieder in die Gruppe aufgenommen. Darrens Lebensepisoden sind in separaten Kapiteln jeweils als Interludium zwischen die Kapitel mit der Geschichte der eigentlichen Hauptpersoneneingeschoben; der Zweck dieser Nebenhandlung hat sich mir nicht erschlossen.
Wichtige Elemente der Geschichte sind real und sind auch Elemente der Biografie des Autors; dazu gehören:
- Topeka (Kansas) als zentraler Ort der Handlung (wo nicht nur Adam, der Held der Geschichte, ist auch der Ort, in dem Ben Lerner selbst geboren wurde und aufwuchs.
- die ‚Foundation‘, an der Adams Eltern als Psyotherapeuten und Dozenten tätig sind, ist wohl ein Klon der Menninger Foundation, die tatsächlich in Topeka existierte, und die sich wie diese in den frühen 2100-er Jahren nach Texas verlagerte.
- Auch Lerners Eltern waren Psychotherapeuten und arbeiteten als Familientherapeuten in der ‚Foundation‘.
- Dies legt nahe, dass der Roman autobiografische Züge hat.
Der Schreibstil von Lerner wechselt von Kapitel zu Kapitel:
- In einigen verwendet er die Form der Ich-Erzählung, abwechslungsweise in der Perspektive von Jonathan oder Jane, und ganz zum Schluss auch von Adam.
- In anderen, auch in den Darren-Einschüben, berichtet er in der dritten Person. Dann ist er sehr auktorial, d.h. er weiss alles, auch was in den Köpfen der handelnden Personen vorgeht.
Lerner hat zwei spezifische Vorlieben – oder Marotten: Fast alles kann sowohl so als auch ganz anders sein. Sätze wie «They are walking toward us fast and slow, in the present and in the past.» (Seite 67), oder «The opposite might also be true.» (Seite 117) kommen explizit oder implizit fast auf jeder Seite vor. Und seine Gestalten bewegen sich stets zwischen der Handlungsebene und der Metaebene hin und her. Das treibt Lerner auf die Spitze, wenn er seine handelnden Personen sich selbst immer wieder zwischen der ersten und der dritten Person unterscheiden lässt, zum Beispiel: «I was confused, and confused about why I was confused; it was like I was hearing several stories at once, like I was hearing Grandma’s story in one ear and then a different story in the other.»
Das macht die Lektüre sehr anstrengend bis mühsam, weil er so viel in die Metaebene hineinpackt, dass einem schwindlig wird. Es ist schwer vorstellbar, dass ein normales Leben überhaupt möglich ist, wenn eine Person auf Schritt und Tritt immer wieder in die Metaebene wechselt und darüber reflektiert, was, warum sie oder er gerade macht oder denkt.
Hinzu kommt, dass alles, was Lerner in die Metaebene hineinsteckt, weitgehend personenunabhängig ist, d.h. alle denken in den gleichen Mustern und Wertvorstellungen, sowie auf gleichem sprachlichem Niveau. Und das ist bei so verschiedenen Figuren wie Hochschulprofessoren, High School-Absolventen, Debilen oder unermesslich klugen und gebildeten Holocaust-Überlebenden nicht sehr realistisch.
Für mich ist The Topeka School ein interessantes Buch, auch deswegen interessant, weil es von der Kritik so hochgelobt wird. Das halte ich für übertrieben, oder für einen Hinweis, dass das zeitgenössische literarische Niveau Amerikas nicht sehr anspruchsvoll ist. Ich finde jedenfalls im Buch «die sprachlose Wut Amerikas» oder den «Sprung mitten ins Herz von Amerika» (siehe Besprechung von Andrea Köhler, 2020-20) nicht. Auch «It is also a riveting prehistory of the present: the collapse of public speech, the trolls and tyrants of the New Right, and the ongoing crisis of identity among white men» (Klappentext der Taschenbuchausgabe) halte ich für masslos übertrieben. Gerade dieses Zitat illustriert übrigens eine weitere Schwäche Ben Lerners: erverwendet häufig Formeln, die zwar gelehrt oder gebildet tönen, aber hohl und bedeutungslos sind, wie «riveting prehistory of the present». Beispiele aus dem Buch: «he swam back into himself» (Seite 11), «linguistic phosphenes» (Seite 236), «the more profound a statement, the more reversible» (Seite 61), «New York, which is a logarithm of other cities, other times» (Seite 176), «… as thogh Darren were disclosing new territories of thought and feeling, new words, as though he were their Caedmon. For they had always been told to include him and this constituted the zenith of inclusion, the assimilation of Darren to corporate speech, their busted prosodies, and if there was irony, not all of it was cruel» (Seiter 257).
Ein besonders aufschlussreiches und pikantes Detail findet sich auf Seite 199: «They were singing Bach, which is classical music.» An vielen Stellen lässt Lerner namentlich benannte Musikgruppen ‚auftreten‘; kein einziges Mal liefert er Details zu diesen Gruppen, etwa wie gross sie sind, oder welchen Musikstil sie spielen – er setzt also voraus, dass die Leser die Gruppen kennen. Die Tatsache, dass er bei Bach diesen Hinweis bringt, zeigt, welches kulturelle Niveau er im Publikum voraussetzt. Dabei bin ich überzeugt davon, dass alle Leserinnen und Leser, die sich bis auf Seite 199 durchgebissen haben, wissen, wer Bach ist.
Auszug aus https://www.enotes.com/topics/hermann-hesse/critical-essays
«A Man by the Name of Ziegler»
Kurzgeschichte von Hermann Hesse; «Ein Mensch mit Namen Ziegler» aus «Die Heimkehr»
«A Man by the Name of Ziegler» foreshadows the surrealistic style of Hesse’s later works and shows his predilection toward Eastern pantheism, even before his trip to the East. In this story, Hesse depicts modern civilization as empty. Ziegler, the protagonist, is representative of modern human beings: He is smug and self-satisfied; he exists rather than really lives. Ziegler is unaware of the emptiness of his own life. At the beginning of the story, Hesse describes Ziegler as one of those people whom one sees everyday yet never remembers because he has a «collective» face. Ziegler is neither stupid nor gifted; he likes money, pleasures, and dressing well and is always concerned about what other people think of him. He judges people only from the outside, by how they are dressed, and treats them accordingly. Ziegler respects money and science; he has no appreciation for beauty but values practical results alone. Because his father has died of cancer, he admires cancer research, hoping that a cure can be found so that he will not suffer the same fate. Hesse shows readers a mediocre, superficial person who is full of his own importance. Ziegler’s life is not ruled by the promptings of his inner nature but rather by prohibitions and fear of punishment. He believes that he is an individual; in reality, Hesse explains, he is merely a specimen. Hesse describes him ironically as a «charming young fellow.»
After arriving in a new town, Ziegler decides to go sightseeing. His choice of where to go is determined by money: The museum is free on a Sunday, and the zoo can be visited for a moderate fee on the same day. The museum bores him. While killing time there until lunch, he notices a display of medieval witchcraft which he dismisses contemptuously as childish nonsense. He nevertheless takes a pellet from the display, and when another visitor enters the room, he hurriedly hides it in his pocket. While waiting for lunch in a restaurant, he smells the pellet and then swallows it. After lunch he goes to the zoo.
To his surprise, the pellet has given him the power to understand what animals say. To his horror, he hears the contempt and disdain that the animals have for humans; to them Ziegler is no better than vermin, «an absurd and repulsive bug.» The animals themselves are more noble than human beings. Ziegler is dejected and wrenched from his usual habits of thought in which he thinks of human beings (and himself in particular) as the pinnacle of creation. Ziegler now also looks at people through the eyes of animals and finds no dignity in them at all; he sees only a «degenerate, dissembling mob of bestial fops.» In despair, he throws away his formerly treasured fashionable gloves, shoes, and walking cane and sobs against the bars of the elk’s cage. He is taken away to an insane asylum. The sudden realization that he is nothing drives him mad.»