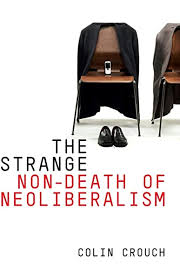
Colin Crouch ist Professor of Governance and Public Management at Warwick Business School. Gemäss seinem Einleitungskapitel «About this Book» publiziert er sehr eifrig; er bezieht sich im vorliegenden (2011 publizierten) Buch extensiv auf seine eigenen früheren Publikationen und positioniert dieses damit – wohl unfreiwillig – als ‚Rezyklat’.
Im Kapitel 1, «The Previous Career of Neoliberalism», fasst er die Geschichte des Liberalismus, oder des Neoliberalismus – es ist nie ganz klar, was er nun wirklich meint – als Grundlage für die weiteren Ausführungen zusammen. Er versucht auch, den Begriff ‚Neoliberalism’ zu definieren und gegenüber konkurrierenden Wirtschafts- und Gesellschaftsmodellen abzugrenzen.
Aus diesem Rückblick kristallisieren sich bei mir sich folgende Eindrücke:
- Crouch verwendet den Begriff ‚Neoliberalism’ in einer extrem losen und unscharfen Weise. Entsprechend unscharf sind in der Folge auch seine Abgrenzungsversuche. Beispiel: Er bezeichnet alle englischen Regierungen seit Ende der 1970-er Jahre als ‚neoliberal’; damit wirft er Thatcher, Major, Blair, Brown und Cameron in den gleichen Topf. Eine Begründung für diesen ‚Eintopf’ bleibt er schuldig. Ein Begriff, der diese Bandbreite von politischen Ideen und ökonomischen Konzepten abdeckt, bleibt notgedrungen ‚wischiwaschi’. Überdies landen kommunistische, westeuropäische sozialistische, auch skandinavische, sozialdemokratische und die US-amerikanische Linke im selben ‚Eintopf’.
- In seinem Rückblick fokussiert Crouch primär auf Fehlleistungen und Verirrungen des Marktes (was immer das auch sein mag); Staats- oder Regulierungsversagen scheint es nicht gegeben zu haben.
- Er führt (schon im ‚Preface’) als Grundlage für und roten Faden durch sein Buch die These ein, dass es in der heutigen Gesellschaft nicht mehr um den Gegensatz oder die Konkurrenz zwischen Markt und Staat geht, sondern dass eine dritte Kraft, nämlich die ‚giant corporation’, die sowohl den Markt aus auch die Politik aushebelt. Er bezeichnet das, was sich in diesem Dreieck abspielt, als ‚comfortable accomodation’, deren Gewinner einerseits die ‚giant corporation’ ist, insbesondere weil die ‚comfortable accomodation’ im Endergebnis die treibende Kraft liberaler Konzepte, nämlich den Wettbewerb und die freie Wahl der Konsumenten, ausschaltet.
Schon allein die Behauptung, ‚giant corporations’ hätten Politik und Markt um den Finger gewickelt, ist zu bezweifeln. Aber auch wenn man unterstellt, dass die ‚really giant corporations’ einen grossen Einfluss, insbesondere auf die Politik, haben, ist Couch in der Absolutheit seiner These nicht überzeugend. Deutschland und etwa auch die Schweiz sind nicht die einzigen Länder, in denen der grösste Teil der wirtschaftlichen Leistung und der Innovation von mittelständischen Unternehmungen erbracht wird.
Ausserdem zeigen neue ‚giant corporations’, die vor 30 Jahren noch nicht existierten und noch gar keine Zeit und Lust haben, sich in eine ‚comfortable accomodation’ zu begeben, dass die statische Betrachtung von Couch der tatsächlichen Dynamik der Unternehmenswelt in keiner Art und Weise gerecht wird.
Die Titel der folgenden Kapitel zeigen schon deutlich, in welcher Richtung die in der Exposition eingeführten Gedanken weiter entwickelt werden: The Market and Its Limitations; The Corporate Takeover of the Market; Private Firms and Public Business; Privatized Keynesianism: Debt in Place of Discipline; From Corporate Political Entanglement to Corporate Social Responsibility; Values and Civil Society; What’s Left of What’s Right?
Das alles verstärkt bei der Lektüre meine Skepsis und meine Neugier auf die Fortsetzung.
Der Anfang des Kapitels «The Market and Its Limitations» bringt mich jetzt aber richtig auf die Palme. Crouch schreibt so, als ob es in der Welt der ‚giant corporations’ – oder noch pauschaler in der Business-Welt – nur Verbrecher gäbe; als ob sich die Geschäftswelt nicht weltweit an Gesetze zu halten habe, sondern völlig frei schalten und walten könne, oder als ob sie die sie betreffenden Gesetze selber gemacht hätten und beliebig manipulieren könnten. Seine Herleitung der These, die Märkte, und damit die kommerziell tätigen Instanzen, seien amoralisch, ist haarsträubend und abstossend.
Er schiesst tapfer und fleissig auf Feinbilder, nachdem er sie selbst gemalt hat.
Bei der Behauptung, die ‚giants’ könnten tun und lassen, was sie wollen, ignoriert Crouch auch die Tatsache, dass es heute für jeden Aktivisten oder Gutmenschen jederzeit möglich ist, mit einem Facebook-Appell oder einer Twitter-Botschaft jeden Grosskonzern an den Pranger zu stellen und zu erpressen. Dass dieses ‚Geschäft’ völlig verantwortungslos ist, weil keiner der selbsternannten ‚Ankläger’ je für die Folgen seiner meist falschen oder übertriebenen Anschuldigungen geradestehen muss, ist für Crouch offenbar vernachlässigbar.
Ich gebe auf und lese dieses von Ideologie triefende Machwerk von Buch nicht weiter – es erinnert mich zu sehr an Jean Ziegler. Meine Zeit ist mir dafür zu schade! Wenn ich trotzdem noch weiter darin herumschmökere, dann nur, um meinen Adrenalinspiegel auf Trab zu bringen oder zu halten.
Ausserdem ist das Buch, jedenfalls mein Exemplar, sehr schlecht produziert: der Text ist so weit in den ‚Bund’ hineingedruckt, dass man die Seiten ziemlich fest auseinanderdrücken muss; dann hält aber die Verleimung nicht und die Seiten fallen auseinander, fallen sozusagen aus dem Leim. Vielleicht ein Omen: die Theorie ist ebenso lausig und fällt für den kritischen Leser völlig auseinander.
PS:
Ein Beispiel für die Verwegenheit, Demagogie oder Ignoranz von Couchs Argumentation findet sich auf Seiten 26-27. Zuerst behauptet er: Although in principle the market is governed by consumer sovereignty, consumers cannot decide what products will be made available. Only firms can do this. The consumers’ role is a passive one, limited to signalling by their offers to purchase that a new product is useful to them. Als Beispiel führt er an: Consumers did not generate demand for iPads; a firm found that it could make them, and set about generating a demand by clever marketing and by ensuring that it was an attractive product. Consumers then greatly appreciate the things that they can do with their iPads; the invention is an excellent example of the market improving our quality of life in a way that never happened in state socialist economies, where no one had an incentive to make anything new for consumers. But the role of consumers in all this was passive.
Reiner Unsinn, abgesehen vom Vergleich – am Schluss der zitierten Passage – mit dem sozialistischen Wirtschaftssystem. Unsinn, denn der Bedarf nach tragbaren, ursprünglich ‚hand held’ oder ‚palm’ Geräten ist fast so alt wie der PC und Laptop. Im Verlauf der Evolution der Informatik-Industrie gab es zahlreiche Versuche, so ein ‚Ding’ auf den Markt zu bringen; niemand hatte Erfolg damit, weil entweder das ‚Ding‘ zu schwer, die Funktionalität zu eingeschränkt, oder die Batterie zu kurzlebig war – bis zum iPad. Apple hat also das die Idee des iPad nicht erfunden, sondern war einfach die erste Firma, der es gelang, das längst artikulierte Kundenbedürfnis so zu realisieren, dass daraus ein Renner wurde.Couch begibt sich mit diesem Beispiel etwa auf die Stufe eines Besserwissers, der ex cathedra behauptet, das Huhn sei vor dem Ei da gewesen.