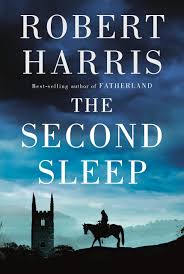
Die Story dieses Romans irritiert. Zunächst beginnt sie mit Szenen, die – jedenfalls auf den ersten Blick – im ländlichen englischen Mittelalter (um 1400) spielen. Erste Zweifel tauchen auf, wenn der Priester, der von seinem Bischof in ein abgelegenes Dorf geschickt wird, um einen dort unter seltsamen Umständen verstorbenen Dorfpfarrer ordentlich unter den Boden zu bringen, in dessen Studierzimmer eine Sammlung von exotischen Objekten findet, die auch als Plastik bestehen, darunter ein rätselhaftes Gerät, das mit einem Logo aus einem angebissenen Apfel geschmückt ist. Allmählich wird klar, dass die Geschichte des Romans in einer Zeit spielt, die rund zehn Jahrhunderte nach dem Untergang oder Armageddon einer früheren Zivilisation stattfindet (also +/- im Jahr 3100); eine Zeit also, in der die Nachkommen der Menschen, die den Armageddon überlebt haben, wieder so leben, wie die Engländer um 1400 nach unserer Zeitrechnung. Die Deutungshoheit über das, was gut und erlaubt, beziehungsweise was böse ist und ins Verderben führt, liegt bei der katholischen Kirche (man lebt ja in einer vorreformatorischen Zeit).
Der Roman liest sich spannend, auch wenn gewisse Passagen mit ausführlichen Zitaten aus der katholischen Liturgie eher langweilig und ermüdend wirken (besonders für einen katholisch erzogenen Leser wie mich), auch wenn sie natürlich der Geschichte Authentizität verleihen.
robertDie Ursache des Armageddons, also des weltweiten Untergangs der Zivilisation des 21. Jahrhunderts, bleibt auch am Ende des Romans unklar. Es ist jedenfalls nicht der Brexit; dieses Wort kommt im Roman nicht vor. Auch bleibt unklar, weshalb die Versuche neugieriger Menschen, diese Ursache entgegen den Vorgaben und Auflagen der Kirche zu erforschen, ebenfalls in die Krise führen. Insofern ist das Ende des Romans unbefriedigend. Es sei denn, der Autor beabsichtige, die Deutung dieser Ereignisse bewusst der Fantasie des Lesers zu überlassen. In meinem Fall ist das Ergebnis: Ratlosigkeit!