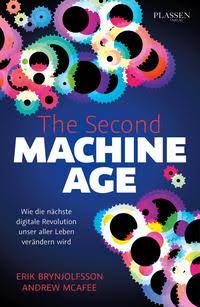
Die beiden MIT-Koryphäen (Brynjolfsson: Director oft the MIT Center for Digital Business; McAfee: Principal Research Scientist an diesem Center) bieten einen gut lesbaren breiten Überblick über den ‚state of the art’ im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik. Sie beschreiben dabei nicht nur die mutmassliche Entwicklung der Technik, sondern ebenso deren Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft. In mancher Hinsicht (z.B. bei Themen wie ‚Jobvernichtung‘ versus ‚Schaffung von Arbeitsplätzen‘, oder ‚Wohlstandsmehrung‘ (bounty) versus ‚Wohlstandsverteilung‘ (spread) oder bei der Behandlung von Technikrisiken) präsentieren sie jedoch weitaus mehr Fragen als Antworten.
Insgesamt bringt das Buch – bei allen Vorbehalten bezüglich Hype und Technikgläubigkeit – eine lesenswerte Bestandsaufnahme und Standortbestimmung.
Der Text präsentiert sich wie eine redigierte Niederschrift einer Vorlesungsreihe; entsprechend enthält er viel Redundanz und ist vom Niveau her nicht sehr anspruchsvoll (wahrscheinlich handelt es sich um Vorlesungen für ‚jüngere Semester‘). Dabei sind die Verfasser in den ersten 190 Seiten geradezu hingerissen von dem, was Computer alles können. Wie fast alle Technokraten untertreiben sie die Entwicklung der Leistungsfähigkeit der Maschinen (Hardware) und übertreiben das Potential der Problemlösungsfähigkeit der Menschen (Software). In ihren Analysen differenzieren sie meines Erachtens viel zu wenig zwischen Aufgaben, die wir umfassend verstehen und deshalb an Maschinen delegieren können, und solchen, die wir nicht verstehen; das führt zwangsläufig zum branchenüblichen Hype in Sachen AI und dergleichen.
Zwar unterscheiden die Autoren am Anfang klar zwischen dem, was Menschen können, und dem, was man Maschinen zutrauen kann – allerdings ohne dabei daran zu denken, dass Maschinen grundsätzlich nur das können, was Menschen erdacht und formalisiert haben. Sie schildern spektakuläre Entwicklungen wie beispielsweise Googles ‚driverless car‘ als Ergebnis des technischen Fortschritts und bedenken die Rolle, die der Mensch bei der Entwicklung dieses Autos und der Komponenten, die ihm erlauben, ‚driverless‘ zu fahren, zu wenig explizit und deutlich.
Hinweis: Google‘s ‚driverless car‘, der in diesem 2014 erschienen Buch beschrieben wird, wie wenn es ihn schon gäbe, fährt auch 2020 noch (lange) nicht!
Den Hauptunterschied zwischen Maschinen und Menschen sehen sie in deren unterschiedlich entwickelten Fähigkeit zur ‚large frame pattern recognition‘ sowie zur ‚complex communication‘. Für sie ist dies allerdings eine Grenze, die sich laufend verschiebt (natürlich zugunsten der Maschinen), nicht eine Grenze, die auf grundsätzlichen Unterschieden besteht. Damit wecken sie – vielleicht unfreiwillig – Erwartungen an die Technik, die diese noch auf lange Sicht, vielleicht nie, erfüllen können wird. Sie schreiben zwar in Kapitel 12 (mit dem irreführenden Titel «Learning to race with machines», Seite 191): «We have never seen a truly creative machine, or an entrepreneurial one, or an innovative one. … We’ve also never have seen software that could create good software; so far, attempts at this have been abject failures.» Anders gesagt: für die Autoren ist die Grenze zwischen Maschine und Mensch fliessend und in ständiger Bewegung; sie erwähnen mit keinem Wort, dass es (vielleicht oder hoffentlich) eine Grenze gibt, die nicht mehr graduell, sondern prinzipiell ist.
Bei dieser Gelegenheit führen sie als dritte Fähigkeit, in der Menschen den Maschinen überlegen sind, die ‚ideation‘ ein; damit meinen sie, kurz gesagt, alles, was mit Kreativität zu tun hat. Sie hätten es sich einfacher machen können, wenn sie konsequent auf eine uralte Definition (Autor mir leider nicht mehr bekannt) des Unterschieds zwischen Computern (Maschinen) und Menschen zurückgegriffen hätten: Computer sind ‚rule-following‘ Maschinen, Menschen sind ‚goal-seeking‘ Wesen. Meines Erachtens wäre es sinnvoll und sicher noch für lange Zeit zutreffend und wünschbar, auf der Grundlage des heutigen und vorhersehbaren ‚state oft he art‘ anzuerkennen, dass Computer alles und nur das können, was regelbasiert formuliert werden kann, und Menschen sich um die Ziele, um den kreativen Prozess der Aufgabenselektion, um das Kreative – oder in der Sprache der Autoren, um Ideen – und, bevor Maschinen überhaupt ins Spiel kommen, um die Erforschung der Regeln, nach denen wir leben und arbeiten, kümmern sollten.
Im Übrigen enthält das Buch schöne und für Technokratendenken typische Beispiele für Dinge, die angeblich dank Technik möglich und nutzbar wurden, die es aber seit Jahrhunderten gibt. Stellvertretend für alle diene Selbst-organisiertes-Lernen: war das nicht etwas, was die Menschen betrieben haben, solange es keine formalisierte Schule gab?
Ganz zum Schluss werden die Autoren dann doch noch etwas bescheiden. Sie positionieren zumindest einen Teil ihrer Zukunftsperspektiven eher als ‚science fiction‘ denn als realistische Aussichten, und als immerhin mit so gravierenden gesellschaftlichen Folgen und Gefahren verbunden, dass sie selbst sich fragen, ob das alles wünschbar und beherrschbar wäre.
Aber das Buch muss ja auch verkauft werden. Da hilft Hype!