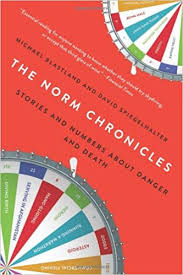
Das Buch behandelt in einer Einführung und 26 themenspezifischen (anwendungsorientiert) Kapiteln unterschiedliche Aspekte von Risiken, Chancen und unseren ebenso unterschiedlichen Umgang mit Zahlen, Wahrscheinlichkeit und Gefahren.
Obwohl von Engländern geschrieben, und in den meisten Beispielen auf englischem Zahlenmaterial basiert, habe ich den Eindruck, dass es allgemein gültig ist (siehe auch Besprechung des Buchs in The Economist vom 22. Juni 2013). Das Buch erinnert nachdrücklich daran, dass Wahrscheinlichkeiten für den Einzelnen ziemlich bedeutungslos sind, denn eine Wahrscheinlichkeit von 20%, dass – Beispiel erfunden – ein Individuum an Keuchhusten erkrankt, bedeutet nicht, dass sie oder er einen 20%-igen Keuchhusten bekommt, sondern einen 100%-igen oder gar keinen. Es macht auch deutlich, dass wir als Gesellschaft und Individuen darauf konditioniert sind, zunächst immer nur in «Risiken» zu denken und fühlen, nicht aber in Chancen; illustriert wird dies mit der banalen Tatsache, dass die 20%-Wahrscheinlichkeit, an Keuchhusten zu erkranken, auch bedeutet, dass wir eine 80%-Chance haben, von Keuchhusten verschont zu bleiben. Ausserdem wird betont, dass zwischen absolutem und relativem Risiko ein grosser Unterschied besteht, dass aber, angeführt von den Medien, am häufigsten mit dem relativen Risiko operiert wird, weil damit eindrücklichere, wenn nicht schrecklichere Tatsachen suggeriert und Ängste geschürt werden können. Zur Illustration dient folgender Sachverhalt:
- In England bekommen 5 von 400 Personen Bauchspeicheldrüsen-Krebs.
- Eine Studie zeigt, dass, wenn 400 Personen täglich verarbeitetes Fleisch (z.B. Wurst) essen, das Risiko, Bauchspeicheldrüsen-Krebs zu bekommen, um 20% steigt.
- Konkret bedeutet das:
- Statt 5 von 400 bekommen jetzt 6 Personen diese Krankheit; das ist eine Steigerung des relativen Risikos um 20%.
- Das absolute Risiko steigt von 5 auf 6 von 400, d.h. um 0.25%.
- Nach wie vor bekommen 394 von 400 keinen Bauchspeicheldrüsen-Krebs.
- Und 395 von 400 Personen sind von der Änderung des Speisezettels nicht betroffen.
Die Autoren operieren mit der neuen Masseinheit ‚MicroMort’ (MM); das ist die Wahrscheinlichkeit von 1:1’000’000, dass ein normal lebender Erwachsener an einem beliebigen Tag eines extern verursachten gewaltsamen Todes stirbt. Diesem Mass liegt die in England und Wales tatsächliche Wirklichkeit zugrunde, dass täglich rund 50 Personen (von 50’000’000 Einwohnern) gewaltsam ums Leben kommen; also hat jeder Mensch ein Risiko von 1 MM, dass ihm etwas passiert. Umgekehrt wird auch mit dem Mass ‚MicroNot’ (MN) operiert; wenn ein Mensch mit 1 MM rechnen muss, dass er eines gewaltsamen Todes stirbt, hat er nämlich auch 999’999 MN’s, dass er verschont bleibt.
Selbst wenn jemand sein Verhalten so ändert, dass sein Risiko eines gewaltsamen Todes auf 2 MM’s ansteigt (also um 100%), sinkt seine Chance, dass ihm nichts passiert, nur von 999’999 MN’s auf 999’998. Also die Chance, dass alles gut geht, sinkt bloss um 0.00001% – eine viel bessere Perspektive!
Das Buch ist mit viel Humor und amüsant geschrieben, manchmal auch etwas langfädig und mit wenig Anspruch an das (Mit-)Denkvermögen seiner Leser. Trotzdem: es liest sich sehr genussvoll – aber nicht in einem Zug. Man kann die einzelnen Kapitel sehr gut einzeln lesen, und das Buch dann wieder eine Weile liegen lassen.Für Menschen, die sehr ängstlich sind und von Medienberichten oder Mund-zu-Mund-Gerüchten schnell in Panik versetzt werden, eigentlich eine Pflichtlektüre!