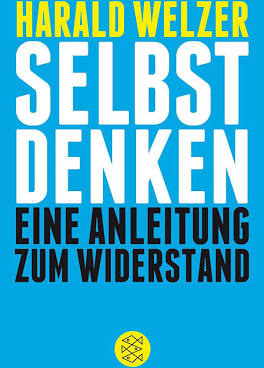
Aus dem Klappentext – Innen:
Was ist bloss aus unserer Zukunft geworden? Es ist höchste Zeit, dass sich jeder überlegt, wie wir eigentlich leben wollen – damit die Zukunft wieder ein Versprechen und keine Bedrohung ist. Dieses Buch ist eine Anleitung dafür: Harald Welzer, der bekannteste und vielleicht konsequenteste Vordenker des Landes, lotet schonungslos die Abgründe der vom Konsumvirus und politischer Lähmung befallenen Gesellschaft aus. Und er zeigt, wie viele konkrete und attraktive Möglichkeiten es bereits jetzt gibt, zum politischen Handeln zurückzufinden und sich wieder ernst zu nehmen. Der erste Schritt ist gar nicht schwer: selbst denken!
Aus dem Klappentext – Aussen (Rückseite Taschenbuchausgabe Fischer 2017):
.Früher war Zukunft ein Versprechen, dass alles besser wird. Doch heute ist klar, dass es nicht weitergehen kann wie bisher. Harald Welzer analysiert schonungslos die gegenwärtige Lage: Ein expandierender Konsum verzehrt alle Ressourcen, die Bürger sind politisch gelähmt. Das muss anders werden. Wir müssen uns wieder ernst nehmen und selbst denken! Harald Welzer zeigt uns wie. Damit Zukunft keine Bedrohung ist, sondern wieder Versprechen wird.
Nach den ersten 70 Seiten der Fischer-Taschenbuchausgabe verfestigt sich bei mir eine erste Zwischenbilanz:
Die Kernthese Welzers ist, dass die heutige Gesellschaft weltweit über ihre Verhältnisse lebt und «bis heute eine so heillose Übernutzung der verfügbaren Überlebensressourcen mit sich [bringt], dass absehbar ist, dass sie in ein, zwei, drei Jahrzehnten ihre eigenen Funktionsvoraussetzungen zerstört haben wird.» (Seite 51) Das grosse Thema ist also ‚die Rettung der Welt‘, bei näherer Betrachtung die Erhaltung der Lebensbedingungen für uns Menschen, also ganz bescheiden ‚nur‘ die Erhaltung der Spezies Homo Sapiens.
Diese Feststellung der Übernutzung der verfügbaren Überlebensressourcen kann wohl als unbestritten akzeptiert werden.
Welzer schildert die Entwicklung hin zu dieser unersättlichen Gesellschaft, die nicht mehr weiss, wann sie genug hat, sehr anschaulich, manchmal mit sarkastischem Galgenhumor, manchmal aber auch mit erhobenem Zeigefinger und mit missionarischem Eifer, der eher abstossend ist – umso mehr als er schon in seinen einführenden Kapiteln mit Redundanz nicht geizt. Die Lektüre wird allerdings auch dadurch erschwert, dass Welzer seine Theorien in knapp 70 Kapiteln ausbreitet, die ohne erkennbare Struktur nebeneinander angeordnet sind, so wie wenn eine Sammlung von Zeitungskolumnen in einer Lotterietrommel durcheinandergewirbelt und dann ausgeleert und zufällig, d.h. ohne erkennbaren inneren Zusmamenhang, aneinandergereiht worden wären. Es fehlt nur der Disclaimer «ohne Gewähr».
Welzer ortet die Hauptschuldigen an dieser Entwicklung, die er als zwingende Folge einer in der Menschheit tief verwurzelten Wachstumsreligion sieht, in der Aufklärung und der industriellen Revolution der letzten 200 Jahre.
Das ist Unsinn. Die tiefste Ursache dieser Entwicklung ist – nach neudeutscher Diktion – das Narrativ oder die Erzählung vom Sündenfall von Adam und Eva, der darin bestand, dass sie in ihrem Paradies verbotenerweise vom Baum der Erkenntnis essen wollten. Sie erhielten dafür Strafe: «Geht hinaus, schuftet im Schweisse Eures Angesichts und macht Euch die Erde untertan!» Welzer erwähnt natürlich weder den Sündenfall noch die dafür erteilte Strafe. Aber mit diesem Sündenfall wird die genetisch verankerte Neugier sowie der ur-evolutionäre Antrieb der Spezies Mensch, stets neue Erkenntnisse zu suchen, aufzubrechen und Neues zu explorieren, treffend illustriert. Es sind diese inhärenten Wesenseigenschaften der Menschen, welche letztlich zur heute beklagenswerten Übernutzung der Ressourcen unseres Planeten führen.
Unsere Vorfahren sind wegen der Neugier, die in der DANN unserer Spezies steckt, wegen des Verlangens nach einem besseren oder schöneren Leben von den Bäumen herabgestiegen, haben den aufrechten Gang gelernt, sind in alle Himmelsrichtungen ausgeströmt, um neue Futterplätze, bessere klimatische Bedingungen, eine vor Raubtieren sicherere Lebenswelt zu finden. Sie haben gelernt, dass Sesshaftigkeit, Tierzucht und Ackerbau ein einfacheres Leben ermöglichen als Herumvagabundieren, Jagen und Sammeln. Schon vor Jahrtausenden haben Sie Siedlungen und Städte gebaut, haben die Arbeitsteilung erfunden, haben über grosse Distanzen Handel betrieben, die Produktivität gesteigert und damit ein Bevölkerungswachstum ermöglicht, das seinerseits einen steten Drang nach wirtschaftlichem Wachstum auslöste. Schlussendlich entstand so unserer heutige Lebenswelt – ganz ohne Kapitalismus, Neoliberalismus oder auf Wachstum getrimmte Werbeindustrie.
Die industrielle Revolution ist also nicht die Ursache der Probleme, sondern die Folge der Natur der Spezies Mensch.
Er charakterisiert das Verhalten der Menschen, die – sehr wohl in Kenntnis der selbstzerstörerischen Wirkung ihres vom Wunsch nach IMMER ALLES und IMMER MEHR DAVON gesteuerten Verhaltens – als irrational. «Nur Verrückte können ja glauben, dass es in einer physikalisch begrenzten Entität von allem immer mehr geben könne.» (Seite 51)
Natürlich kann man das Verhalten der Menschen, die uferlose Übernutzung der Ressourcen des Planeten trotz absehbarer Grenzen unendlich weiter zu betreiben, als irrational bezeichnen. Das würde jedoch voraussetzen, dass das diesem Verhalten zugrundeliegende Ziel bekannt wäre. Das kritisierte Verhalten ist nur dann irrational, wenn dieses Ziel darin bestehen würde, die Ressourcen des Planeten so schonend zu benutzen, dass sie auch für die Nutzung durch nachkommende Generationen stets in genügender Menge verfügbar blieben. könnten. Konsequent zu Ende gedacht, wäre das Ziel des von Welzer postulierten ‚rationalen‘ Verhaltens die Erhaltung der Spezies Mensch – für immer und ewig.
Wenn das Ziel jedoch wäre: «Wir geniessen, was es hat, und solange es hat. Die kommenden Generationen müssen für sich selbst sorgen.!» wäre ein von der Wachstumsreligion gesteuerten Verhaltens durchaus rational.
Meines Erachtens ist in jedem Fall das von Welzer suggerierte Ziel irrational; spätestens mit dem Erkalten des Erdkerns oder dem Erlöschen der Sonne sind die Lebensbedingungen auf diesem Planeten für die Spezies Mensch nicht mehr vorhanden. Die Vorstellung, dass unsere Spezies die erste der Erdgeschichte sein soll, die ‚ewig‘ lebt und gedeiht, ist mindestens so abwegig wie die Vorstellung, dass unsere Spezies eine endliche Lebenserwartung hat.
Welzer schreibt sehr unterhaltsam, illustriert seine Feststellungen oder Behauptungen mit zahlreichen Beispielen, deren Repräsentativität allerdings häufig sehr zu bezweifeln ist. Er kann auch sehr sarkastisch sein und den dominierenden, aber wohl angestrebten Eindruck vom demnächst bevorstehenden Welt- oder Zivilisationsuntergang mit galgenhumorigem Lachen etwas dämpfen.
Einerseits erweckt er mit vielen beiläufigen oder dogmatischen Bemerkungen den Eindruck, die negative Entwicklung unserer Zivilisation in Richtung Selbstzerstörung sei durch die kapitalistische Marktwirtschaft, den Neoliberalismus oder durch die arbeitsteilige Wirtschaft bewusst verursacht. An anderen Stellen sagt er jedoch auch deutsch und deutlich, dass solche Entwicklung einfach passieren, z.B. auf Seite 67:
«Historisch geschehen umfassende Transformationen – also etwa die Industrielle Revolution mit ihren fundamentalen Auswirkungen auf Produktionsverhältnisse, Wirtschaftsformen, Zeitstrukturen, Familienformen, Selbstbilder, Krankheiten usw. – unabsichtlich. Niemand hat so etwas wie die Industrielle Revolution geplant (Anmerkung BB: Ich halte die Verbindung von Begriffen wie ‚Industrielle Revolution‘ mit ‚geschehen‘ für problematisch; ein Ereignis geschieht, hat einen Beginn und ein Ende; aber die Industrielle Revolution war kein Ereignis, sondern eine Entwicklung, welche sich über Jahrhunderte erstreckte und weder einen diskreten Anfang noch ein spezifisches Ende hatte). Revolutionen dieses Typs werden auch nicht als solche begriffen, wenn sie stattfinden, sondern erst in der späteren historischen Rückschau, wenn erkennbar geworden ist, wie sehr sich ein historischer Zustand von einem vorangegangenen unterschieden hatte. Auch die «68er» wussten nicht, dass sie dereinst «68er» gewesen sein würden. Als Zeitgenosse bewegt man sich mit dem gleitenden Gegenwartspunkt, ist Teil der Veränderung und überblickt sie daher nicht.»
Leider begnügt sich Welzer damit, immer wieder die Industrielle Revolution oder die kapitalistische Wachstumswirtschaft für unzählige Fehlentwicklungen verantwortlich zu machen. Da, wie oben gezeigt, die Industrielle Revolution und die kapitalistische Wachstumswirtschaft nicht selbst die Ursache bestimmter Fehlentwicklungen sein können, weil sie deren Folge sind, betreibt Welzer reine Symptombekämpfung. Solange wir die wirklichen Ursachen der Fehlentwicklungen nicht kennen, können alle Therapievorschläge letztlich nur in die Irre führen.
Im Kapitel ‚Moralisierung des Marktes‘ (Seiten 72-75) setzt sich Welzer mit dem Phänomen auseinander, dass in unserer Gesellschaft Produkte oder Ergebnisse des Marktgeschehens zunehmend mit moralischen Massstäben qualifiziert und skandalisiert werden. Dort weist er zurecht auf die widersinnige Haltung hin, die einerseits eine Firma wie Shell in der ‚Brent Spar‘-Affäre zum Boykott freigibt (völlig zu Unrecht, wie sich im Nachhinein herausstellt), aber dafür den benötigten Brennstoff bedenkenlos bei BP oder Aral Esso einkauft. Welzer beschliesst dieses Kapitel mit:
«Dass der Abnehmer des fossilen Treibstoffs das Problem ist und nicht der Anbieter, der den Stoff – der ja schliesslich seine Geschäftsgrundlage bildet – möglichst lange vorzuhalten beabsichtigt, geht in der Routine des Skandalmanagements unter. Das arbeitet mit immer wiederkehrendem Muster so, dass die Schäden kleingeredet werden, einige Schuldige identifiziert und gefeuert werden, die sichtbaren Schäden unter Einsatz professioneller und freiwilliger Helfer gemildert werden und schliesslich, aber dann hat es längst schon einen nächsten und einen übernächsten Skandal gegeben, das Ganze in juristischen Auseinandersetzungen um Haftung und Entschädigung abgearbeitet wird. Hier, wie in allen vergleichbaren Fällen, bildet stets der Unfall Anlass zur Empörung, nicht der Normalfall, der ihn verursacht.
Allerdings: auch hier verzichtet Welzer leider auf den Blick auf oder die Suche nach den tieferen Ursachen des Unfalls oder gar des Normalfalls. Denn dass in letzter Konsequenz der Abnehmer, also der Konsument, das Problem ist und nicht der Produzent, oder die ‚böse‘ Wirtschaft, gilt ganz allgemein, also nicht nur beim fossilen Treibstoff. Man kann diese Sicht als Ausrede oder Rückgriff auf die müssige Frage «Was ist das Huhn, was das Ei?» abtun (Welzer tut das nicht, weil er die Frage nach den tieferen Ursachen schon gar nicht stellt); aber es bleibt die Tatsache, dass bei der gesamten Diskussion über die selbstzerstörerischen Folgen menschlichen Handelns die Rolle und der Anteil der Vielen – also der einzelnen Menschen – gegenüber dem Anteil der Wenigen (im weitesten Sinne alle Produzenten von Gütern und Dienstleistungen, inklusive Staat) viel zu nachlässig oder gar nicht behandelt wird.
In den lesenswerten Kapiteln ‚Ein Kurzer Ausflug in die Geschichte der Ökologiebewegung‘ (Seiten 89-94) und ‚Protest‘ (Seiten 95-100) schildert Welzer sehr plausibel, warum Gesellschaften (genauso wie Individuen), die während langer Zeit mit einer bestimmten Strategie erfolgreich waren, wuchsen und erfolgreich blieben, Schwierigkeiten damit bekommen, ihre Strategie dann zu wechseln, wenn diese Strategie vorhersehbar an Grenzen stösst; paradoxerweise leben sie dann nach dem Motto «Was bisher erfolgreich war, wird uns wohl auch helfen, kommende, neue Probleme zu lösen.» und, während sie ihre Anstrengungen getreu nach dem Prinzip ‚Mehr vom Gleichen‘ verstärken, beschleunigen sie die Katastrophe. Er schildert allerdings ebenfalls, wie die Ökobewegung die gleichen Fehler begeht, und dass Ökobewegung und Wachstumsgläubige sich gegenseitig befeuern und die negativen Folgen ihres jeweiligen Tuns verstärken.
Ich finde es nur schade, dass er seine kritischen, aber sehr relevanten Überlegungen, abwertet, indem er die durch Wachstumseuphorie angetriebenen Entwicklungen immer wieder in die ‚böse‘ Kapitalismusschublade steckt, landwirtschaftliche Produktionssteigerungen wie selbstverständlich in das ‚gentechnische‘ Abseits stellt, oder alles zusammen in den Topf der .Industriellen Revolution‘ wirft. Erstenssind diese lateralen Arabesken unnötig, sie entwerten vielmehr die sachlichen Feststellungen. Zweitens sind sie schlicht und ergreifend falsch; denn Gewässer- oder Luftverschmutzung ist gab und gibt es überall, wo viele Menschen zusammenkommen, nicht erst mit der frühindustriellen Entwicklung europäischer Metropolen. Gerbereien oder Metzgereien verschmutzten Gewässer und Luft, seit es Städte gab; die hygienischen Verhältnisse auf Bauernhöfen oder Gewerbebetrieben haben schon Jahrhunderte vor der Industrialisierung Lebensqualität und Leben an sich zerstört. Es wird seine Gründe haben, dass die Menschen noch zu Beginn der Neuzeit den Kontakt mit Wasser oder das Lüften von Innenräumen, d.h. das Hereinlassen der Aussenluft, für gesundheitsschädigend hielten. Was mit der Industrialisierung hinzu kam, war das Tempo der Umweltzerstörung, nicht die Zerstörung an sich (anders gesagt: die Quantität, nicht die Qualität). Und drittens begibt sich Welzer mit diesen unqualifizierten Qualifizierungen in die schlechte Gesellschaft der kapitalimuskritischen Ideologen, die völlig blind dafür sind, dass alle nicht-kapitalistischen Systeme, die bislang ausprobiert worden sind, die Umwelt viel stärker als kapitalistische verheert haben – vor allem, weil die nicht-kapitalistischen im Vergleich zu kapitalistischen (deren DNA das ‚trial & error‘-Gen als festen Bestandteil mit sich trägt) durch und durch lernunfähig sind. Die völlig deplatzierten Qualifikationen Welzers verderben die gute Laune und die Lust am Weiterlesen. Schade!
Es ist für mich ein Rätsel, wie ein Wissenschaftler wie Welzer so tun und argumentieren kann, wie wenn die Welt vor der Industrialisierung ‚heil‘ gewesen wäre. Er hat wohl nie in einer Küche gegessen, in der mit grünem Holz gekocht und geheizt wurde, oder ist noch nie in einem Fluss oder See geschwommen, in dem alle gewerblichen und Haushalts-Abfälle, alle menschlichen und tierischen Exkremente ihres Einzugsbereichs sich ansammelten, oder ist nie in einer mittelalterlichen Gasse lustgewandelt, in der sich inmitten von Haushaltsabfällen und Exkrementen auch Hühner, Schweine und Ziegen tummelten, und die wegen nicht vorhandener Pflästerung und Entwässerung nach jedem Regenguss aus tiefem Schlamm bestand. Minimale, aber teilweise weit reichende Umweltverbesserungen wurden lange vor den ‚modernen Umweltschutz- und Ökologiebewegungen’ realisiert (Kanalisationen, Körperhygiene, Entsorgung, etc.) schlicht und einfach weil dies mit steigendem Wohlstand dem wachsenden Bedürfnis der Menschen nach einem schöneren und angenehmeren Leben entsprach – und weil man es sich dank Wohlstandsgewinn auch leisten konnte, und weil dank wissenschaftlichem Fortschritt die Bedeutung von Sauberkeit und Schutz der natürlichen Umwelt erkannt wurde, bevor es den Begriff ‚Ökologie‘ überhaupt gab, und bevor man wusste, dass man diesen für solche Massnahmen verwenden müsste.
Ab Seite 109 (Kapitel ‚Das Wunder des grünen Puddings‘, ‚Warum ist das Klima eigentlich so toll?‘, ‚Zurück zum Politischen‘, ‚Die zivilisatorische Aufgabe‘, ‚Selbst denken‘, ‚Utopien‘, ‚Achtsamkeit‘, ‚Ohne Masterplan‘, ‚Lebenskunst, schon bald‘, ‚Lebenskunst, 20 Jahre später‘) kommt Welzer zur Sache, das heisst zur konsolidierten Diagnose und zu seinen Therapievorschlägen: Die Essenz seiner Diagnose fasse ich wie folgt zusammen:
Die Ressourcen des Planeten Erde werden von der menschlichen Zivilisation massiv und noch zunehmend übernutzt.
Dadurch werden unserer Zivilisation die Grundlagen ihrer Daseinsberechtigung entzogen.
Die Ursachen der Übernutzung liegen hauptsächlich bei einer Wachstumsdogmatik, die gemäss Welzer von der Aufklärung, der Industrialisierung und dem Kapitalismus angestossen wurde.
Auf Seiten 130 postuliert Welzer ein ‚Menschenrecht auf künftiges Überleben‘ – das natürlich durch die Übernutzung der Ressourcen verletzt ist. Erstens ist unklar, woher er dieses Menschenrecht ableitet, und zweitens ist der Anspruch auf ein solches Menschenrecht extrem Hybris-getrieben und ein typischer Ausfluss eines Allmacht-Glaubens der Retter des Planeten, oder unserer Zivilisation. Er schreibt auf Seite 117-118 selbst: «Deshalb sind alle ökologischen Fragen nie etwas anderes als soziale und kulturelle Fragen. Sie betreffen immer die Existenzbedingungen menschlicher Überlebensgemeinschaften. Wenn diese Gemeinschaften naturwissenschaftliches Wissen und Technik für die Erhaltung ihrer Überlebensbedingungen einsetzen, bleibt dieser Einsatz eine soziale Handlung und etabliert eine soziale Praxis. … Die wiederum einfache Wahrheit lautet: Vollständige Naturbeherrschung bleibt ein unerfüllbarer Traum, solange Menschen Naturwesen sind, und jeder Versuch, äussere Natur zu beherrschen, verändert auch die innere Natur, entlässt sie also keines wegs aus dem Naturzwang.»
Mit der aktuellen Klimadiskussion sowie der Fokussierung der grünen Politik auf die Klimasituation wird zwar eine wichtige Folge der Übernutzung angesprochen, aber – mit Perspektive auf die gesamte Problematik – ein Nebenkriegsschauplatz betreten. Denn das Hauptproblem ist die Wachstumsgläubigkeit unserer Zivilisation. Und solange die expansive Nutzung unserer Ressourcen weitergeführt wird (wenn auch mit kleineren Wachstumsraten) und nicht durch einen reduktiven Lebensstil ersetzt wird, geht auch die Übernutzung weiter.
Welzer verwendet für seine Schilderung der von ihm als ideal betrachteten Zukunft einen Trick, den er mit der Verwendung der grammatikalischen Form des Futurum 2 realisiert. Er geht davon aus, dass es den Menschen schwerfällt, oder gar unmöglich ist, sich eine ‚Vorwärts-Zukunft‘ vorzustellen, die nicht auf Exploration der Gegenwart beruht, und damit Gefangene der Gegenwart bleibt. Er schlägt vor, Zukunftsvorstellungen eben im Futurum zwei zu formulieren, basierend auf dem, was man sich für die Zukunft wünscht: Wer wäre ich in 20 Jahren gerne gewesen; Welche Rolle ich dann gerne gehabt, und welchen Beitrag zu dieser Zukunft hätte ich gerne geleistet; davon ausgehend soll, man sich dann mögliche Schritte ‚in Richtung‘ dieser Zukunft überlegen, und diese begehen, ohne a priori zu wissen, wohin das führen soll; gelingt ein Schritt, folgt der nächste; misslingt ein Schritt, beginnt eine Folge von «Versuch und Irrtum», bis die Richtung zum Ziel wieder erreicht wird.
Für ihn sind solche Schilderungen ‚Geschichten‘, die erzählt werden wollen. Ich hasse diese Infantilisierung der Menschen, die anscheinend nicht mehr fähig sind, Theorien, Zukunftsvorstellungen, oder Visionen von Geschichten oder Märchen zu unterscheiden. Ausserdem ist es ein Missbrauch des Begriffs ‚Geschichte‘; der Begriff impliziert, dass eine Geschichte berichtet, was bereits passiert ist; Geschichte ist eben Vergangenheit, und nicht Zukunft.
Im Gegensatz zum ‚Futurum zwei‘ beruht der technokratische Ansatz auf der Logik: Bis jetzt sind wir Menschen mit dem technischen Fortschritt gut vorangekommen; was uns bisher geholfen hat, wird uns auch in Zukunft helfen, alle auftauchenden Probleme zu lösen. Wir brauchen dafür nur den richtigen Masterplan (den uns die Öko-Bewegung vorgibt oder vorgeben wird). Das wird aber nicht funktionieren, denn der Ersatz des expansiven Wirtschaftens durch eine reduktive Verzicht-Lebensweise ist kein technisches Problem, sondern ein gesellschaftlich-soziales. «Denn wie wir leben möchten: Das ist eine soziale und kulturelle Frage.» (Seite 134)
Das Grundübel ist die Wachstumsreligion, das «‚Expansive Modell des Kapitalismus‘… Dem Extraktivismus kann man nicht durch internationale Abkommen, schon gar nicht durch Geo-Engineering oder durch Eröffnung eines neuen Marktes beikommen: Erlässt sich nur durch Reduktion von Verbrauch bekämpfen.» (Welzer, Seite 125)
Ab Seite 129 beschreibt Welzer die aus seiner Sicht zentrale zivilisatorische Aufgabe, der wir uns zu stellen haben. «Im 21. Jahrhundert stehen wir vor der höchst konkreten Frage, wie man den durch die kapitalistische Wirtschaft erreichten zivilisatorischen Standard in Sachen Freiheit, Demokratie, Rechtstaatlichkeit, Bildungs- und Gesundheitsversorgung aufrechterhalten und zugleich die Ressourcenübernutzung radikal zurückfahren (Anmerkung BB: ‚zurückfahren‘ impliziert ein technokratisches, planmässiges Vorgehen, das der Autor aber anderswo als unrealistisch ablehnt) kann. Wenn man das ernsthaft will, geht das nicht ohne deutliche Wohlstandsverluste. Das gute Leben gibt es nicht umsonst.» (Fettdruckvon mir)
Welzer postuliert für die Veränderung unserer gesellschaftlich-sozialen Lebensverhältnisse ein angemessenes soziales Vorgehen, das damit beginnt, dass wir – jeder von uns für sich – un s die aus unserer Sicht wünschbare Zukunft vorstellen und dann auf den Weg machen, dorthin zu gelangen; er sieht dies als einen Prozess, der nicht planmässig geradlinig (also ohne Masterplan) verläuft, sondern uns nach dem Prinzip ‚trial & error‘ durch Sackgassen, Irrwege, Iterationen und erneutes Versuchen und Ausprobieren voranbringt.
Welzer fasst seine Lösung unter dem Utopie-Schlagwort «Zivilisierung durch weniger» zusammen. Wie das ohne Masterplan funktionieren könnte, schildert er ab Seite 150. Lebenskunst unter reduktiven Bedingungen läuft auf eine weitgehende Rückkehr zur Tauschwirtschaft hinaus.
Konkret beschreibt er, wie in seiner Vorstellung Deutschland im Jahr 2033 (20 Jahre nach Erscheinen seines Buchs) aussehen und funktionieren sollte. Nur als Andeutung dessen, was er sich vorstellt folgender Auszug (Seite 154):
«Schon vor 20 Jahren hatte sich über die rasche Verbreitung von Car-Sharing-Modellen und Giveboxen in den Städten der Paradigmenwechsel vom Besitzen zum Nutzen angekündigt, der heute in vollem Gange ist: Es gilt mittlerweile als cool, nur noch so viel wie nötig und so wenig wie möglich zu haben. Es ist der Lifestyle des Loslassens (neudeutsch LORAF = Lifestyle of Relief and Fun): Was man nicht hat, braucht keinen Raum, was man nicht hat, kann nicht geklaut werden, was man nicht hat, braucht nicht umzuziehen, was man nicht hat, kostet nichts. … Die meisten Leute arbeiten heute weniger. Klar: Weil der Rückgang der Produktion erheblich weniger Arbeitskraft und -zeit erfordert. Anders als im Spätkapitalismus führt Produktivitätsfortschritt heute nicht mehr zum Abbau von Arbeitsplätzen, sondern zur Verkürzung der Arbeitszeit. Viele Beschäftigte arbeiten heute nur noch halbtags; sie verdienen natürlich auch nur noch die Hälfte, was sich auf den Lebensstandard aber kaum auswirkt, weil sie insgesamt weniger Geld für Konsum brauchen. Obwohl der Gesetzgeber dafür gesorgt hat, dass endlich die lange externalisierten Kosten (wie die des Umweltverbrauchs) in die Preise eingerechnet werden, ist zwar vieles teuer geworden – besonders Produkte mit langen Wertschöpfungs- und Transportketten. Aber dafür sind Produkte mit kurzer Wertschöpfungskette, aus regionaler Produktion und lokalem Anbau, heute erheblich günstiger, sodass sich der Kaufkraftverlust in erträglichen Grenzen hält.»
So viel zur schönen neuen Welt Welzers – in Deutschland, der Insel der neuen Lebenskunst!
Se non vero, e bene trovato. Schön wär’s – aber mir fehlt der Glaube.
Zunächst einmal ist die Schilderung Welzers widersprüchlich und fehlerhaft. zu Recht sagt er anderswo, dass die gesellschaftlichen Prozesse, die der Wachstumswirtschaft zugrunde liegen, über Generationen entstanden sind. Es ist also völlig unglaubwürdig, wenn er den Übergang zur reduktiven Lebensweise innerhalb von 20 Jahren schildert. Er verkennt die ökonomischen Implikationen und Folgen einer auf Verzicht und ‚sharing‘ basierten Lebensweise und geht beispielsweise überhaupt nicht darauf ein, dass die durch eine solche Lebensweise überflüssig gewordenen Infrastrukturen und Kapazitäten entweder rückgebaut werden müssten (zu horrenden Kosten und mit unübersehbarem Ressourcenverschleiss) oder weiterhin enorme Fixkosten verursachen würden.
Am wichtigsten ist für mich die Kritik, dass Welzer den evolutionären Ursprung der Wachstumswirtschaft ignoriert. Das muss er ja wohl auch, weil er das Übel beim Kapitalismus verortet, anstatt auch den Kapitalismus als Folge des Übels ‚Evolution‘ zu sehen. Welzers Diagnose ist falsch, also ist auch seine Therapie falsch.
Natürlich bringt Welzer unmittelbar nach seiner wünschbaren Zukunft auch die Dystopie als Gegenstück (ab Kapitel «Eine nicht ganz so schöne Geschichte aus dem Jahr 2033»). Die globalisierte Welt zerfällt in einige wenige diktatorisch regierte Teilwelten, in denen die Machthaber dafür sorgen, dass es etwa 20% der Menschen gut gehen, während alle anderen ausgegrenzt, unterdrückt und letztlich ausgerottet werden.
Diese zentralen Stellen und Auszüge aus Welzers Therapie-Ideen genügen fürs Erste. Diese Ideen sind so unausgegoren und im Kern so naiv, dass eine rationale Auseinandersetzung damit nicht möglich und deshalb Zeitverschwendung wäre. Den ‚Jüngern‘ von Welzer mögen solche Ideen und Utopien Bestätigung bringen; für mich sind es Hirngespinste, voller Widersprüche und haltloser Behauptungen. Und das ganze Gebäude beruht meines Erachtens auf einer Fehldiagnose; die Essenz von Welzers Therapie ist die leider unausgesprochene Forderung: Die Rettung der Menschheit oder der menschlichen Zivilisation braucht einen neuen Menschen – wobei rätselhaft bleibt, woher der kommen soll (es sei als Ergebnis einer radikalen und, gemäss Welzer, weil technisch, unmöglichen, Genmanipulation). Welzer erklärt die Lösung damit, dass der Mensch von Natur aus prosozial, also kooperativ und mitfühlend, also nicht evolutionär-kompetitiv und besitzergreifend ist, dass er nur durch Kultur so geworden und deshalb fähig ist, alle Implikationen und Konsequenzen einer reduktiven Lebensweise mitzutragen und mitzumachen. Für mich beantwortet er die Frage nicht, wie es möglich gewesen sein soll, das Ergebnis von Millionen von Jahren der Evolution (ohne Kultur) durch 200 Jahre Kapitalismus und Aufklärung kulturell kaputt zu machen, beziehungsweise in ihr Gegenteil zu verkehren.
Ich begnüge mich im Folgenden mit meiner persönlichen Lektüre. Weitere Einträge zum Buch (ab Seite 154) mache ich nur, wenn er noch grundlegend Neues bringt.
Wie erwartet – die letzten knpap 200 Seiten bringen nichts Neues zu Diagnose oder Therapie; Welzer hat das zur Genüge ausgebreitet. Immerhin: die letzten Kapitel illustrieren mit vielen lebendig geschilderten ‚Geschichten‘ (im bereits kritisierten Sinn von Welzers Infantilisierungs-Manie, Geschichten zu erzählen, anstatt Utopien, Visionen oder schlicht und ergreifend Zukunftsvorstellungen zu entwickeln) über gelungene, gelingende und auch scheiternde Versuche, aus der Wachstumswirtschaft herauszukommen.
Allerdings, gerade in dieser geballten Ladung steckt meiner Ansicht nach sehr viel geballter Unsinn:
- die mantrahafte Zuschreibung aller Übel auf den Kapitalismus und die Wachstumsgier der Märkte
- die Beispiele stammen aus der Mikrowelt und können keinesfalls als Beginn einer ‚Welterneuerung‘ dienen, welche der globalen Ressourcen-Übernutzung die Stirne bieten könnten – auch nicht als Keimzelle einer kommenden ‚grass roots‘-Bewegung oder einer Reduktions-Tsunami; dafür sind sie viel zu ‚herzig‘ und naiv
- die Schwarzmalerei der Marktwirtschaft mit der Gleichsetzung von Markt und Umweltzerstörung, sowie die ignorante Sicht, dass es ein Klima von Gemeinsinn, Zugehörigkeitsgefühl, Bedürfnis nach und Befriedigung von Anerkennung nur in Gemeinschaften geben kann, die sich der postmodernen Reduktionsphilosophie verschrieben haben, also das Verkennen (oder verdrängen, weil es nicht ins vorgefasste Feindbild passt?) der Tatsache, dass es auch in hoch leistungsorientierten und gewinnorientierten Organisationen immer zahlreiche Inseln von kleinen Gemeinschaften geben muss und gibt, die ebenfalls ein solches Klima des Gemeinsinns leben und vorleben
- die Unfähigkeit anzuerkennen, dass auch ein Gemeinwohlbeitrag einer Unternehmung (auch wenn dies der erklärte oberste Zweck der Unternehmung sein soll) nur dann und erst dann möglich ist, wenn sie ein marktfähiges Produkt hat und zuallererst etwas damit verdient, sonst gibt es nichts, was man den Mitarbeitern, der Umwelt oder der Nachwelt als Gutes anbieten kann
- besonders naiv kommt mir folgender Aspekt vor:
- Welzer postuliert, dass der Weg von der expansiven Wirtschaft und Lebensweise zur reduktiven freiwillig erfolgt, also ohne Diktat und ohne zentrale Steuerung.
- Damit verläuft die Transformation zwangsläufig asynchron, und zwar innerhalb regionaler, nationaler oder erst recht globaler Gemeinschaften. Von der Übergangszeit ist bei Welzer keine Rede. Die Asynchronëität hat zur Folge, dass die expansive und die reduktive Lebensweise über grosse Zeiträume parallel, d.h. doppelt unterhalten werden müssen. Wenn er die deutschen 16’000 deutschen Autobahnen stilllegen und mit Windmühlen oder Solarpanels vollpflanzen will, kann er das erst machen, wenn die Autobahnen insgesamt nicht mehr benötigt werden. In der Zwischenzeit werden sie benötigt, und gleichzeitig müssen die Infrastrukturen für die Windmühlen und Solaranlagen aufgebaut werden. Das kostet, Platz und Geld. In seinen Darlegungen über Kompensation von Wohlstandsverlust aufgrund von Verzicht durch Einsparungen aufgrund von Ressourcen kommt dies alles nicht vor.
- Überhaupt zeugen die Vorschläge von Welzer, dass er das Konzept einer ABC-Analyse weder kennt noch verstanden hat. Der Sinn einer solchen Analyse besteht darin, dass eine Problemanalyse so strukturiert wird, dass die Ursachen für das Problem nach ihrem Beitrag zum Problem sortiert werden und die grössten Beiträger für 80% der Problemursachen (Kosten, Ressourcenverschwendung, etc.) sichtbar werden. Die Ursachen mit dem grössten Beitrag sind dann die A-Ursachen, die mit dem zweitgrössten die B-Ursachen, etc.; es versteht sich von selbst, dass eine rationale Problemlösung darauf basieren müsste, zuerst die grössten Ursachen zu beheben, und erst am Schluss die nebensächlichsten. Für die Reduktion der Übernutzung der Ressourcen der Welt wären somit – ohne grosse weitere kostentreibende Untersuchungen – mit erster Priorität die A-Ursachen anzugehen, d.h. die Privathaushalte (z.B. Wohnfläche pro Person), die Bevölkerungszunahme, der Verkehr oder die Produktionswirtschaft anzupacken , und nicht eine regionale Elektrizitätsfirma, oder eine Minibank für die Gewährung von gewerblichen Krediten für Öko-Start-ups, oder die Lancierung von Bionade, oder die Re-Animation von mittelalterlichen Transportmitteln im Pazifik.
- Sollte Welzers These, dass die Umorientierung von Expansionswirtschaft auf Reduktion weder befohlen noch durch einen Masterplan organisiert werden kann, sondern nur ‚von unten nach oben‘ vorgelebt und via Ansteckung ausgebreitet werden stimmen – wohlan; ich befürchte, dass sie falsch ist, und dass, selbst wenn sie stimmt, das Ziel nicht erreicht werden wird, bevor unsere Zivilisation untergegangen sein wird (immerhin: auch von mir ein Futurum zwei!)
Am stärksten kritisiere ich an Welzers Behandlung des offenkundig schwierigen Stoffs, dass er alles, was ihm als Utopie vorschwebt, am ‚Nagel‘ der Übernutzung aufhängt. Es würde vollauf genügen, wenn er betonen würde, dass es die geforderten bescheidenen, sparsamen und rücksichtsvollen Verhaltens- und Lebensweisen schon immer gegeben hat, und dass es nicht darum geht, etwas Neues zu erfinden und dazu passende ‚Geschichten‘ zu erzählen, sondern die alten Tugenden wieder zu beleben.
Die Essenz von «Selbst denken» wird besonders schön charakterisiert von folgender verdichteten Beschreibung des aktuellen Zeitgeists:
«Mikro lieber als Makro, Identität lieber als Klasse, eine Geschichte lieber als Analyse, individuelle Betroffenheit lieber als volkswirtschaftliche Analyse, Protagonisten lieber als Ideen.»
(Quelle: ein Tweet von Konrad Lischka, Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Essen, in NZZ vom 25. April 2019, Gesucht – ein neuer Konsens, von Jörg Scheller)