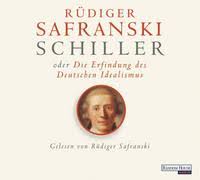
Eine fantastische Biografie der Person, des Philosophen, Historikers und Dichters Schillers, seiner wichtigsten Zeitgenossen und seiner Epoche.
Safranski gelingt es, einen roten Faden durch eine Schlüsselepoche der abendländischen Geschichte und Zivilisationsentwicklung zu ziehen, der sowohl fesselt und aufklärt als auch ständig zum Nachdenken über die Gegenwart und sich selbst anregt.
Schillers Epoche hat es in sich:
- Ende der Aufklärung
- Hochblüte der deutschen Klassik
- Anfänge der deutschen Romantik und des deutschen Idealismus
- französische Revolution
- Beginn des Entstehens der deutschen Nation und des deutschen Nationalstaats
- Anfang vom Ende des Absolutismus und Entstehung von demokratischen Strukturen
Schiller wird in seiner gesamten Wirkung plastisch herausgearbeitet. Es wird dabei deutlich, welchen Beitrag er zur kulturellen Leistung seiner Zeit erbracht und welche Wirkung er auf seine Zeit und darüber hinaus ausgeübt hat.
Die Lektüre macht – jedenfalls dem Laien – bewusst, was es für die Menschheit bedeutet hat, nach dem Sturz der Deutungshoheit der Kirche(n) den Weg und den Mut zum ‚sapere audere‘ zu finden, und welche geistige Titanenleistung damit verbunden war, rationale Antworten auf die Kant’schen Fragen zu finden: Was kann ich wissen? Was darf ich hoffen? Was soll ich tun?
Schillers Beiträge zu diesen kulturellen Leistungen sowie zur Suche nach – und zum Finden von – Antworten auf Fragen wie: Natur versus Kultur? Hat der Mensch eine Willensfreiheit, oder ist alles vorbestimmt? Bedeutung der Geschichte für das Heute? Was ist Moral? Was ist schön? werden von Safranski glänzend dargestellt und gewürdigt.
Erstaunlich an dieser Biografie ist allerdings auch, wie eurozentrisch Schiller und seine deutschen Zeitgenossen waren, oder wie eurozentrisch Safranski die Epoche behandelt. Der Eurozentrismus zeigt sich u.a. anderem daran, dass in der ganzen Biografie die bestehenden oder entstehenden Kolonialreiche oder etwa die amerikanische Revolution mit keinem einzigen Wort erwähnt werden; im Gegensatz dazu findet offenbar bei den damaligen Deutschen die Französische Revolution einen gewaltigen Widerhall, sowohl im schwärmerisch befürwortenden als auch skeptisch ablehnenden Sinn. Dabei beruht die Ablehnung grösstenteils auf dem Chaos, das der zunächst bejubelten Revolution folgt (Tenor: das ‚gewöhnliche’ Volk ist offensichtlich durch Demokratie überfordert und unfähig, selbst Herrschaft auszuüben); die Tatsache, dass eine vergleichbare Revolution (nach einem durchaus blutigen Sezessions- oder Befreiungskrieg gegen die ursprüngliche Kolonialmacht) auch geordnet verlaufen und auf Dauer ein neues Regierungssystem hervorbringen kann, wird ignoriert. Man fragt sich unwillkürlich, ob die heute noch bestehende europäische Überheblichkeit gegenüber Amerika eine logische Fortsetzung der Verkennung der seinerzeitigen Pionierleistung der amerikanischen Kolonien ist…
Beiläufig bekommen Leserin und Leser eine qualitativ hervorragende Einführung in alle wesentlichen Werke Schillers, Dramen, literarische Prosa, Sachtexte (Geschichte, Philosophie, Ästhetik, aktuelle Gesellschafts- und Politikanalyse) sowie schliesslich seine grossen Gedichte. Safranski schildert nicht nur den Inhalt der Werke, sondern er behandelt einfühlsam deren Entstehungsgeschichte und ordnet sie behutsam, literarisch exzellent und sehr plausibel in ihren zeitgeschichtlichen Kontext ein. Wer – wie ich –Schiller bisher im Wesentlichen aus den Dramen und Die Glocke kannte, kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus.
Für einen Schweizer besonders eindrücklich sind Safranskis Anmerkungen zu Wilhelm Tell, zur Demokratie, zum Spannungsfeld zwischen Revolution und Fortschritt, oder zur Freiheit (u.a. Seite 497). Safranski hat ein unschätzbar wertvolles Buch geschrieben, das sprachlich hervorragend und ausserdem gut zu lesen ist; es bietet weit mehr als die Biografie eines interessanten und für viele Zeitgenossen weitgehend unbekannten Menschen und einer noch unbekannteren Epoche.