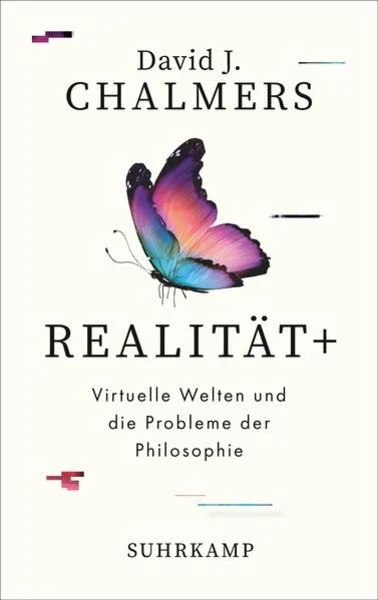
Der Klappentext preist an: «Der weltweit führende Philosoph David J. Chalmers begibt sich auf eine verblüffende Reise durch virtuelle Welten, um so die Natur der Realität wie auch unseren Platz darin zu erkunden.» (Verlag), oder «Chalmers zu lesen ist eine Freude: ein übersprudelnder Führer durch schwieriges Terrain, voller Anekdoten und Argumente, Witz und wilder Ideen» (The Times Literary Supplement»). Klappentext preist an: «Der weltweit führende Philosoph David J. Chalmers begibt sich auf eine verblüffende Reise durch virtuelle Welten, um so die Natur der Realität wie auch unseren Platz darin zu erkunden.»
Über den weltweit führenden Philosophen Chalmers informiert Wikipedia:
- *20.2.1966, Australien; Philosoph und Erkenntnistheoretiker (,cognitive scientist’); Professor für Philosophie und Neurowissenschaften an der New York University (NYU); zusammen mit Ned Block Direktor des NYU Center for Mind, Brain and Consciousness; Fellow der Australian Academy of the Humanities und Fellow der American Academy of Arts and Sciences
- Chalmers hat als erster das «hard problem of consciousness» formuliert, d.h. die Frage nach der Erklärung, warum und wie Menschen und andere Organismen (Frage BB: welche sind da wohl gemeint?) sogenannte ,Qualia’ (siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Qualia) haben, oder phänomenale Bewusstheit, oder subjektive Erfahrungen. Er kontrastiert das «hard problem» mit den «easy problems» (der Begriff soll ironisch gemeint sein, «tongue-in-cheek»), d.h. der Erklärung warum und wie physische Systeme den gesunden Menschen dazu befähigen, Information zu integrieren, Funktionen auszuüben wie Sehen, Zuhören, Sprechen (einschliesslich der Äusserung von Lauten, welche sich auf persönliche Situationen oder Überzeugungen beziehen), usw.; die ,easy problems’ lassen sich funktional erklären, d.h. deren Erklärung ist mechanistisch oder verhaltensgeprägt, da jedes physische System (mindestens im Prinzip) ausschliesslich durch Bezug auf «Struktur und Dynamik» erklärt werden kann, die dem Phänomen zugrunde liegen.
- In Fachkreisen ist das sogenannte ,hard problem» umstritten. Die Gegner dieses Konzepts nennen es das ,hard non-problem’.
Anmerkung BB: bei diesem Text geht es mir wie dem Mitarbeiter, der auf die Frage seines Chefs nach dem Erfolg einer angeordneten Weiterbildung antwortet: «I’m still confused, but on a higher level.»
Das Buch «Realität+» steht offenbar im Zusammenhang mit der Suche nach der Lösung des «hard problem».
Die Anpreisungen im Klappentext sind so überwältigend verführerisch, dass man wohl oder übel zugreifen MUSS.
Ich stehe aber mitten im Kapitel 8 ,wie der Ochs am Berg’ und kann nicht weiter. Das Buch führt wie angekündigt «durch schwieriges Terrain», aber es ist keineswegs «voller Anekdoten und Argumente, Witz und wilder Ideen»; es stinkt mit seinen abgehobenen Behauptungen zum Himmel und ist letztlich für Menschen. des frühen 21. Jahrhunderts ziemlich irrelevant. Deshalb beende ich meine Lektüre auf Seite 218; Begründung folgt.
Das Inhaltsverzeichnis steckt ein weites, spannendes und herausforderndes Problemfeld ab:
Einleitung: Streifzüge durch die Technikphilosophie
I. Virtuelle Welten
- Is this the real life?
2) Was ist die Simulationshypothese?
II. Wissen
3) Wissen wir etwas?
4) Können wir beweisen, dass es eine Aussenwelt gibt?
5) Ist es wahrscheinlich, dass wir uns in einer Simulation befinden?
III. Realität
6) Was ist Realität?
7) Ist Gott eine Hackerin in der nächsthöheren Welt?
8) Besteht das Universum aus Informationen?
9) Erschaffen Simulationen Its aus Bits?
IV. Reale virtuelle Realität
10. Erschaffen Virtual-Reality-Brillen Realität?
11. Sind Virtual-Reality-Geräte Illusionsmaschinen?
12. Führt Augmented Reality zu alternativen Tatsachen?
13. Können wir verhindern, von Deepfakes getäuscht zu werden?
V. Geist
14. Wie interagieren Geist und Körper in einer virtuellen Welt?
15. Kann es in einer digitalen Welt Bewusstsein geben?
16. Erweitert Augmented Reality den Geist?
VI. Werte
17. Lässt sich in einer virtuellen Welt ein gutes Leben führen?
18. Sind simulierte Leben von Bedeutung?
19. Wie sollten wir eine virtuelle Gesellschaft gestalten?
VII. Grundlagen
20. Was bedeuten unsere Wörter in virtuellen Welten?
21, Laufen Computerprogramme auch auf Staubwolken?
22. Ist die Realität eine mathematische Struktur?
23. Sind wir jenseits von Eden?
24. Sind wir Boltzmann-Geräte in einer Traumwelt?
Diese Inhaltsangabe legt kein Zeugnis für eine hochstrukturierte Behandlung des Themas ab; sie lässt vielmehr einen essayistischen und eklektischen Zugang zum Thema erwarten. Gleichzeitig erhebt Chalmers damit den mindestens oberflächlichen Eindruck, dass er die Grundthesen Kants zur Erkenntnistheorie, Ethik, Moral sowie zur philosophischen Anthropologie unter dem speziellen Blickwinkel der virtuellen Welten neu stellen und beantworten will.
Im Einleitungskapitel «Streifzüge durch die Technikphilosophie» ist folgende Passage bemerkenswert: «Die heutigen VR- und AR-Systeme sind noch sehr einfach, die Headsets und Brillen klobig und die visuelle Auflösung virtueller Gegenstände ist grobkörnig. Virtuelle Umgebungen sind zwar audiovisuell immersiv, doch man kann in ihnen keine virtuellen Objekte berühren, keine virtuellen Blumen riechen und keinen virtuellen Wein trinken. Diese virtuellen Grenzen (Anmerkung BB: diese Grenzen sind aber real; gemeint ist wohl ,die Grenzen der Technik der virtuellen Nachbildung der Realität’)werden wir jedoch überwinden. … Ich vermute, dass wir innerhalb eines Jahrhunderts über virtuelle Realitäten verfügen werden, die sich nicht mehr von der nichtvirtuellen Welt unterscheiden lassen. Möglicherweise werden wir uns über Gehirn-Computer-Schnittstellen an Geräte anschliessen und so unsere Augen, Ohren und andere Sinnesorgane umgehen. Diese Geräte werden extrem detaillierte Simulationen physischer Realitäten ermöglichen und physikalische Gesetze simulieren, die das Verhalten eines jeden Gegenstands innerhalb dieser Realitäten festlegen.»
Chalmers argumentiert im Folgenden meistens unter der stillen Annahme, dass seine Vorstellung einer perfekten Wiedergabe der realen durch eine virtuelle Welt bereits Wirklichkeit ist. Seine Feststellungen oder Hypothesen stehen somit alle unter dem Vorbehalt, dass das, was er an technischem Fortschritt innerhalb eines Jahrhunderts erwartet, bereits eingetroffen ist. Ob es sinnvoll ist, über eine Welt, die in vielleicht 100 Jahren vielleicht, wenn überhaupt je, erreicht wird, vielleicht so, wie sich das Chalmers vorstellt, vielleicht aber auch ganz anders, zu spekulieren, halte ich für sehr fraglich. Im gleichen Zeitraum werden andere, von der Technik der Virtualität völlig unabhängige gesellschaftliche, wirtschaftliche, politische und kulturelle Veränderungen erfolgen, die voraussichtlich grössere Bedeutung haben werden als die Folgen der Technik der Virtualität (nur ein Beispiel: Klimawandel).
Im Kapitel 1 «Is this the real life?» verwendet Chalmers erstmals den Begriff ,nichtvirtuelle Realität’. Für mich ist diese Wortwahl verräterisch, und zwar für eine sprachliche Irreführung; ich illustriere das am Beispiel der instrumentellen Zusammensetzung von Jazzbands. Vor rund 60-70 Jahren gehörte zu einer Jazzband normalerweise eine Gitarre. Dann kam die elektrische Version auf; diese wurde in der Bandbesetzung als ,elektrische Gitarre’ eingeführt. Eine Zeitlang koexistierten beide Instrumente gleichzeitig als Gitarre und elektrische Gitarre. Je populärer die elektrische Version wurde, desto häufiger wurde sie nur noch als Gitarre eingeführt; die elektrische Gitarre wird zum Normalfall, und die gute jahrhundertealte Gitarre wird zur ,akustischen Gitarre’ degradiert. Das folgt der Logik der Behauptung: «Die Wirklichkeit ist nur ein Spezialfall der Simulation» (Quelle unbekannt). Soweit sind wir im philosophischen Diskurs noch nicht ganz, und wohl noch weit entfernt von einem Konsens. Aber immerhin kommt die ,nichtvirtuelle Realität’ der ,akustische Gitarre’ schon sehr nahe: die Virtualität wird zum Normalfall und bald unter der Kurzformel ,Realität’ subsumiert; und die Wirklichkeit als der bisherige Normalfall wird zur ,nichtvirtuellen Realität’.
In Kapitel 2 «Was ist die Simulationshypothese?» ist nachzulesen (Seite 68) «Eine perfekte Simulation können wir als eine solche definieren, die die Welt, die sie simuliert, exakt widerspiegelt. Folgt die simulierte Welt strengen physikalischen Gesetzen, wird eine perfekte Simulation diese Gesetze exakt nachbilden und niemals von ihnen abweichen. … Zumindest unter der Annahme, dass ein simuliertes Gehirn das gleiche bewusste Erleben hat wie das Gehirn, das es simuliert, gibt es aus der Innenperspektive keine Möglichkeit, den Unterschied zwischen einem nichtsimulierten Universum und einer perfekten Simulation zu erkennen.»
Dazu zwei Bemerkungen: Erstens ist die Annahme, es könne so etwas wie eine perfekte Simulation überhaupt geben, sehr waghalsig. Sie erinnert an die Parabel von Umberto Eco, die poetisch und sarkastisch die Unmöglichkeit behandelt, eine Weltkarte im Massstab 1:1 herzustellen (siehe Einschub im Anschluss). Zweitens, falls so etwas wie eine ,perfekte Simulation’ je möglich wäre, wäre es eben völlig unsinnig, über den Unterschied zwischen einer perfekten Simulation der Welt und der dadurch simulierten realen Welt nachzudenken. Wenn zwei Dinge gleich sind, und das postuliert die ,perfekte Simulation’, dann sind sie eben gleich; und es ist irrelevant, in welcher der beiden Welten man sich gerade befindet.
Anmerkungen zu Ecos Weltkarte im Masstab 1:1:
Die Suche mit ChatGPT nach der Publikation zur Weltkarte im Massstab 1:1 ergibt: Umberto Eco beschreibt in seinem Buch «Die Suche nach der vollkommenen Sprache» (in der englischsprachigen Ausgabe «The Search for the Perfect Language») das Konzept der Schwierigkeit, eine Weltkarte im Maßstab 1:1 herzustellen, als eine Idee, die vom fiktiven Schriftsteller Luis Borges in seiner Erzählung «Del rigor en la ciencia» (Die Genauigkeit der Wissenschaft) vorgestellt wurde. In dieser Geschichte wird die Idee einer Karte diskutiert, die die gesamte Erde im exakten Maßstab 1:1 abbildet.
Eco interpretiert diese Idee als eine Metapher, um die Unmöglichkeit und Unpraktikabilität zu verdeutlichen, eine exakte Repräsentation der Realität zu schaffen. Eine Karte im Maßstab 1:1 wäre praktisch unhandlich und nutzlos, da sie selbst die kleinsten Details und Unregelmäßigkeiten der Welt wiedergeben würde. Dieses Konzept verdeutlicht die Schwierigkeiten, die mit dem Versuch verbunden sind, die Komplexität und Vielfalt der Realität in jeder Hinsicht genau abzubilden. Eco verwendet diese Metapher, um auf die Schwierigkeiten und Grenzen der menschlichen Repräsentation und Interpretation der Realität hinzuweisen.
Schussfolgerung BB: Wenn schon eine Weltkarte 1:1 so viele Probleme aufwirft, und falls überhaupt möglich, völlig unnütz wäre, wie schwierig – und unnütz — müsste dann die künstliche Abbildung der gesamten Welt sein? Das wäre ein Gedanke, der den Hohepriestern der Virtualität auch einmal kommen könnte.
Es wird nämlich immer bunter: Die Kapitelüberschriften zeigen, in welchen Sphären Chalmers herumturnt. Natürlich; ist die Erkenntnistheorie wichtig, sie stellt die grundlegenden Fragen nach dem, was wir wissen oder wissen können. Aber mir scheint, dass Chalmers dem, was Kant vor 200 Jahren dazu gesagt hat, nichts grundlegend Neues hinzufügt. Die Annahme, dass wir uns in einer sogenannt perfekten Simulation befinden könnten, in der wir zwischen Simulation und Realität nicht unterscheiden können, weil sich in einer ,perfekten’ Simulation alles gleich anfühlt wie in der realen physischen Welt, ändert an den erkenntnistheoretischen Aussagen nichts. Und Fragen wie ob es in einer von einem Hexenmeister oder Demiurgen ,perfekt simulierten’ Welt einen Gott gibt, sind schlicht und ergreifend dumm – und irrelevant. Natürlich ist es möglich, sogar ganz einfach, ein Konstrukt wie ,Gott’, das ohnehin nur in der menschlichen Vorstellungswelt existiert, auch in einer simulierten Welt, die ja per definitionem ebenfalls einer ,vorgestellten’ Wirklichkeit entspricht, abzubilden. Aber cui bono?
Für mich steht fest: Solange Menschen zwischen einer Simulation und dem, was wir im Allgemeinen für die Realität halten, hin und her wandern können, wissen sie jeweils ob sie sich hier oder dort befinden; dann befinden sie sich nicht in einer ,perfekt simulierten’ Welt. Und wenn es je eine Welt gibt, die so gut simuliert ist, dass kein Unterschied zwischen der realen, sinnlichen wahrnehm- und riechbaren und messbaren Welt besteht, die es ermöglicht, dass sich beliebig zahlreiche und über die ganze Welt verteilte Menschen miteinander unterhalten, Vereinbarungen treffen und einfordern können, dann wird eh alles wurscht!
Ausser der Frage: Wo sind dann all die Server und Datenbanken, die dafür erforderlich sind? Die Antwort wird dann wohl lauten: «Die sind auch simuliert.»