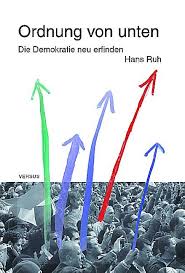
Ein sehr zwiespältiges und widersprüchliches Buch, das seinem Anspruch (gemäss Titel) in keiner Art und Weise gerecht wird. Vielleicht kann man das von einem (linken) Theologen auch nicht erwarten – auch wenn es enttäuscht, dass ein Theologe, der mit einem sehr hohen ethisch-moralischen Anspruch (er selbst klärt allerdings den Unterschied zwischen Moral und Ethik nicht, obwohl die beiden Begriffe sein Werk durchtriefen) antritt, in seinem eigenen Werk diesem Anspruch nicht gerecht wird.
Das Buch enthält eine Grundthese, einen vom Autor als ‚analytisch‘ bezeichneten Teil, den ich eher als ‚ideologisch‘ und ‚betroffenheitstriefend‘ bezeichne, und einen so genannten Lösungsteil (Teil 2, ‚Leuchttürme für eine andere Welt’).
Vorweg gilt festzuhalten, dass Ruhs Sicht sehr europazentrisch ist und keinerlei Versuche anstellt, andere Kulturkreise oder Gesellschaftssysteme vergleichshalber einzubeziehen. Für ihn besteht die Welt aus dem abendländischen Kulturkreis – basta!
Und in seiner abendländischen Sicht steht nochmals das Segment der ‚sozialen Marktwirtschaft’ im Zentrum. Das angelsächsische Wirtschaftsmodell oder etwa der französische Zentralismus spielen bei ihm keine Rolle, beziehungsweise sind a priori bereits Teil des Problems.
Ruhs Grundthese:
Es gibt gemäss Ruh eine ‚Ordnung des Seins’. Die Ordnung des Seins wird als gegeben vorausgesetzt. Leider finden sich im Buch von Ruh kaum Ansätze zur Klärung, jedenfalls keine schlüssigen Antworten auf Fragen wie: Was ist diese Ordnung des Seins konkret? Woher kommt sie, oder weshalb ist sie gegeben? Woher bezieht sie ihre Legitimität (eigentlich eine zentrale Frage, da sonst bei Ruh an alles und jedes der Anspruch der Legitimität gestellt wird)? Nach welchen Kriterien und Regeln wäre sie allenfalls weiter zu entwickeln?
Ruh behauptet, begründet das aber nicht (Seite 36), dass ‚jene Perioden und Institutionen der Menschheitsgeschichte, in denen die Bereiche Natur und Kultur, Materie und Geist, Wirtschaft und Ethik konstruktiv, kritisch und komplementär aufeinander bezogen waren, die gelungensten und glücklichsten Zeiten waren’. Offenbar ist die Ruh’sche Ordnung des Seins dann gegeben, wenn die Bereiche Natur und Kultur, Materie und Geist, Wirtschaft und Ethik konstruktiv, kritisch und komplementär aufeinander bezogen sind. Ruh übersieht oder ignoriert, jedenfalls geht er mit keinem Wort darauf ein, dass in dieser Aufeinanderbezogenheit eine Unmenge von Zielkonflikten stecken, über deren Auflösung oder Auflösungskriterien er natürlich auch nichts aussagt. Für Ruh sind Legitimität‘ und ‚Mass‘ zentrale Inhalte der Ordnung des Seins. Legitimität ist dann gegeben, wenn die Beziehung zur Ordnung des Seins, die Bindung an eine höhere Ordnung vorhanden ist (Seite 30). Er postuliert, dass menschliches Handeln nur dann gelingen kann, wenn die Menschen im Rahmen des ihnen vorgegebenen Masses agieren (Seite 36).
Er stellt aufgrund eines kurzen ideengeschichtlichen Rückblicks dann die Grundthese auf, dass die menschliche Gesellschaft den Bezug auf die Ordnung des Seins verloren hat, und dass dieser Bezugsverlust die eigentliche Ursache von Krisen sei.
Eine der perversesten Begründungen, warum der Bezug zur Ordnung des Seins verloren gegangen sein und die Masslosigkeit überhandgenommen haben soll, die mir je untergekommen ist, besteht nach Ruh (Seite 59) darin, dass mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und des Ostblocks der Systemwettbewerb zwischen westlichem Kapitalismus und kommunistischer Gesellschaftsordnung aufhörte. Dieser Wettbewerb soll auf den westlichen Kapitalismus eine disziplinierende Wirkung gehabt und einen Ansporn ausgeübt haben, gewisse soziale Bereiche ‚milder’ zu regeln. Ruh nennt als Beispiele Einkommen, Arbeitslosigkeit, Verhältnis der Geschlechter in der Arbeitswelt, soziale Sicherheit. Durch den Wegfall dieses Wettbewerbs «durfte die soziale Marktwirtschaft etwas unsozialer werden». Es ist geradezu empörend, eine Wettbewerbssituation zwischen Kapitalismus und Kommunismus konstruieren zu wollen. Wenn ein Wettbewerb stattgefunden hat, dann zwischen dem realen Kapitalismus und dem westlich idealisierten Wunschtraum der kommunistischen Heilslehre. Man hört direkt, wie die Krokodilstränen eines christlich geprägten Kommunitarismus über den Untergang des Kommunismus auf die ausgedörrte Erde des Kapitalismus kullern – schön nach dem Motto: die Ideale des Kommunismus wären ja schon erstrebenswert, leider wurde er in der Sowjetunion und in den Ostblockstaaten falsch umgesetzt – schade! Der Gerechtigkeit halber erwähne ich, dass Ruh zur Begründung dieser abstrusen Theorie völlig ideologiefreie Koryphäen wie Roger de Weck und Peer Steinbrück zitiert.
Der These, dass die Menschen den Bezug zur Ordnung des Seins verloren haben, kann man im Übrigen ohne Weiteres zustimmen, auch wenn zuerst geklärt werden müsste, was diese Ordnung des Seins konkret ist, woher sie kommt oder gegeben ist, woher sie ihre Legitimität bezieht, nach welchen Kriterien und Regeln sie allenfalls weiterentwickelt werden kann.
Analyse:
Ruh appliziert nun seine Grundthese plötzlich und ohne weitere Begründung ausschliesslich auf den Bereich Wirtschaft. Er behauptet, dass «die Wirtschaftskrise 2008/2009 eben auf dem Hintergrund einer mangelnden Bezogenheit der beiden Bereiche (Anmerkung BB: gemeint sind wohl mit ‚beiden Bereichen’ einerseits das menschliche Handeln, und anderseits geistig-moralische Bereich, auf den das Handeln bezogen sein sollte) zu deuten ist». Er sieht im Verlust der Ordnung des Seins die eigentliche Ursache von Krisen, insbesondere jedoch der 2008/2009 ausgebrochenen Finanz- und Wirtschaftskrise. Hier stecken meines Erachtens zwei Kardinalfehler:
- Ruh behauptet (Seite 39), dass in der Periode vor der Krise 2008/2009 «wirtschaftliches Handeln über weite Strecken eingebunden war in eine werthaltige Ordnung des Seins». Es ist aber offensichtlich, dass der Prozess dieses Bezugsverlusts viel früher begonnen hat. Ruh selbst geht in seinen ideengeschichtlichen Betrachtungen auch kurz darauf ein. Er weist darauf hin, dass der Verlust der Bezogenheit auf die Ordnung des Seins mit der Aufklärung verbunden war. Er hält auch fest, dass der mit der Aufklärung verbundene Freiheitsgewinn auch mit der Aufgabe verbunden ist, dass der Mensch – jeder für sich – ‚seine‘ eigene Ordnung des Seins selbst suchen und festlegen muss.
- Offensichtlich beschreibt die Ruh’sche These ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Ruh reduziert und appliziert diese These in seinen weiteren Ausführungen jedoch ausschliesslich bis primär auf die Wirtschaft.
Aber: die Wirtschaft ist ja wohl ein Teil genau dieser Gesellschaft, die ihre Ordnung des Seins verloren hat. Deshalb betrifft dieser Verlust nicht nur die Wirtschaft, sondern die gesamte Gesellschaft, also auch Politik, Kultur, Religion, Zivilgesellschaft (ein Konstrukt, das in den Ruh’schen Visionen zur Lösung eine zentrale Rolle spielen wird).
Es will mir nicht einleuchten, dass eine Gesellschaft, die wegen des Verlusts der Ordnung des Seins einen unendlich grossen Problemhaufen bekommen hat, ausgerechnet die Probleme der Wirtschaft lösen können sollte.
Noch weniger plausibel ist, dass die gesamtgesellschaftlichen Aspekte des Bezugsverlusts auf die Ordnung des Seins, deren Lösung der heutigen Gesellschaft nicht gelingen will, durch die gleiche Gesellschaft ‚von unten’ her gelingen können soll.
Unwillkürlich erinnert Ruh an den Baron von Münchhausen, der sich selbst am eigenen Schopf aus dem Sumpf zog.
Im Übrigen ist die Ruh’sche Analyse – wie bereits erwähnt – ein Sammelsurium von bestens bekannten Kritiken am kapitalistischen Wirtschaftssystem und verdient die Qualifikation ‚Analyse’ kaum. Sie steckt auch voll von sachlichen Fehlern und unbewiesenen Behauptungen. Er redet beispielsweise immer nur von Verlieren und praktisch nie von der zahlenmässig wohl um ein Vielfaches grösseren Menge von Gewinnern. Seine ganze Argumentation beruht auf der impliziten Behauptung, dass es den Menschen ‚früher’ – also vor dem Kapitalismus, d.h. vor dem Bezugsverlust zur Ordnung des Seins – besser gegangen wäre als heute.
Lösungsteil:
Hier beginnt Ruh seine ‚science‘ oder ‚social fiction‘. Er bewegt sich zwischen nostalgischen Rufen ‚zurück in die Höhlen‘ (oder auf die Bäume) und der Utopie, dass die Menschen mit dem richtigen Appell plötzlich edel und gut werden. Er stellt einerseits zwar fest, dass die Probleme zu komplex sind, um eine ganzheitliche Lösung finden zu können und plädiert für fragmentarische Ansätze. Gleichzeitig postuliert er aber neue Wertesysteme, die universalisierbar sein müssen. Er fordert, auf Polemik zu verzichten, stellt aber die Wirtschaft als inhärent kriminell dar (Seite 75). Er verlangt einen legitimierten Umgang mit der Natur, macht es sich aber auch so einfach, dass er alles, was durch Gesetze nicht erfasst oder reguliert ist, als frei von Legitimität klassiert. Die Idee, dass etwas, was gesetzlich nicht verboten ist, dem Ermessen und der Freiheit der Bürgerinnen und Bürger überlassen sein könnte, ist offenbar bereits ein Sakrileg, jedenfalls nicht legitim.
Wie ein roter Faden zieht sich durch das Buch die Überzeugung, dass es eine Kategorie von Menschen gibt (zu denen der Autor natürlich gehört), die ex cathedra wissen, was für die Menschheit gut ist, und was nicht, also, was der Ordnung des Seins entspricht, und was nicht. Alles andere ist nicht legitimiert, weil es gegen die Ordnung des Seins verstösst.
Der Ideenkatalog (eher ein Schlagwort-Sammelsurium) umfasst natürlich die bestens bekannte Litanei der Vereinten Nationen der Gutmenschen; Auswahl: alternative Geldsysteme (inklusive Tauschhandel), existenzsichernder Grundlohn, Subsistenzwirtschaft.
Und das Allheilmittel ist die Zivilgesellschaft, die von einem neuen Menschen gebildet wird und es fertigbringt, eine neue – natürlich gute – Ordnung des Seins herzustellen und ohne Konflikt mit dem Freiheitsbedürfnis der Menschen durchzusetzen.
Die zugrundeliegende Logik ist himmelschreiend einleuchtend: Angesichts der usurpierten Vorherrschaft des Wirtschaftlichen und Globalen versagt die nationale und internationale Politik bei der Lösung der grossen Gestaltungs- und Zukunftsprobleme der Menschheit.
Also soll das die Zivilgesellschaft richten.
Dass die Mitglieder der Zivilgesellschaft ebenfalls zur versagenden Gesellschaft gehören (und im Einzelfall durchaus aktiv in der versagenden Politik mitmischen), ist irrelevant.
Dass die Zivilgesellschaft aus einem chaotischen Gemenge von Gruppierungen besteht, die weder Regeln zur gegenseitigen Koordination haben noch akzeptieren, die völlig heterogene und teilweise gegensätzliche Ziele verfolgen, stört auch nicht.
Zu schön, um wahr zu sein.Nicht lesenswert, ausser um den Adrenalinspiegel zu erhöhen…