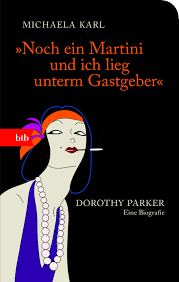
Klappentext:
«Michaela Karl porträtiert in dieser ersten deutschsprachigen Biografie das unkonventionelle Leben der Dorothy Parker, und mit ihr die Ikone einer legendären Epoche… In den Roaring Twenties war Dorothy Parker die Königin von New York. Ihre Gedichte und Geschichten erzählen von zerplatzten Träumen, unerfüllten Sehnsüchten und dem Warten auf das Klingeln des Telefons. Doch hinter Zynismus und Spott verbirgt sich eine Frau, die stark und verletzlich, mitfühlend und grausam war und sich immer in die falschen Männer verliebte.»
Alles Quatsch!
Ein totaler Reinfall: Ich schmeisse das Buch, bevor ich die Mitte des Texts erreiche, weg. Die Hoffnung, wenigstens etwas Gescheites über das New York der 20-er Jahre des 20. Jahrhunderts und über das Hotel Algonquin (angeblich das intellektuelle Zentrum New Yorks – oder das Zentrum eines Clans von versoffenen Intellektuellen, die sich für die repräsentativen Intellektuellen der Stadt halten?) zu erfahren, wird vollständig enttäuscht. Die Biografie ist nichts anderes als eine Aufzählung von hirnlosen Männergeschichten und noch hirnloseren Saufgelagen und Missbrauch von Medikamenten. Wenn die Protagonisten dieser Biografie wirklich «die Intellektuellen des New York der 20-er Jahre» waren, dann zeichneten sich diese Intellektuellen aus durch Müssiggang, Parasitentum, ab und zu einer gekonnt formulierten Bosheit, die jedoch von nichts anderem als Neid, Missgunst oder Enttäuschung über das eigene verpfuschte Leben genährt und getragen wurde, oder durch absolute Perspektiv- und Hoffnungslosigkeit.
Frau Karl versteht von Amerika überhaupt nichts:
- Erstens stellt sie die ‚Round Table‘ vom Hotel Algonquin so dar, als ob sie das alleinige Zentrum der intellektuellen amerikanischen Gesellschaft gewesen sei. Dabei gab es auch in den 20-er Jahren des letzten Jahrhunderts sowohl in New York als auch in anderen Städten und Regionen der USA Individuen und Gruppen, die der versoffenen «Round Table» intellektuell und kulturell mindestens ebenbürtig waren.
- Zweitens positioniert sie Dorothy Parker (Seite 15) als ‚die typische Amerikanerin‘. Wörtlich schreibt sie: «Sie ist der charakteristische Mix aus den Emigranten der Neuen Welt – die typische Amerikanerin». Das ist doppelter Unsinn: denn zum Ersten ist Parker (von Geburt eine Rothschild, Grosseltern väterlicherseits jüdische Emigranten aus Deutschland, mütterlicherseits Protestanten aus Schottland) keine Emigrantin der Neuen Welt, sondern eine Seconda von Immigranten aus der Alten Welt; zum Zweiten sind die für Amerika typischen Immigranten aus der Alten Welt (die sie wohl meint) bereits im 17. Jahrhundert nach Amerika gekommen, nicht erst im 19. Jahrhundert, und noch aus ganz anderen Gründen. Zwischen den Emigranten aus der Alten Welt, die Amerika aus der Kolonialherrschaft befreiten und als unabhängige Nation gründeten und begründeten, und den Immigranten des 19. Jahrhunderts bestehen Abgründe von Unterschieden. Dass Frau Karl den Typus ‚Parker‘ als für Amerika typisch bezeichnet, zeigt, dass sie keine Ahnung davon hat, dass die amerikanische Gesellschaft kein Monolith ist, sondern ein Konglomerat, in dem der Typus ‚Parker‘ durchaus vorkommt, aber keinesfalls für Amerika insgesamt typisch ist.
Offenbar schwimmt Frau Karl im Mainstream des heutigen europäisch-dünkelhaften Antiamerikanismus, gemäss dem eine demokratische Haltung (à la Obama, Clinton, etc.), die selbstverständlich von allen (selbst ernannten) Intellektuellen eingenommen wird, gut und typisch amerikanisch ist, und alles, was nach ‚Bush‘ riecht, unamerikanisch, rückständig und bigott ist.
Zweite Hälfte: nur noch durchgeblättert – aber da wird’s richtig peinlich.
Dorothy Parker (Dottie) stösst plötzlich auf die Lösung ihres Lebenssinn-Problems: sie wird Gutmensch. Mit schlafwandlerischer Treffsicherheit wird sie glühende Anhängerin der spanischen Republik und engagiert sich (man muss ja wohl, da auch Hemingway und Konsorten dabei sind) – mindestens verbal, emotional und mit Geldsammlungen – für die Sache der Republik. Nachdem sie sich ihr ganzes bisheriges Leben lang nie nur im Entferntesten mit Politik befasst hat, ist für sie über jeden Zweifel erhaben: Republik ist gut, Franco ist schlecht; und als Intellektuelle steht sie natürlich auf der Seite der und des Guten. Ein amerikanischer Gesinnungsgenosse, der in den dreissiger Jahren Stalins Russland besucht und die Erkenntnis zurückbringt: «Ich habe die Zukunft gesehen, und sie funktioniert.» überzeugt sie sofort, dass sie auch den Kommunismus gut finden und unterstützen muss. Sie unterzeichnet Manifeste, die Stalins Gulags und Massenhinrichtungen rechtfertigen. Alles nach der Logik: Was gut ist, bestimme ich; dass eine junge (40-jährige) Frau im 21. Jahrhundert eine Persönlichkeit wie Dorothy Parker als starke und emanzipierte Frau auf das Podest der Modernität stellt, stellt der intellektuellen Potenz der Emanzipation ein sehr schlechtes Zeugnis aus. Alles nach der Logik: Was gut ist, bestimme ich; und massgebend für mich ist dabei nur meine Betroffenheit, nicht etwa intensive intellektuelle Faktensuche, Analyse und Auseinandersetzung.
Zum Kotzen – pfui!