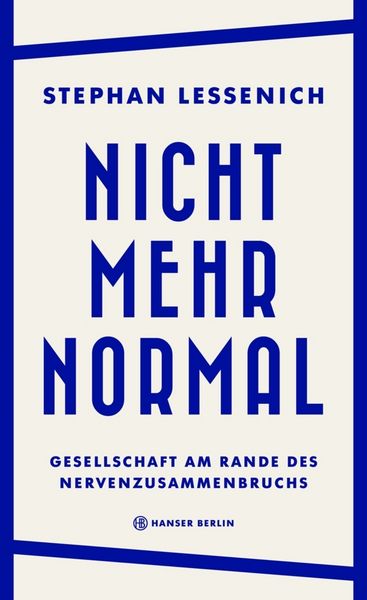
Das ist ein sehr lesenswertes, interessantes Buch, das den Versuch unternimmt, zunächst den Zustand der ,Normalität’ theoretisch zu erfassen, und dann das, was die Gesellschaft an den Rand des Nervenzusammenbruchs bringt, anhand von offensichtlich und aktuell relevanten Verlusten dieser Normalität analysiert.
Der Autor, Stephan Lessenich, ist Professor für Gesellschaftstheorie und Sozialforschung an der Goethe-Universität Frankfurt und Direktor des Instituts für Sozialforschung. Also muss man sich als Leser oder Leserin überwinden und ein gerütteltes Mass an Soziologenjargon ertragen – aber es könnte schlimmer sein. Und natürlich ist die Perspektive der gesamten Untersuchung strikt auf Deutschland bezogen.
Für Lessenich hat der Begriff ,Normalität’ folgende zwei Dimensionen:
- normativ: das ,Normale’ ist «das, was von einem bestehenden Regelsystem als Richtschnur des sozialen Handelns vorgegeben», mithin als Norm gesetzt wird» (Seite 18)
- empirisch: «,normal’ ist zugleich aber auch das, was sich in einem sozialen Zusammenhang faktisch als regelmässige Gestalt des Handelns etabliert hat, sei es nun aufgrund der Wirksamkeit besagten Regelsystems oder aber gerade auch in Opposition zu ihm».
Das normativ Normale bestimmt, was die Menschen tun sollten, und das empirisch Normale besagt, was die Menschen tatsächlich tun.
Lessenich betont aber auch, dass diese Unterscheidung nicht so zu verstehen ist, dass eine Norm in Ewigkeit so zu bestehen hat»; es ist nämlich völlig ,normal’, dass «das von den Akteuren regelmässig an den Tag gelegte und also in diesem empirischen Sinne normale Handeln an der – und sei es per Gesetz verordneten — Norm vorbeigeht oder ihr sogar zuwiderläuft. In diesem Fall hat die Norm, oder genauer die normgebende Instanz, ein Problem, nämlich das ihres verbreitet missachteten Geltungsanspruchs; ein Problem, auf das entweder mit einer verschärften Kontrolle der Regelbefolgung oder mit einer Anpassung der Regel an das tatsächliche Handeln reagiert werden muss. Ob nun aber durch Rigidität oder Flexibilität: So oder so gilt es, die normative und die empirische Dimension des Normalen in Übereinstimmung zu bringen, um gesellschaftliche Stabilität und soziale Ordnung (wieder) herzustellen.» (Seite 19)
Die von Lessenich untersuchten Bereiche, in denen uns – beispielhaft – die Normalität abhandengekommen ist, sind:
- Finanzkrise (2007): Normalität ist hier die Tatsache, dass die moderne Gesellschaft als geldvermittelte Tauschwirtschaft funktioniert, dass Geld das gesamte Alltagsleben, praktisch sämtliche Lebensvollzüge durchdringt und das Schmiermittel des gesellschaftlichen Verkehrs ist. (Seite 38) Das Hauptmerkmal der Finanzkrise sieht Lessenich darin, dass sie diese Normalitätsannahme schockartig infragestellte. Ein Kollaps des Geldkreislaufs geriet plötzlich auch für «Otto Normalkontobesitzer» in den Bereich des Möglichen.
- Deutschland als Einwanderungsgesellschaft: Für Lessenich bewirkte die Einwanderungswelle von 2015 einen bleibenden Normalitätsbruch, indem sie den Menschen einen migrationspolitischen Kontrollverlust offenbarte – sie waren nicht mehr Herr im eigenen Haus.
- Fossile Mentalitäten: Lessenich zeigt, dass bis weit in die Gegenwart hinein Normalität für die Menschen bedeutete, die enge Koppelung von mehr Wohlstand und mehr Ressourcenverbrauch (vor allem fossile Ressourcen) sei gewissermassen naturgesetzlich garantiert. Die Infragestellung dieser Normalität durch Klimakrise und Abhängigkeit von diktatorischen Regimen ist noch nicht richtig verdaut.
- Identitätspolitik: Im Vergleich zu den anderen untersuchten Bereichen sind Lessenichs Betrachtungen zur «Angst vor der ,Identitätspolitik’» schwächer. Er übernimmt meines Erachtens den Anspruch von Minoritäten auf Teilhabe an der Gesellschaft zu unkritisch, weil er nicht zwischen einem mit irgendeiner Identität begründeten Anspruch auf Teilhabe an sich und der mit der argumentativen inhaltlichen Begründung eines Anspruchs unterscheidet; anders gesagt: ein Transmensch hat nicht Anspruch auf Teilhabe, weil er ein Transmensch ist, sondern weil er bessere Ideen hat. Oder frei nach Odo Marquard: Nicht der Verteidiger eines Istzustands musst sich rechtfertigen, sondern derjenige, der ihn ändern will. Ausserdem hat die Identitätspolitik einen unvergleichlich tieferen Stellenwert als die Themen Finanzkrise, Einwanderungsproblematik oder fossile Mentalitäten. Lessenich befriedigt hier einen Modetrend und übersieht, dass die ganze Identitätsproblematik in erster Linie eine Selbstbefriedigungsorgie der akademischen Eliten ist, und keineswegs ein Problem, das die breite Gesellschaft beschäftigt oder gar belastet.
Die Lektüre des Buchs von Lessenich ist – trotz einer wohl der Soziologenzunft geschuldeten Redundanz – durchaus lohnend; er eröffnet interessante Blickwinkel auf brennende Aspekte des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Allerdings könnte er meines Erachtens gewisse Argumente und Sichtweisen etwas einfacher oder ,volksnäher’ darstellen; Beispiele:
- (Empirische) Normalität ist etwas ganz Gewöhnliches, nämlich das, was wir gewohnt sind, das, was mehrheitlich vorkommt; auch Besitzstände sind – für die meisten Menschen jedenfalls – etwas Normales. Niemand verliert gerne, was er oder sie schon hat, vielleicht schon lange. Menschen sind es gewohnt, dass das ,Normale‘ so bleibt, wie es war. Das Nicht-Normale ist intuitiv nicht gleichberechtigt oder gleichwertig, eben weil es die Ausnahme ist. Das alles ist menschlich, und meistens auch gut so.
- Der Verlust der (normativen) Normalität, und die Probleme, welche unsere Gesellschaft damit hat, sind kein modernes Phänomen; er ist nicht erst mit der Finanzkrise, mit der Einwanderungsflut von 2015, mit Corona oder dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine entstanden. Die Gesellschaften sind immer wieder mit gewaltigen Normalitätsbrüchen fertig geworden (Beispiele: Eiszeiten; Völkerwanderung; 30-jähriger Krieg).
Ich vermisse an Lessenichs Ausführungen allerdings folgende Gedanken:
- Das grösste Problem, das unsere Gesellschaft mit Normalitätsbrüchen hat, ist die meist unausgesprochene oder gar unbewusste Grundannahme, dass ein bestimmter Zustand der Welt oder der Gesellschaft, der uns gefällt oder als erstrebenswert erscheint, sozusagen eingefroren und auf ewig erhalten werden kann. Das bedeutet in letzter Konsequenz, dass die Spezies Mensch ewig leben soll. Vielleicht finden wir erst dann einen gelassenen Umgang mit Normalitätsbrüchen, wenn wir akzeptieren, dass unsere Spezies, wie alle anderen auch, eine zeitlich endliche Perspektive hat, dass auch wir dem evolutionären Zyklus von Werden, Sein, Vergehen, ausgesetzt sind, und dass wir das Ende unserer Spezies nicht verhindern, sondern bestenfalls menschlich gestalten können.
Eine meines Erachtens wichtige Ursache des drohenden Nervenzusammenbruchs der Gesellschaft beruht nicht wirklich auf Normalitätsbrüchen an sich, sondern auf der Tatsache, dass dem ,dummen Volk’ durch die herrschenden Eliten (Regierung, politische Parteien, Gewerkschaften, Medien) seit Jahrzehnten unerbittlich eingetrichtert wird, die Welt sei schon in Ordnung, weil sie wüssten, wie das geht, und insbesondere, dass sie, wenn man sie nur machen liesse, fähig seien, Unwuchten der Wirklichkeit zu glätten und letztlich allen Menschen ein anstrengungsloses, verantwortungsfreies, unbesorgtes und gemütliches Leben zu ermöglichen. Implizit versprechen diese ,Rattenfänger’ den Menschen einen Zustand der Welt, in der alles so bleibt wie es nie war, in der es allen gut geht (was immer sie sich darunter vorstellen mögen), in der alle Besitzstände garantiert sind, und in der man sich nicht mehr anstrengen muss, weil im Notfall immer jemand da ist (vorzugsweise der allmächtige Staat), der alle Hindernisse aus dem Weg räumt, und der die Menschen von der Verantwortung für sich selbst dispensiert
Das alles erzeugt, wie der stete Tropfen, der den Stein höhlt, eine Erwartungshaltung, die natürlich immer wieder enttäuscht wird. Es wäre an den herrschenden Eliten, dem Volk immer wieder zu sagen, dass unser Leben auf Erden meistens mühselig und anstrengend ist, dass das Prinzip gilt «Vo nüüd chonnt nüüd!», dass es keine stabile Ordnung gibt oder geben kann, und dass letztlich jeder Einzelne ,seines Glückes Schmied’ ist, und dass das Leben überhaupt eine Lotterie ist, die ihre Gewinne nicht nach Verdienst und Leistung verteilt, sondern mit dem blinden Los.