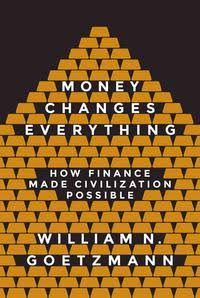
William N. Goetzmann ist auf dem Gebiet der Finanztheorie eine Kapazität; er ist Professor für ,Finance and Management‘ und Direktor des ‚International Center for Finance‘ an der Yale School of Management. Wie sich das für einen Träger solcher Ämter gehört, hat er bereits zahlreiche Bücher zum Thema veröffentlicht (siehe Klappentext oder Wikipedia).
Das vorliegende Buch, ein Wälzer von knapp 600 Seiten, behandelt ein Thema, auf das man erst kommen muss, nämlich den Zusammenhang zwischen der Geschichte oder Entwicklung von Zivilisation und ‚finance‘. Der englische Begriff ‚finance‘ lässt sich kaum griffig ins Deutsche übersetzen. Goetzmann versteht darunter sowohl alles, was mit Finanzen zu tun hat, letztlich also die gesamte Wirtschaftstätigkeit (sowohl die Produzenten- als auch die Konsumentenseite sowie die zugehörige Logistik) und auch die Gesamtheit der zugrundeliegenden Theorien. Da Begriffe wie ‚Wirtschaftspraxis und -wissenschaft und Finanzgeschäft und -theorie’ zu sperrig sind und ausserdem inadäquat, verwende ich im Zusammenhang mit diesem Buch der Einfachheit zuliebe den englischen Begriff ‚finance’.
Goetzmann zeigt anhand unzähliger, sehr lesbar beschriebener Beispiele, dass die Entwicklung von ‚finance‘ und Zivilisation synchron vor sich ging, oder dass Fortschritte in der Zivilisation (Goetzmann versteht unter Fortschritt ausschliesslich wohlstandsmehrende Entwicklungen) nur möglich wurden, wenn zuvor die einschlägigen Instrumente aus der ‚finance‘ verfügbar waren. Diese Kausalität wird im Buch nicht schlüssig bewiesen; dies wäre auch schwierig und liefe darauf hinaus, zu beweisen, ob das Huhn vor dem Ei da war oder umgekehrt. Meines Erachtens ist dies aber gar nicht notwendig — es genügt festzustellen, dass die Entwicklung ‚Hand-in-Hand‘ verlief.
Die Perspektive von Goetzmann ist global, also nicht europazentriert. Abgesehen davon, dass er mit der rund 5’000 Jahre alten Zivilisation von Mesopotamien beginnt, widmet er einen umfangreichen Teil seines Werks der erstaunlichen Entwicklung und Bedeutung von ‚finance‘ in China. Er setzt sich dabei auch mit der Frage auseinander, warum China, das in mancher Hinsicht im Bereich der ‚finance‘ Europa meilenweit voraus war, im Verlauf der Neuzeit nicht nur diesen Vorsprung verlor, sondern gegenüber Europa in grossen Rückstand geriet. Seine wesentlichen Argumente sind: Zentralisierte homogene Führung in China versus Konkurrenz zwischen zahlreichen kleinen Staatengebilden in Europa (gewissermassen: ‚top-down‘-China steht bezüglich Kreativität und Innovationskraft gegen ‚bottom-up‘-Europa im Nachteil); dank Kreativitätsvorsprung konnte sich in Europa das wissenschaftlich begründete Denken durchsetzen und Lösungen hervorbringen, die im hierarchisch-zentral geführten China keine Chancen hatten.
Für mich ist der wichtigste Erkenntnisgewinn, den ich aus der Goetzmann-Lektüre ziehe, die Erkenntnis, dass wesentliche Elemente der modernen Wirtschafts- und Finanztheorie schon in den frühesten Phasen der ‚rekonstruierbaren‘ (dank dem Vorliegen schriftlicher Zeugnisse) Menschheitsgeschichte erfunden und praktiziert wurden. Goetzmann ist der erste, der mir zeigt und einleuchtend begründet, dass eine Entwicklung
- von einzelnen isolierten ersten Clans der Gattung ‚homo sapiens’, die völlig autark, subsistent und nomadisch vom Jagen und Sammeln lebten, zu Clans, die irgendwann sesshaft und agrarisch wurden und mit anderen Clans Tauschhandel betrieben,
- die sich schliesslich in grösseren Siedlungen und schon vor 5’000 Jahren in Städten mit mehreren 100’000 Einwohnern konzentrierten und auf eine filigrane Arbeitsteilung und damit verbundene komplexe Transaktionsnetze angewiesen waren,
- die mit anderen Städten oder Reichen über grosse Distanzen Handel trieben und dafür anspruchsvolle logistische Operationen (Zahlungssysteme, Transport) beherrschen mussten,
- die Kontinent-übergreifende Imperien bildeten und militärisch-administrativ beherrschten,
gar nicht möglich gewesen wären ohne geeignete Finanzinstrumente und -theorien.
Goetzmann illustriert seine Theorie des Zusammenhangs zwischen Zivilisation und ‚finance‘ mit plastisch und gut lesbaren Beispielen aus der Geschichte, die — aus verständlichen Gründen — mit dem ersten Auftauchen der ‚Schriftlichkeit‘ beginnt, d.h. mit dem Auftauchen der Keilschrift im heutigen Mesopotamien vor rund 5‘000 Jahren. Als Leser kommt man immer wieder ins Staunen, wenn man erfährt und verinnerlicht, wie lange gewisse finanztheoretische Errungenschaften, die man spontan für sehr jung und modern hält schon bestehen (Beispiele: Bedeutung des Rechtssystems; Wert der Zeit oder Unterschied zwischen ‚present‘ und ‚future‘ value; Zinseszins; Hypothek, Buchgeld, Risikoberechnung, Wahrscheinlichkeitstheorie; Gesetz der grossen Zahl; statistische Betrachtungen; Finanzinstrumente wie Aktien, Obligationen; Gesellschaftsrecht).
Ich bin immer wieder dankbar dafür, in meiner Jugend mit dem humanistischen Gymnasium eine hervorragende Grundlage für eine breite Allgemeinbildung erhalten zu haben. Nach der Lektüre des Goetzmann-Buchs muss ich allerdings feststellen, dass in dieser Ausbildung der Zusammenhang zwischen Zivilisation und ‚finance‘ vollständig ignoriert wurde. Wir lernten zwar wunderschöne literarische Leistungen der Griechen und Römer kennen oder den Unterschied zwischen ionischen und dorischen Säulen oder zwischen Hexametern und Jamben; uns wurde jedoch vollständig vorenthalten, uns mit der Frage auseinanderzusetzen, wie denn ein Reich wie das römische Imperium technisch funktionieren konnte, das sich von der iberischen Halbinsel bis zum Schwarzen Meer erstreckte. In der ganzen klassischen Ausbildung spielten die Leistungen der ‚alten‘ Römer auf den Gebieten Handel, Warenlogistik, Recht und insbesondere Gesellschaftsrecht (z.B. Konzept der Trennung von Besitz und Führung, Anwendung des Prinzips der ‚beschränkten‘ Haftung) oder Militär keine Rolle – sie waren, obwohl wesentliche Voraussetzung für die zivilisatorischen Leistungen oder die Lebensfähigkeit des römischen Reichs und damit der römischen Kultur, schlicht und ergreifend nicht vorhanden.
Ich wage hier die Vermutung, dass die völlige Ignoranz für ‚finance‘ bei den Humanisten wohl die Hauptursache dafür ist, dass auch heute noch die Geisteswissenschaften und insbesondere die Geisteswissenschaftler eine ausgesprochen gestörte oder gar feindselige und verachtende Haltung gegenüber allem haben, was mit Geschäft, Geld oder — horribile dictu — gar Banken zu tun hat.
Dieses Buch muss man lesen. Das muss nicht zwingend an einem Stück erfolgen; die Lektüre lässt sich sehr gut in Intervallen bewältigen. Die einzelnen Kapitel sind in sich geschlossene Einheiten und lassen sich gut mit grösseren Pausen abgrenzen. Es empfiehlt sich jedoch, die einzelnen der 29 Kapitel nicht auseinander zu reissen. Die Reihenfolge der Kapitel ist nicht zwingend; aber da Goetzmann dem Ganzen eine inhaltliche, nicht zwingend chronologische, Struktur und Logik unterlegt, ist die Lektüre von vorn nach hinten angezeigt. Goetzmann verwendet kaum Querverweise, die ein lineares Lesen erzwingen würden; im Gegenteil: sein Text ist hervorragend organisiert, indem er in jedem Kapitel zuerst sagt, was kommt, und am Schluss zusammenfasst, was er gesagt hat; es ist eine ideale Umsetzung des Rezepts „Tell’em what you are going to tell’em; tell’em; tell’em what you told‘em!“.