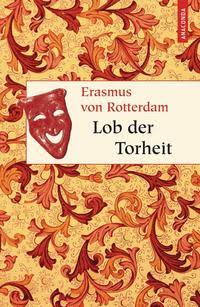
In diesem 1508 publizierten Werk – Pamphlet – brilliert Erasmus in Ironie und Sarkasmus. Er nimmt so ungefähr alles auf die Schippe, was damals als hoch und heilig galt. Um sich vor dem Vorwurf der Gotteslästerung zu schützen, schlüpft er in die Rolle der Göttin der Torheit (griechisch ‚Moria’), die sich einer Rede ihren Mitgöttern und Mitgöttinen die allumfassende Rolle der Torheit bei der Gestaltung eines gelingenden Lebens zu erläutern. Gemäss Klappentext wurde es das berühmteste Buch von Erasmus; es soll im 16. Jahrhundert eines der einflussreichsten Pamphlete gewesen sein, das dem Humanismus und der Reformation den Weg bereitete.
Das Buch liest sich stellenweise leicht und höchst amüsant; Erasmus schildert Züge der Torheit, die nach wie vor hochaktuell sind und erinnert mit seinen plastischen und träfen Schilderungen immer wieder an lebende Persönlichkeiten aus Politik- oder Kulturbetrieb, und natürlich auch an eigene Schwächen und Narrheiten.
Insgesamt allerdings ist es schwere Kost, weil die Rolle der Göttin der Torheit für Erasmus natürlich auch eine Gelegenheit ist, mit seiner intimen Kenntnis der griechischen und römischen Antike zu brillieren. Die ständige Anrede von oder Bezugnahme auf antike Gottheiten oder Theorien ist ermüdend. Das Buch eignet sich deshalb hervorragend als Nachttischlektüre, in der man immer wieder einige beliebig aufgeschlagene Passagen lesen und geniessen kann.
Als Kostprobe dient ein Auszug, welcher ungefähr Seiten 41-44 aus der Buchausgabe Fischerklassik (Taschenbuch, erste Auflage 2009) entspricht.
Textbeispiel, zitiert aus wmelchior.com, ‚texte aus philosophie und wissenschaft’, Webseite 8
Ihr seht also wohl, was einträte, wenn alle Menschen weise wären: ein neuer Lehm und eine neue prometheische Töpferhand wäre dann bald nötig. Ich aber reiche meine helfende Hand in solcher Drangsal mit Unwissenheit, Unbedachtsamkeit, manchmal mit Vergesslichkeit gegenüber üblen Lagen, dann wieder mit Hoffnung auf eine glückliche Wendung und versüsse bisweilen ein wenig mit Vergnügungen. So kommt es, dass die meisten selbst dann nicht gern vom Leben lassen, wenn die Parzen den Lebensfaden zu Ende gesponnen haben und das Leben selbst sie schon längst verlassen hat. Je weniger Grund zu weiterem Verweilen im Leben ist, um so mehr Freude macht das Leben. Es kann so gar keine Rede davon sein, dass sie von Lebensüberdruss gepackt würden. Mir allein ist es doch zuzuschreiben, dass ihr immer wieder Männer im Alter eines Nestor seht, die kaum noch Ähnlichkeit mit einem Menschen haben, lallend, blöde, zahnlos, weiß, kahl oder — um sie mehr mit den Worten des Aristophanes zu beschreiben — ungepflegt, krumm, trübselig, runzlig, glatzköpfig, ohne Gebiss und ohne Geschlechtstrieb, die aber doch so am Leben hängen und sich so jugendlich gebärden, dass der eine sein Haar färben lässt, der andere seine Glatze unter einer Perücke birgt, der dritte ein falsches Gebiss gebraucht und wieder ein anderer sich in ein Mädchen verliebt, wobei er es mit verliebtem Unfug jedem jungen Mann zuvortut. Dem Tode nahe und reif für das Grab, führen sie noch ein junges Weibchen heim, ganz gleich, ob sie ohne Mitgift ist und anderen Nutzen bringt, und das alles ist so gang und gäbe, dass es fast noch gerühmt wird.
Ein noch köstlicheres Schauspiel bieten aber alte Vetteln. Längst schon Greisinnen, dem Tode ausgeliefert und gleichsam so voll Leichengeruch, dass sie von den Toten auferstanden scheinen, haben sie trotzdem immer noch das «Freut euch des Lebens» im Munde, sind voll Brunst und bockslüstern, wie die Griechen sagen. Sie scheuen keine Kosten, um sich einen Phaon zu ködern, schminken sich ständig und weichen nicht vom Spiegel. Hemmungslose Begierde plagt sie, und sie zeigen ihren welken und schlaffen Busen in einem gewagten Dekolleté. Ausgelassene Lieder sollen den altersschwachen Trieb aufmuntern, dazu Trinkgelage, Tanz mit jungen Mädchen und verliebte Briefwechsel.
Alle Welt lacht über solche unbestreitbaren Torheiten, doch sie gefallen sich selbst dabei, haben ihre Lust und salben sich mit dem glückbringenden Honig meiner Gunst. Die aber darüber lächeln, sollten lieber erwägen, ob sie es für richtiger halten, mit solcher Torheit das Leben zu versüssen oder sich am nächstbesten Balken aufzuhängen. Der Hinweis auf die Schändlichkeit solchen Verhaltens trifft meine Toren nicht, denn sie haben kein Gefühl für die Schlechtigkeit oder schlagen es einfach in den Wind. Höchstens ein Stein, der ihnen aufs Haupt fiele, würde von ihnen als Übel empfunden. Übrigens bringen Scham, Ruchlosigkeit, Unzucht und Schlechtigkeiten nur Schaden, wo man ein Gefühl dafür hat. Fehlt dies, sind es nicht einmal Übel.
Was stört es dich, ob das ganze Volk dich auszischt, wenn du mit dir selbst zufrieden bist? Die Torheit allein verschafft dir solche Freiheit. Doch ich glaube, die Philosophen widersprechen mir: Das ist ja gerade das Jämmerliche, in Torheit befangen zu sein, zu irren, sich zu täuschen und keine Ahnung zu haben, unwissend zu sein. Im Gegenteil, das eben heisst Mensch sein! Ich weiss wirklich nicht, warum sie es jämmerlich nennen, wo ihr mit dieser Veranlagung geschaffen und geboren seid, und dies doch allgemeines Los ist. Was seiner Art getreu bleibt, kann man aber nicht elend nennen, wie ja auch keiner den Menschen beklagt, weil er nicht fliegen kann wie die Vögel, nicht wie das andere Getier als Vierfüssler umherläuft und kein Gehörn trägt wie der Stier. Sonst müsste er allerdings das prächtigste Pferd eine Schindmähre nennen, weil es keine Grammatik gelernt hat und keinen Kuchen frisst, und einen Stier müsste er missachten, weil er nicht zur Gymnastik taugt. Wie nun ein Pferd ohne Grammatikkenntnisse keine Schindmähre ist, so ist auch ein törichter Mensch keineswegs unglücklich; denn die Torheit gehört ja zu seiner Natur.
Doch die Wortfechter werden wieder nicht lockerlassen. Bildung, so werden sie sagen, gehört zum Wesen des Menschen, da er mit ihrer Hilfe künstlich ergänzt, was ihm die Natur versagt hat. Kann man denn überhaupt annehmen, die Natur, die bei Flöhen, Pflanzen und Blumen so peinlich gesorgt hat, hätte allein den Menschen vernachlässigt, und man wäre auf jene Künste angewiesen, die der für den Menschen so unselige Erfinder Theuth zu unserm vollen Verderben ersonnen hat, Künste, die so wenig zum Glück verhelfen, dass sie sogar das gefährden, für das sie eigentlich erfunden sein sollen, wie jener fabelhaft kluge König bei Platon in seinen Worten über die Erfindung der Buchstaben glänzend beweist. So sind Wissenschaften und Künste mit allem übrigen Unheil in das menschliche Leben eingedrungen und kommen von den Urhebern aller Widerwärtigkeiten, den Dämonen, die ihren Namen sogar diesem Umstande verdanken, indem der griechische Name ja «Wissende» bedeutet. Im goldenen Zeitalter war die Menschheit ja auch harmlos und frei von dem Rüstzeug der Wissenschaften und Künste, lebte nur im Vertrauen auf ihren natürlichen Instinkt. Was sollte auch die Sprachwissenschaft, da alle die gleiche Sprache hatten und man sie nur gebrauchte, um einander zu verstehen? Wozu hätte man Dialektik nötig gehabt, wo es keinen Meinungsstreit gab? Was sollte man mit der Rhetorik anfangen, da man keine Prozesse führte? Was sollte Gesetzeskenntnis, da es doch keine schlechten Sitten gab, die zweifellos der Ursprung guter Gesetze sind? Man war zu ehrfürchtig, um die Geheimnisse der Natur aufzudecken, die Grösse, Bahn und Wirkung der Gestirne und den verborgenen Ursprung der Dinge zu erforschen, und hielt es für gottlos, als sterblicher Mensch über das gegebene Mass hinaus nach Wissen zu trachten.
Das vermessene Streben nach Kenntnis der Verhältnisse oberhalb des Himmelsgewölbes kam damals keinem in den Sinn. Als aber der reine Glanz des goldenen Zeitalters allmählich verblasste, brachten zuerst üble Erfinder die Künste auf, doch nur wenige machten sich diese zu eigen. Das anmassliche Wissen der Chaldäer und die müssige Leichtfertigkeit der Griechen vermehrten sie später um sechshundert. Es sind arge Kreuze des Geistes, so dass die Grammatik allein voll ausreichen würde als Marter für das ganze Leben.