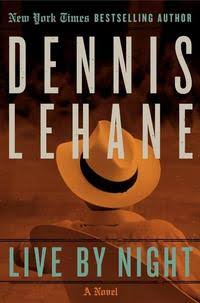
Dennis Lehane schreibt Kriminalromane aus dem Milieu von Boston (er selbst ist Bostonian und lebt in Boston).
Ich bin über folgende Besprechung der NZZaS vom 30.3.2014 auf ihn gestossen:
Endlich wird er ernst genommen (von Manfred Papst)
Der US-Autor Dennis Lehane ist ein Meister des Thrillers. Hierzulande kennt man ihn bis anhin fast nur durch die Verfilmungen seiner Romane. Das sollte sich jetzt ändern.
In Amerika ist er längst ein Star. Zehn Romane hat der 1965 in Boston geborene Autor Dennis Lehane bisher veröffentlicht, drei von ihnen sind meisterhaft und dazu höchst erfolgreich verfilmt worden: «Mystic River» 2003 von Clint Eastwood, «Gone Baby Gone» 2007 von Ben Affleck, «Shutter Island» 2009 von Martin Scorsese.
Mit diesen Filmen ist Lehane auch im deutschen Sprachraum stark rezipiert worden. Seine Bücher aber sind lange Stiefkinder des Feuilletons geblieben. Woran das liegen mag? Vermutlich am Verlag. Bisher wurden Lehanes Romane von Ullstein herausgebracht. Dieses traditionsreiche Berliner Haus gilt seit längerem fast nur noch als Fabrik für Unterhaltungsliteratur. Weder NZZ noch «NZZ am Sonntag» haben jemals ein Buch von Lehane besprochen.
Jetzt aber ist alles anders. Mit seinem in der Prohibitionszeit spielenden Gangsterroman «In der Nacht» hat Lehane zu Diogenes nach Zürich gewechselt, und plötzlich ist er in allen Gazetten präsent. Eine Ironie der Geschichte besteht allerdings darin, dass gerade die Übersetzung dieses Werks ausgesprochen schlecht ist: Lehanes durch Lakonie, Genauigkeit und trockenen Witz geprägtes Englisch wird von Sky Nonhoff in ein verquastes, wabbliges und oft auch blumiges Deutsch gebracht. Die Übersetzung entspricht nicht dem Standard, den wir sonst von Diogenes gewohnt sind. Aber Lehane ist ein so genuiner und vitaler Erzähler, dass er durch keine Verdeutschung ganz umzubringen ist.
Dem gedrungenen, alerten Mann mit dem hellen Blick eilt der Ruf des Schnellschreibers voraus. Dem aber widerspricht er vehement. «Ich mühe mich redlich ab», sagt er. «Das Schreiben fällt mir von Buch zu Buch schwerer. Es verlangt eine Menge Disziplin. Gut, hin und wieder kommt es vor, dass ein Roman einfach hervorsprudelt, als hätte man einen Wasserhahn geöffnet. Bei ‹In der Nacht› war das so. Ich habe diese 600 Seiten in weniger als vier Monaten heruntergehauen, in einer Art Glückszustand, den ich so noch nie erlebt habe.»
Mit dem historischen Roman «The Given Day», der vom Streik der Bostoner Polizei im Jahr 1919 handelt, hat er sich dagegen fünf Jahre geplagt. «Ich habe ein ganzes Jahr recherchiert», erzählt er, «bevor ich auch nur die erste Zeile schrieb. So würde ich es nie mehr anfangen. Heute würde ich mir sagen: Schreib die Geschichte, und such‘ dir bei Bedarf die Fakten zusammen, die du wirklich brauchst. Sonst hast du einen Sack mit Tausenden von Puzzleteilen, die nicht zusammenpassen.» Was Lehane beim Vergleich der beiden Bücher selbst am meisten erstaunt: «‹In der Nacht› ist historisch nicht weniger exakt als ‹The Given Day›.»
Dennis Lehane ist ein Arbeiter von eiserner Disziplin. Das ist das Erbe seiner Eltern. Sie kamen als mausarme Immigranten aus Irland nach Amerika. Der Vater, eines von siebzehn Geschwistern, war froh, eine Stelle bei Sears & Roebuck zu bekommen. Dort arbeitete er sich zum Vorarbeiter hoch. Überwachte die An- und Auslieferung von Paketen. Dreissig Jahre lang. «Etwas Langweiligeres gibt es nicht», sagt der Sohn heute. «Aber mein Vater tat seine Arbeit klaglos. Wörter wie Selbstverwirklichung gab es in seinem Vokabular nicht. Sein Stolz war es, seiner Frau und den fünf Kindern ein Auskommen zu verschaffen.»
Die meisten von Lehanes Büchern spielen in Boston. «Aber es ist nicht das Boston von Beacon Hill, welches bei euch Zürchern der Goldküste entspricht», sagt er lachend. «Alte Familien, altes Geld. Auch nicht das Boston von Harvard und dem MIT. Ich erzähle von den armen Vierteln und von den Unruhen, die besonders in den 1970er Jahren tobten.» Damals galt Boston als diejenige Stadt Amerikas, die am stärksten vom Rassismus geprägt war. Die Situation wurde durch gut gemeinte, hilflose politische Aktionen verschärft. Die Kinder wurden verschiedenen öffentlichen Schulen der Stadt zugelost. Man karrte schwarze Kinder in weisse Viertel und umgekehrt, mit dem Bus, manchmal über fünfzig Meilen, und das täglich. Das sollte der Integration dienen. Aber das Gegenteil passierte. Oft wurden die Busse mit Steinen beworfen. Es kam immer wieder zu Ausschreitungen.
«Man kann Boston nicht verstehen, wenn man diese Geschichte nicht kennt», sagt Dennis Lehane. «Ich bin im Arbeiterviertel Dorchester aufgewachsen. Zwar wurde ich als einziges Kind unserer Familie – der typische verwöhnte Nachzügler – an eine katholische Privatschule geschickt. Aber die Gewalt, die ich als Kind erlebte, hat mich gleichwohl geprägt.»
Den Entschluss, Schriftsteller zu werden, fasste Dennis Lehane mit zwanzig Jahren. Schon als Kind war er ein leidenschaftlicher Leser. Alexandre Dumas und die Spionageromane des Schotten Alistair McLean waren seine Lieblinge. Später kamen Dashiell Hammett, Raymond Chandler und Ross McDonald hinzu: jene hartgesottenen Klassiker, in deren Tradition Lehanes sechs Romane um das Ermittler-Duo Patrick Kenzie und Angela Gennaro fraglos stehen. «Wenn ich zurückdenke», sagt der Autor, «habe ich eigentlich immer urbane Romane geliebt. Die Stadt ist mein grosses Thema.»
Nicht viele Autoren haben mit Verfilmungen so viel Glück gehabt wie Dennis Lehane. «Mystic River» und «Shutter Island» bleiben äusserst nah an den Vorlagen und sind gleichwohl Werke von eigener künstlerischer Kraft. «Ben Affleck hat sich bei ‹Gone Baby Gone› etwas mehr Freiheiten herausgenommen», ergänzt Lehane. «Aber diese Verfilmung ist mir gleichwohl die liebste.» Affleck soll denn auch demnächst «In der Nacht» verfilmen. Leonardo DiCaprio hat sich die Rechte gesichert. Schon im Herbst 2014 soll in Amerika zudem ein Film namens «The Drop» anlaufen, nach einem neuen Buch von Lehane, der Belgier Michaël R. Roskam («Bullhead») zeichnet als Regisseur.
Vater-Sohn-Konflikte sind in Dennis Lehanes Bücher allgegenwärtig. Viele Leute haben deshalb angenommen, er verarbeite da seine eigenen Probleme. «Das ist aber nicht der Fall», sagt er, «zumindest nicht in einem direkten, banalen Sinn. Ich hatte eine sehr gute Beziehung zu meinem Vater. Er gehörte freilich noch zur alten Schule. Wir wurden streng, aber doch liebevoll erzogen. Für Sentimentalitäten, Kuscheln und dergleichen gab es keinen Platz. Und die irischen Frauen sind ja auch nicht in erster Linie für ihre Sanftheit bekannt. Aber es wurden endlos Familiengeschichten erzählt. Am Wochenende kam die ganze Verwandtschaft zusammen.» Das Vater-Sohn-Problem ist für Lehane ein übergeordnetes. Für ihn besteht es darin, dass heranwachsende Knaben immer ihr Vater sein wollen, ohne es je zu schaffen. Auch wenn sie ihn dereinst überflügeln: Sie bleiben immer die Kleinen.
«Mein Vater war stolz auf mich», sagt Lehane, «aber nicht mehr oder weniger als auf meine Geschwister, die keine Karriere machten. Das liebte ich an ihm. Ich bekam Literaturpreise, einer meiner Brüder wurde als ‹Klempner des Jahres› ausgezeichnet. Das war ihm genauso wichtig. Er hat nie eines meiner Bücher gelesen, auch wenn er in dieser Hinsicht manchmal flunkerte. Dass ich allmählich mehr Geld verdiente als die anderen Familienmitglieder, beeindruckte ihn nicht im Geringsten. Er fragte nur: ‹Bist du glücklich? Ja? Dann ist es gut.›»
Lehanes Durchbruch kam, als er 32 Jahre alt war. Im Rückblick war das früh, damals war es für ihn eine Ewigkeit. «Bis dahin gab es wenig, womit ich angeben konnte», sagt er. «Ich übernahm alle möglichen Jobs. In einigen von ihnen habe ich viel gelernt. So habe ich zum Beispiel zwei Jahre lang intensiv mit geistig Behinderten und mit kriminellen Jugendlichen therapeutisch gearbeitet.»
In Dennis Lehanes Büchern geht es oft brutal zu. Erfolgreich sind sie vor allem deshalb, weil sie als ungemein spannend gelten. Der Autor weiss das. Gleichwohl hält er fest: «Die Story interessiert mich nicht gross. Man muss halt eine haben. Ganz ohne Plot geht es nicht. Wenn er fehlt, fällt es auf. Aber er muss kein Jaguar sein. Nicht einmal ein Audi. Ein VW reicht. Aber fahren muss die Karre schon.» Von Literatur, in der gar nichts passiert, hält Lehane wenig. «Irgendjemand hat gesagt, dass er nichts mehr lesen will von vagem Unbehagen in Connecticut. Dem stimme ich zu», sagt er mit blitzenden Augen. Wichtiger als die knackige Story ist ihm gleichwohl die Dichte der Textur. Sprache und Stil müssen stimmen. Die spezifische Atmosphäre muss erfasst sein. Das gilt für alle Genres. «Wenn einer Science-Fiction schreibt wie Ray Bradbury», sagt der Autor, «dann schafft er grosse Literatur, nicht bloss Unterhaltung.»
Viele Jahre hat Dennis Lehane Kreatives Schreiben unterrichtet. Lange machte es ihm Spass. Aber dann hörte er auf damit, weil zu viele unmotivierte Studierende in seinen Kursen sassen. Sie hatten kaum etwas gelesen und wussten nicht, was sie wollten. «Natürlich kann man Schreiben nur bis zu einem gewissen Grad lehren», sagt Lehane. «Man kann den Werkzeugkasten hinstellen. Mehr nicht. Die Leidenschaft und die schlimme Kindheit müssen sie schon selber mitbringen. Ich kann ihnen zeigen, dass ein aktiver Satz besser ist als ein passiver, ein gerader besser als ein krummer. Ich kann ihnen beibringen, gute Dialoge zu schreiben. Aber dann sind sie dran.»
Die Entdeckung des Autors ist für mich ein Gewinn. Lehane schreibt flüssig, sehr ausdrucksstark, einfühlsam, differenziert, aber leicht lesbar und gut verständlich. Seine Dialoge sind lebendig, klar und häufig sehr witzig und mit viel Humor und Sarkasmus gespickt.
«Live by Night» ist eine Gangster-Geschichte aus der US-amerikanischen Zeit der Prohibition der zwanziger und dreissiger Jahre des 20. Jahrhunderts.
Der ‚Held‘, Joe Coughlin, ist Sohn eines hohen Funktionärs der Bostoner Polizei. Er gerät jedoch auf Abwege und in die irisch-italienische Mafia. Er macht Karriere und wird Boss der Filiale eines führenden Bostoner Gangster-Clans in Florida (und den angrenzenden Südstaaten). Es gelingt ihm, die Beziehungen zu den kubanischen Lieferanten von Zigarren, Rum und Zucker-Molasse, aus der dann auf dem amerikanischen Festland Rum hergestellt und in den ganzen USA vertrieben wird, zu monopolisieren. Noch in Boston verliebt er sich in eine schwarze Kubanerin; als Gangster-Boss in Florida begegnet er ihr wieder; sie wird dank ihres kubanischen Hintergrunds ein für ihn geschäftlich wichtiges Mitglied seines Mafia-‚Territoriums‘, aber auch seine Geliebte und Partnerin; später heiratet er sie.
Joe ist ein atypischer Gangster; er sieht sich auch nicht als Gangster, sondern als ‚out-law‘. Wie viel davon reine Sublimation oder Verdrängung ist, und wieviel ‚echte‘ Differenzierung, oder überhaupt was den Unterschied ausmachen könnte, wird von Lehane im Roman nicht klar ausgeführt. Der Hauptgrund für die Rechtfertigung dieser Differenzierung könnte sein, dass Joe Coughlin sich immer wieder darüber Gedanken macht, ob «good deeds can follow of bad money». Jedenfalls ist er eine faszinierende Persönlichkeit, eine seltsame und teilweise irritierende Kreuzung von skrupellosem Gangster einerseits und mitfühlendem Wohltäter für die ausgebeuteten Frauen der Tabakindustrie oder für die Hinterbliebenen Familien von ‚gefallenen‘ Gangstern.
Er spürt rechtzeitig, dass die Prohibition ein Ende haben muss, und dass damit eine wesentliche Geschäftsgrundlage der Mafia hinfällig wird. Es gelingt ihm deshalb, seine ‚Organisation‘ darauf vorzubereiten, auch nach dem Ende der Prohibition ein florierendes legales Geschäft mit Alkohol und Tabak zu betreiben.Er selbst zieht sich samt Familie (Frau und Kind) nach Kuba zurück, kauft und reanimiert dort eine marode Tabakplantage und sieht einem ruhigen Lebensabend entgegen (man erahnt schon einen Gegenbeweis für «crime doesn’t pay»), der allerdings bei einem Kurztrip nach Florida, wo seine Frau einen Preis für ihr soziales und karitatives Wirken entgegennehmen soll, ein abruptes und überraschendes Ende findet.