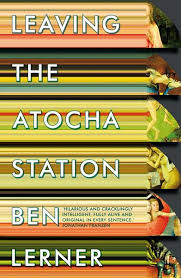
Adán ist ein junger amerikanischer Schriftsteller, der einen Studienaufenthalt in Madrid gewonnen hat. Grundlage seiner Auszeichnung ist sein Projekt, die Bedeutung des spanischen Bürgerkriegs (über den er nichts weiss) für die nachfolgende Generation spanischer Schriftsteller (von denen er nur wenig gelesen hat) zu untersuchen. Er hatte vor, ein langes, aus seiner Forschung resultierendes Gedicht zu schreiben, in welchem er das literarische Erbe des Krieges ausloten wollte.
Er hatte offensichtlich genügend finanzielle Mittel, um in Madrid komfortabel leben zu können. Das tat er auch, indem er, anstatt an seinem Projekt zu arbeiten, viel Zeit im Prado, auf ziellosen Spaziergängen, mit Drogen und Pillen und mit seinem wachsenden Kreis von neuen Freunden und Bekannten verbrachte.
Lerner schreibt gut, anspruchsvoll und durchaus auch humorvoll. Er hat aber einige Ticks, die nerven (mich jedenfalls). Immer wieder überrascht er Leserinnen und Leser, indem er Sachverhalte so beschreibt, als ob sie gleichzeitig so und auch ganz anders wären, ohne jedoch den kleinsten Hinweis dafür zu geben, was er damit ausrücken will. Kann er sich nicht entscheiden, ob es nun entweder so oder ganz anders ist oder will er den handelnden Personen unterstellen, dass sie diesen Unterschied nicht machen können oder wollen, weil sie sich nicht festlegen können oder sich nicht entscheiden wollen. Da es meistens Banalitäten sind, die entweder so oder ganz anders sind, ist ein Sinn für diese Zweideutigkeit nicht erkennbar. Ein anderer Tick besteht darin, dass die handelnden Personen immer wieder in die Metaebene entschweben; sie suchen oder geniessen nicht eine bestimmte Erfahrung oder ein bestimmtes Erlebnis, sie suchen die Erfahrung der Erfahrung; anders gesagt, sie wollen herausfinden (erfahren), wie es ist, eine Erfahrung zu machen. Auf konkrete Inhalte kommt es dabei gar nicht an – nur der Prozess des Erfahrens steht im Vordergrund.
Völlig unerträglich ist für mich, dass Lerner immer wieder sehr schöne Sätze schreibt, die sich zwar gut lesen, aber ein totales Vakuum hinterlassen, weil sie nichts beinhalten. Das tönt etwa so (Seiten 44-45 der GRANTA-Taschenbuchausgabe):
«One cannot counter the commodification of language by fleeing into an imagined past, the second smoker might have countered, which is the signature cultural fantasy of fascism, but rather one must seek out new forms that can figure future possibilities of language, which was what my work was somehow doing, unbeknownst to me, playing recycled archival materials in provocative juxtaposition with contemporary speech. We were all in one group now, the smokers, many of whom were lighting second or third cigarettes, and it was clear that I was expected to weigh in. I said or tried to say that the tension between the two positions, their division, was perhaps itself the truth, a claim I could make no matter what the positions were, and I had the sense the smokers found this comment penetrating.
I lit anorther cigarette to help my aperçu sink in, and in the ensuing silence I tried hard to imagine my poems‘ relation to Franco’s mass graves, how my poems could be said meaningfully to bear on the deliberate and systemtic destruction of a people or a planet, the abolition of classes, or in any sense to constitute a significant political intervention. I tried hard to imagine my poems or any poems as machines that could make things happen, changing the government or the economy or even their language, the body or its sensorium, but I could not imagine this, could not even imagine imagining it. And yet when I imagined the total victory of those other things over poetry, when I imagined, with a sinking feeling, a world without even the terrible excuses for poems that kept faith with the virtual possibilities of the medium, without the sort of absurd ritual I’d partcipated in that evening, then I intuited an inestimable loss, a loss not of artwork but of art, and therefore infinite, the total triumph of the actual, and I realized that, in such a world, I would swallow a bottle of pills.»
Wenn jemand aus solchen Texten einen Sinn herausdestillieren kann – chapeau! Ich bin überfordert und gebe die Lektüre auf.
Die Story selbst ist banal. Adán vertrödelt seinen Madrider Studienaufenthalt mit Partys, Liebschaften und dem Vortäuschen einer besonders tiefen, weil unverständlichen, poetischen Potenz in einer mehr oder weniger geschlossenen Clique von Madrilenen aus dem Kunst- und Literaturmilieu. Man trifft sich, bewundert sich, besäuft und bekifft sich. Gelegentlich spuckt die Wirklichkeit in die heile Welt der Gewissheit der eigenen Überlegenheit der Clique, beiläufig etwa das Attentat auf die Atocha Station (einer der Grossbahnhöfe Madrids), das von der konservativen Regierung vorschnell der ETA zugeschrieben wird, aber tatsächlich von islamistischen Terroristen begangen wurde; die anschliessenden Wahlen kommen vor, bei denen die Konservativen von den Sozialisten, die natürlich von den elitären Intellektuellen unterstützt werden, aus dem Amt gejagt werden.
Gemäss Besprechung in der NZZ vom 4. November 2020 (Andrea Köhler) und gemäss Eigenwerbung im Buch selbst ist Ben Lerner ein Shooting Star der amerikanischen Literatur-Szene. Der Kommentar «The story of a young American abroad and adrift, Leaving the Atocha Station, is a dazzling introduction to one of the smartest, funniest, and most audacious writers of his generation.» ist im Vergleich zu anderen Beurteilungen geradezu noch zurückhaltend. «Utterly charming. Lerner’s self-hating, lying, overmedicated, brilliant fool of a hero is a memorable character, and his voice speaks with a music distinctly and hilariously all his own.» (Paul Auster) oder «Funny, uplifting and moving … [You] finish this book feeling a little cleverer, and a little happier.» (Financial Times) überzeugen mich nicht, oder höchstens davon, dass die Kritiker das Buch nicht gelesen, oder wenn gelesen, nicht verstanden haben. Oder sie alle fallen dem Aberglauben zum Opfer: «Wenn ich etwas nicht verstehe, muss es unendlich klug sein, sonst würde ich es ja verstehen…»
NZZ-Feuilleton vom 4. November 2020
Mitten ins Herz von Amerika
Klug und witzig führt Ben Lerner das akademische Milieu vor – und beleuchtet dabei auch die sprachlose Wut Amerikas. Von Andrea Köhler
Können Tiere an Scham sterben? Die Frage steht im Zentrum von Ben Lerners fulminantem Familien-Roman «Die Topeka-Schule». Sie knüpft an eine kurze Erzählung von Hermann Hesse an, die ihre Wirkung wie ein Funken Glut unterschwellig entfaltet.
Die kleine Geschichte «Ein Mensch namens Ziegler» erzählt von einer Verwandlung: Ziegler steckt aus einem Impuls, den er selbst nicht versteht, in der Alchemie-Abteilung des Naturhistorischen Museums ein kleines braunes Kügelchen ein und stopft es wie ein Kind in den Mund. Bei seinem anschliessenden Zoobesuch entfaltet diese Jahrhunderte alte Pille ihre Wirkung, die ihn um den Verstand bringen wird: Der Mensch namens Ziegler versteht die Sprache der Tiere. In der abgrundtiefen Verachtung der Eingesperrten für die ununterscheidbaren «Kollektivgesichter» vor ihren Käfigen erkennt der Mensch namens Ziegler sich selbst.
Mit anderen Augen sehen
Es ist also nicht der linguistische Zugewinn, der Ziegler ins Irrenhaus bringt, sondern ein substanzieller Verlust: der des Glaubens an seine vermeintliche Überlegenheit. Die Anmassung der Spezies Mensch beruht bekanntlich auf der Vorstellung, dank der rhetorischen Superiorität die Krone der Schöpfung zu sein. Gottfried Benn hatte darauf bereits eine schlagende Antwort parat: «Die Krone der Schöpfung, das Schwein, der Mensch.»
Die Schwächen der sprechenden Gattung, samt der Selbstgefälligkeit, in der sich diese gern offenbaren, kurz: die Gabe, unseresgleichen mit fremden Augen zu sehen, sind das wesentliche Geschäft der Literatur. Der amerikanische Schriftsteller Ben Lerner, 1979 in der titelgebenden Kleinstadt Topeka, Kansas, geboren, hat es darin in mehreren Gedichtbänden und drei Romanen in den USA zu einigem Ruhm gebracht. Er wird auf diesen auch hierzulande nicht lange warten müssen.
«Die Topeka-Schule» ist der dritte Teil einer intellektuell versierten und höchst vergnüglich zu lesenden Trilogie, die mit dem Roman-Debüt «Leaving the Atocha Station» von 2011 und dem New-York-Opus «10.04» (2014) bereits zwei gefeierte Bände vorweist. Der dritte Teil führt uns in Adam Gordons Jugend an der Topeka High School Mitte der neunziger Jahre zurück, wo sich der frühreife Protagonist mit den Malaises der männlichen Adoleszenz herumschlägt. Es ist ein Sprung mitten ins Herz von Amerika.
Nicht nur, weil Adam mit seinem Schöpfer viele Lebensdaten gemeinsam hat, liegt man mit dem neuerdings vielgebrauchten Begriff der «Autofiktion» nicht falsch. Wie Lerner selbst ist Adam ein Champion der in den USA so beliebten Debattier-Wettbewerbe, bei denen es darauf ankommt, den Gegner anhand einer als «Spread» berüchtigten Technik aufs Glatteis zu führen. Sie beruht darauf, in seiner Rede so viel Argumente in so kurzer Zeit unterzubringen, dass der andere darauf nicht mehr antworten kann.
Eine rhetorische Schulung für angehende Juristen und Politiker (Frauen kommen bei diesem Training selten vor), die den Diskurs maximal unterhöhlt. Womit auch das Thema dieses – von Nikolaus Stingl exzellent übersetzten – Romans noch einmal benannt ist: Es geht um die Sprache als Werkzeug der Macht und Instrument der Verführung – und um die Geschichte ihres öffentlichen Verfalls.
Selbstironie
Das in den USA als «mansplaining» berüchtigte Phänomen, welches die (nicht nur in den USA) geläufige Form der männlichen Selbstbehauptung – oder besser: Selbstüberhebung – beschreibt, wird dabei ebenso aufgespiesst wie der Jargon der psychoanalytischen Eigentlichkeit, an der jede Hybris abprallt. Als angehender Lyriker verfügt Adam freilich noch über eine weitere Sprachbegabung, die nicht allein der Technik der Überrumpelung, sondern dem Glanz der Verführung vertraut.
«Gedichte sind für Pussys, Debattier-Wettbewerbe für Nerds», lautet die Formel, mit der er seine Sprachverfallenheit – wie fast alles, was ihn selber betrifft – mit Spott unterläuft. Da trifft es sich gut, dass er sich in seiner Peer-Group wenigstens noch im halbwegs virilen Free Style Rap bewähren kann.
Selbstironie ist überhaupt Lerners vornehmstes Stilmittel, was zu überaus komischen Schieflagen führt. Seine rhetorischen Bewusstseinsvolten profitieren dabei nicht zuletzt von einem Milieu, in dem ihm die Sprache des Unbewussten auf Schritt und Tritt eingebleut wird. Adams Eltern sind Therapeuten bei einer psychoanalytischen Forschungsinstitution, die als intellektuelle Enklave in einem stockkonservativen Milieu den typisch amerikanischen Konflikt zwischen der Küsten-Elite und den – mittlerweile als Trump-Wähler in Erscheinung getretenen – Heartland-Bewohnern heraufbeschwört.
Der Roman wird aus vier unterschiedlichen Perspektiven erzählt: der von Adams Mutter Jane, einer feministischen Buchautorin, Adams Vater Jonathan, der haltlose Kids aus privilegierten Schichten in die Gesellschaft zu reintegrieren versucht, sowie dem Autor und Erzähler selbst. Einen Kontrapunkt bilden die Impressionen des geistig behinderten Darren, dessen gewaltbereites chaotisches Innenleben in kursiv gehaltenen Zwischenkapiteln eingestreut wird und am Schluss implodiert.
Erfolgreiche Frauenfiguren
Die Krisen der Männlichkeit sind der untergründige Strom, der all die Geschichten speist und zusammenhält, von den Rangeleien im Kinderzimmer bis zur stoischen Mumifizierung im Altersheim. Dass den Konkurrenz- und Faustkämpfen, den Angebereien und Übergriffen auch die ausgefuchsteste Therapie nicht beikommen kann, gehört zu den Erkenntnissen, die Adams Vater Jonathan formuliert: «Unser Fehler war es, zu glauben, dass wir nur eine Sprache für unsere Gefühle finden müssten, um diese überwinden zu können.»
Dabei ist es vermutlich kein Zufall, dass es vor allem die Frauenfiguren sind, die das, was heute unter «toxischer Männlichkeit» firmiert, erfolgreich parieren. Wenn Anrufer, die sich von Janes feministischen Thesen, oder besser: der Reaktion ihrer Frauen darauf, verunsichert fühlen, Vergewaltigungs- oder Mordphantasien ins Telefon bellen, tut sie so, als sei die Leitung gestört und fordert die Herren höflich auf, lauter zu sprechen – was bei der zweiten oder dritten Wiederholung zu deren beschämtem Verstummen führt.
Dass das Verstummen durchaus seine dunkle Seite hat, wird heutzutage nicht zuletzt in den anonymen Internetforen evident. «Die Topeka- Schule» zeigt, wie es dazu kam. Das Buch ist auch ein Generationenroman, der – von Rückblenden in die Kindheit von Adams Eltern in den fünfziger Jahren bis ins New York der Jetztzeit – einen grossen historischen Bogen schlägt. Erinnerungen tauchen wie kleine UBoote voller giftiger Frachten aus der Vergangenheit auf und wirken bis in die Gegenwart.
Der doppelte Boden
Als der aus Deutschland emigrierte Psychoanalytiker Klaus, dessen Verwandte in den Brennöfen des Holocaust umkamen, dem jungen Adam ein kleines Kästchen schenkt, ist dieser enttäuscht, dass es leer zu sein scheint. Bis er darüber aufgeklärt wird, dass die Box einen doppelten Boden hat und einen Silberdollar enthält. Ein Schelm, wer darin eine Anspielung auf die Konstruktion des Buches zu sehen vermeint.
Es ist eine andere Box, an der Adams Mutter Jane die verwandelnde Kraft der Sprache erfährt. Als sie ein Kind war, erzählte die ältere Schwester ihr ein Märchen, auf dem ein ganzes Kindheitsglaubens-Gebäude aufruht. Die beiden Mädchen hatten zu Weihnachten statt der versprochenen Fahrräder zwei mit rosa Rosen bemalte Kosmetiktuch-Dosen aus Blech bekommen, und die Enttäuschung war gross.
Um sie zu trösten, erfindet die Ältere eine phantastische Geschichte über die Herkunft der Boxen, deren unübertreffliche Kostbarkeit daher rühre, dass sie auf einer fernen Südseeinsel von extra dafür gezüchteten Tieren bemalt worden seien. Das Entscheidende sei, dass die Tiere zum Bemalen die menschliche Sprache verstehen mussten. Würde ein Tier an dieser Aufgabe scheitern, könne es aus Scham sterben. So viel zur Eingangsfrage.
Diese Geschichte, die die Box überlebt, bricht Jahrzehnte später in sich zusammen, als Jane eine identische Blechdose zufällig auf einem Wühltisch bei Woolworth entdeckt. «Während die Macht der Box mit der Zeit nachliess, unterwarf ich die Geschichte nie der Vernunft, setzte sie nie den Elementen, den schädlichen Fetten aus. Es war eine kleine, aber vitale Geschichte, die am Rand des Bewusstseins überlebte, wo sie ein Scharnier bildete.» Als dieses Scharnier wegbricht, ist auch der Abgrund der Sprachlosigkeit offengelegt, aus dem die Scham, an der wir sterben können, auftaucht.
Der doppelte Boden, die Box in der Box, die Lügen und Selbsttäuschungen, die am Rande des Bewusstseins lauern, bis sie schliesslich doch noch aufgedeckt werden – es sind all diese subtil miteinander verflochtenen Geschichten, aus deren Zusammenklang der Roman seine Magie bezieht. Fast en passant entfaltet er eine Fülle an Beobachtungen, in denen ein vielstimmiges gesellschaftliches Panorama, aufscheint. Wer wissen will, wie es zu der sprachlosen Wut und dem Ende des zivilen Diskurses im Amerika dieser Tage gekommen ist, wird in diesem Roman einige Antworten finden.