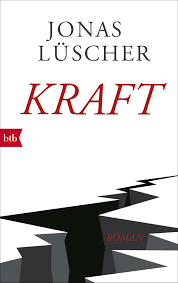
Der Held dieses Romans, Richard Kraft, ist ein kraft- und saftloses Wesen, ein unsympathischer Schwächling, eine Kopfgeburt, die so abgehoben und synthetisch ist, dass man sie als Leser oder Leserin letztlich nur aus lauter Mitleid bis zum (bitteren) Ende aushalten kann. Die Pointe, die dieser Schwächling am Schluss seines Lebens setzt, ist gleichzeitig der einzige Akt seines Lebens, in dem man etwas Kraft erkennen mag, in welchem man aber ebenso sehr eine feige Flucht sehen kann. Das ist allerdings nach 235 Seiten mühsamster Lektüre ein schwacher Trost. Man ist bestenfalls erlöst, dass man nicht mehr weiterlesen muss.
Das ganze Buch ist Mitleid-schwülstig, und schwülstig, pathetisch, und unlesbar ist auch Lüschers Sprache. Zu Manns Zeiten mag es ja noch angegangen sein, Sätze zu bilden, die, Neben- und Schachtelsätze inbegriffen, fast ganze Seiten zu füllen vermögen. Es sind Sätze, bei denen man manchmal drei- bis viermal Anlauf nehmen muss, um sie überhaupt zu verstehen. Und Lüscher bringt es fertig, die banalsten Vorgänge in dieser Kunstsprache zu schildern, die man vielleicht bei ganz erhabenen Dingen gerade noch ertragen könnte; aber ‚Nase schneuzen‘ auf Mann‘sche Art – geschenkt!
Die Story wäre eigentlich ein guter Stoff, um den heutigen Zeitgeist, die Technik-Gläubigkeit der Internet-Aficionados und die Andacht (oder ist es Neid?), mit der vor allem auch Geisteswissenschaftler sich den Herren der digitalen Welt zu Füssen werfen, zu charakterisieren und zu kritisieren. Ein Internet-Mogul (Tobias Erkner, Peter Thiel lässt grüssen…) schreibt einen Preis aus für die beste Arbeit, in der aus moderner Sicht begründet wird, wieso diese Welt die beste aller Welten ist, und weshalb in dieser besten aller Welten eine überzeugende Theodizee (Begründung der Existenz Gottes) gefunden werden kann. Der Siegerpreis beträgt eine Million. Kraft nimmt am Preisausschreiben Teil, weil er dieses Geld benötigt, um sich aus seiner verkrachten (dritten) Ehe freikaufen zu können. Er reist nach Kalifornien, um sich an der Stanford University (schliesslich schuldet er seinem professionellen Ruhm einen würdigen Ort) in aller Ruhe auf die Arbeit an seiner Theodizee zu konzentrieren. Dort begegnet er nach vielen Jahren wieder erstmals einem Jugendfreund, mit dem zusammen er in den 1960-er Jahren natürlich die Welt von links heil machen wollte. Dabei leistete Kraft sich den Luxus, im typischen 68-er Milieu die Welt gegen den Strich zu bürsten und liberale Positionen zu vertreten, was seinem Ruf, eine intellektuell unabhängig denkende Geistesgrösse zu sein, durchaus bekömmlich war. In einer endlosen Kette von Rückblenden werden diese studentischen ‚coming of age‘-Jahre, vermischt mit Erinnerungen an Krafts ersten beiden gescheiterten Beziehungen, rekapituliert. Das Fazit, das sich dabei aufdrängt, ist das eines innerlich halt- und orientierungslosen, opportunistischen Karrieristen, der keiner tiefen menschlichen Bindung fähig ist.
Es liegt nahe anzunehmen, dass Lüscher mit seinem Helden der wissenschaftlichen Welt der Literaten einen Spiegel vorhalten will. Dann bleibt aber nur der Schluss, dass diese Welt total verlogen und verderbt ist und nur von Schein, Lug und Trug lebt.
Wenn man jedoch annimmt, dass Richard Kraft eine rein erfundene Figur ist, die im realen Leben keine Entsprechung findet, dann müsste man Lüscher fragen, was er denn mit seinem Roman erreichen möchte. Wahrscheinlich wäre es aber einfacher, das Buch dann einfach zu ignorieren oder es, falls man es wie ich wegen des Schweizer Buchpreises 2017 voreilig bereits gekauft hätte, wegzuwerfen.
PS:
Das Buch ist ein Flop, ein Ärgernis – mit einer einzigen guten Beigabe, nämlich der Erkenntnis: „Trau‘ keinem Buchpreis nicht!“