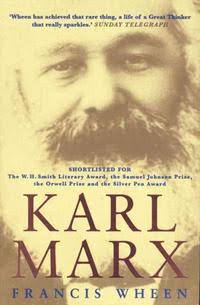
Ich beginne hinten.
Die Marx-Biografie ist in England 1999 erschienen und, von Helmut Ettinger aus dem Englischen übersetzt, 2001 bei Bertelsmann herausgekommen (Buchbesprechung NZZ, 11. April 2001).
Ich meinte, dieses Buch schon längst besprochen zu haben, finde allerdings leider in meinen MyBooks-Notizen (geführt und aufbewahrt seit 2011) nichts. Also war wohl nichts… Jedenfalls steht das Buch in meinem Biographien-Regal.
Auf der Suche nach einer ganz bestimmten Passage (die mir im Kopf hängen geblieben ist) bin ich nun beim Rückwärts-Lesen fündig geworden; im englischsprachigen Originaltext befindet sie sich auf Seite 296. Marx befindet sich 1867 in Deutschland, um die deutschsprachige Erstausgabe von «Das Kapital» herausgeberisch und als Korrektor eng zu begleiten. Er wohnt bei der Familie von Dr. Ludwig Kugelmann (ein bekannter Gynäkologe und (so schreibt Marx an Engels) ‚fanatical supporter‘ von Marx) in Hannover. Nochmals Originaltext Marx: «He has a charming little wife (Gertruda) and an eight-year-old-daughter (Franziska) who is positively sweet.» In dieser Umgebung fühlt Marx sich offensichtlich wohl und entspannt. «The only time he lost his temper was when a visitor asked, who would clean the shoes under communism. ‚You should,‘ Marx retorted crossly. Frau Kugelmann quickly saved the day with a tease, commenting that she couldn’t imagine Herr Marx in a truly egalitarian society since his tastes and habits were so thoroughly aristocratic. ‚Neither can I,‘ he agreed. ‚These times will come, but we must be away by then.‘»
Anmerkung BB: Leider macht der Biograph Wheen für diese Anekdote (auch in den sogenannten Endnotes) keine präzise Quellenangabe. Man kann nur vermuten, Marx habe die Geschichte in seinem von Wheen zitierten Brief an Engels über die Kugelmanns festgehalten.
Der Grund, weshalb die Erinnerung an diese Anekdote mich mental verfolgt hat, ist wohl: Sie illustriert für mich exemplarisch den inneren Widerspruch zwischen revolutionären Theorien und Leben vieler Revolutionäre … und damit auch eine eklatante Verlogenheit. Wasser predigen und Wein trinken ist ja noch eine milde Form von Widerspruch; wenn man die kommunistische Theorie von der klassenlosen Gesellschaft mit dem Lebensstil der russischen Elite, oder dem Regierungs- und Lebensprunk französischer Sozialisten vergleicht, oder auch dem Lebensstil von Marx selbst, findet man in der Kugelmann-Anekdote eine plausible Erklärung.
Bei der Suche nach der oben gelb markierten Anekdote habe ich die letzten drei Kapitel der Biographie (mit den schon fast romantischen Titeln «The Shaggy Dog», «The Rogue Elephant» und «The Shaven Porcupine») nochmals gelesen – und bin begeistert. Nicht etwa von Marx, sondern von Wheens Kunst, das Leben von Marx so zu erzählen, dass es Spass macht, davon zu lesen. Wheen hat auf wissenschaftliche Aufmachung verzichtet; es gibt weder Fussnoten noch Erläuterungen, die länger sind als der zu kommentierende Text. Die am Ende in einem separaten Kapitel zusammengestellten ‚Endnotes‘ sind mehr als spartanisch-spärlich. Dafür ist seine Sprache bildhaft, humorstrotzend und durchzogen vom sprichwörtlichen britischen Geist der Ironie und des Sarkasmus. Als Beispiel (in Kapitel 10, Seite 301) diene ein Kommentar über die Rezeption von Marx von Leszek Kolakowski, ‚einem der einflussreichsten modernen Nachrufschreiber auf den Marxismus‘:
«Es darf nicht vergessen werden, dass die materielle Verarmung weder eine notwendige Prämisse von Marx’ens Analyse der durch Lohnarbeit verursachten Entmenschlichung noch seiner Vorhersage des unausweichlichen Ruins des Kapitalismus war.» Soweit richtig. Allerdings ignoriert dann Kolakowski seinen eigenen Ratschlag, indem er noch einen harten Käse-Brocken in Karl Poppers alte Mausefalle legt; er warnt: «Marx’ens Theorie des Wertes erfüllt die normalen Anforderungen an eine wissenschaftliche Hypothese nicht, ganz besonders nicht diejenige der Falsifizierbarkeit.» Natürlich tut sie das nicht: kein Litmus-Test oder Elektronenmikroskop, kein Computer-Programm kann die Anwesenheit oder das Ausmass von so unbestimmbaren Elementen wie Entfremdung oder moralischen Zerfall erkennen.
Das Kapital ist nicht wirklich eine wissenschaftliche Hypothese, nicht einmal eine Abhandlung über die Wirtschaft, obwohl Eiferer auf beiden Seiten des Arguments immer wieder darauf bestehen, das Werk so zu sehen. Der Verfasser selbst war sich über seine Absichten völlig im Klaren. ‚Nun, was mein Werk betrifft, will ich Euch die volle Wahrheit sagen‘, schrieb Marx an Engels am 31. Juli 1865. ‚Drei weitere Kapitel sind noch zu schreiben, um den theoretischen Teil zu vervollständigen. … Aber ich bin nicht fähig, irgendetwas davon freizugeben, bevor ich das ganze Werk vor mir habe. Meine Schreibergebnisse mögen alle möglichen Schwächen haben, ihr Vorteil aber ist, dass sie ein künstlerisches Ganzes bilden …‘ Ein weiterer Brief, eine Woche später, bezieht sich auf das Buch als ein ‚Kunstwerk‘ und macht ‚künstlerische Überlegungen‘ geltend, um Verzögerungen in der Ablieferung des Manuskripts zu begründen.»
Damit führt nun Wheen, oder vielleicht Marx selbst, die ganze Diskussion über den wissenschaftlichen Wert und die gesellschaftliche Bedeutung seines Hauptwerks ad absurdum. Entweder ist Das Kapital eine seriöse wissenschaftliche Untersuchung über Wertschöpfung, Kapital vs Arbeit, etc., oder es ist Kunst, also Belletristik. Da müsste man sich schon festlegen; Cherrypicking, je nachdem, ob einem eine Passage oder Aussage passt oder nicht, wäre jedenfalls in meinen Augen kein adäquater Umgang mit einem Werk solchen Einflusses und Renommees.
Beim nochmaligen Lesen grösserer Teile der Biographie von Wheen ist mir ein weiterer Punkt aufgefallen. Marx war ausserordentlich freigebig mit Vorhersagen von künftigen Entwicklungen, so produktiv und fruchtbar, dass schon rein statistisch immer wieder die eine oder andere Vorhersage zutreffen musste. Die Tatsache, anders gesagt, dass die eine oder andere Vorhersage von Marx eingetroffen ist, kann man ernsthafterweise nicht als Beweis dafür ansehen, dass seine Theorien stimmen. Hinzukommt, dass die teilweise extrem langen oder gar nach oben offenen Zeithorizonte von Marx’ens Vorhersagen so weit in der Zukunft liegen, dass es sich dabei auch für einen Laien nicht mehr von Vorhersagen, sondern bestenfalls um Prophezeiungen handeln kann. Und da wären wir beim Punkt, dass Marxismus im Grunde halt doch eine Art Religion ist… Und dass Marx und seinesgleichen mit religiöser Inbrunst auf der Suche nach der Wiederherstellung des Paradieses auf Erden waren.
Für mich ist jedenfalls offensichtlich, dass ein Mensch, der 1883 gestorben ist, in seinen Zukunftsaussagen unmöglich Dinge vorhersehen und damit berücksichtigen konnte wie etwa die beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts, den Zusammenbruch des imperialen China, das kurze Aufflackern der japanischen Grossmannssucht, die wirtschaftliche und militärische Weltdominanz der USA, die technologischen Umwälzungen, den medizinischen Fortschritt, die Revolution des Transport- und Kommunikationswesens, und letztlich die Informatik, Digitalisierung und Virtualisierung zahlloser Prozesse. Ich halte mich hier an Karl Popper, der – natürlich in seinen Worten – immer wieder darauf hinweist, dass gesellschaftlich-politische Prozesse viel zu komplex sind, um sie final (auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet) steuern zu können. Und was man nicht steuern kann, kann man auch nicht prognostizieren.
Der Wert von Wheens Biographie drückt sich vielleicht darin aus, dass Leserinnen und Leser durch dir Lebendigkeit und Offenheit der Schilderung von Marx’ens Vita auf solche Gedanken kommen. Ein Teil dieses Verdienstes gebührt selbstverständlich auch Marx, der mit seinen vielfach irregeleiteten Studien und Theorien immer wieder als Vorbild dienen kann für kritisches Denken, tabuloses Infragestellen von ‚heiligen Wahrheiten‘, und unablässiges Suchen.