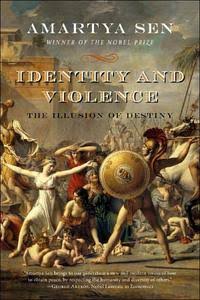
Das 2006 erschienene Buch des Wirtschafts-Nobelpreisträgers (1998) Amartya Sen (*1933 in Westbengalen, heute Indien, beziehungsweise Bangladesh) ist lesens- und bedenkenswert.
Es beschäftigt sich mit zwei Themen, erstens mit den Zusammenhängen zwischen Identität und Gewalt, sowie mit der Frage der richtigen Verteilung der Güter oder Gewinne ökonomischer Transaktionen auf alle daran Beteiligten.
Das erste Thema beansprucht zwar mehr als die Hälfte des Buchs, könnte aber ohne Verlust an Substanz in einem Viertel der Seiten abgehandelt werden. Sens Kernthese ist, dass die ideologisch enge Zuspitzung von Identität auf eine einzige aller Dimensionen, welche ‚Identität’ konstituieren können, sowohl die Vielfalt und den Reichtum der Ressourcen der Menschen minimiert als auch die Ursache von Gewalt und Konflikt ist. Er meint damit, dass ein Mensch der sich als Christ definiert, gleichzeitig auch ein Mitglied einer Nation, einer Familie, einer Sportgemeinschaft, eines Berufsstands, eines Geschlechts (‚gender’), etc., ist, und dass es diesen Menschen buchstäblich ‚verkleinert, wenn man ihn oder sie ausschliesslich als Christen sehen will. Sens Argumentation ist überzeugend und glaubwürdig. Kritisch ist festzuhalten, dass Sen dafür sehr viel Redundanz einsetzt. Es wird überdeutlich, dass der Text eine Vorlesungsreihe (Transkription) wiedergibt. Problematisch ist wohl auch, dass er diese These vor allem am Beispiel des Islam abarbeitet. Dabei stösst auf, dass er sich davor drückt zu definieren, was ,Islam’ ist. Das ändert nichts daran, dass seine These, ein Mensch dürfe nicht auf ein einziges Merkmal seiner Identität (z.B. Religion) reduziert werden, richtig ist. Allerdings bewegt er sich in gefährliche Nähe der Beliebigkeit, wenn er (Seite 71) islamische Gelehrte zitiert, die – in Bezug auf islamistische Terroristen – vertreten, dass «a person would not cease to be a Muslim even if he were to interpret his duties differently (in the view of their critics, mistakenly) so long as he adhered to the core Islamic beliefs and practices». Hier zeigt sich ein Grundproblem der Zugehörigkeit von Individuen zu bestimmten gesellschaftlichen Gruppierungen (z.B. Religionen), das darin besteht, dass es nur in der katholischen Kirche einen Papst gibt. Dieser würde selbstverständlich festlegen, dass ein Mensch, der sagt, er sei zwar Katholik, aber glaube nicht an die Dreifaltigkeit, an die Unfehlbarkeit des Papstes, halte den Marienkult für Humbug, und kirchliche Gebote wie voreheliche Keuschheit, Fasten, etc. seinen ihm egal, kein Katholik sein könne.
Beim zweiten Thema wird Sen um einiges vager. Sobald es darum geht, die ,richtige’ oder ,faire’ Verteilung von Gütern zu diskutieren, ist es meines Erachtens unverzichtbar, zuallererst festzuhalten, was unter solchen Qualifikationen zu verstehen ist: Wann ist eine Verteilung ,richtig’? Welche Verteilung ist ,fair’? Welche Kriterien und welche Autoritäten bestimmen, was ,richtig’ oder ,fair’ ist?
Erfreulich ist, dass Sen bei seinem zweiten Thema, d.h. bei der Diskussion der richtigen Verteilung von ‚Globalisierungsgewinnen‘ insbesondere die Marktwirtschaft ins Zentrum stellt und diese als solche vorbehaltlos verteidigt: «No economy in world history has ever achieved widespread prosperity, going beyond the high life of the elite, without making considerable use of markets and production conditions that depend on markets». (Seite 137)
Es ist genussvoll, wie Sen klarstellt, dass es einen ‚Markt an sich‘ nicht gibt, sondern dass ein Markt ein Mechanismus ist, der nur in einem gegebenen Set von Rahmenbedingungen und Regularien funktionieren kann, und dass, wenn einem die Ergebnisse nicht passen, nicht der Markt, sondern die Rahmenbedingungen oder Regularien (oder – Anmerkung BB – das Verhalten der Marktteilnehmer) dafür verantwortlich sind.
Sens Argumentation läuft darauf hinaus, dass Globalisierung oder Märkte an sich gut sind und dazu beigetragen haben, dass Milliarden von Menschen in den letzten 50 Jahren ein materiell wesentlich besseres Leben gefunden haben, dass es aber allein darauf nicht ankommt. Er sieht die Herausforderung nicht allein oder primär darin, dass wirtschaftliches Handeln zu einem allgemeinen Anstieg des Wohlstands führt, sondern auch oder insbesondere, dass die Gewinne des wirtschaftlichen Handelns (egal ob lokal, national oder global) auf alle Beteiligten ‚fair‘ verteilt werden. Ihm genügt die Argumentation nicht: «Dank Globalisierung geht es allen Beteiligten besser – also, wo ist das Problem?» Er postuliert, das innerhalb eines gegebenen Systems die Verteilung aller Gewinne auf alle Beteiligten fair sein soll, unabhängig davon, ob es ‚davor‘ einzelnen Beteiligten viel schlechter gegangen sein mag. Er will nicht nur, dass es allen Beteiligten besser geht, sondern dass das Quantum ‚besser‘ auch ‚richtig‘ oder ‚fair‘ verteilt wird.
Was mir an Sens Argumentation nicht gefällt, ist das Fehlen einer Definition für richtig, fair oder gerecht; auch Abgrenzungen für Begriffe wie Geber und Empfänger fehlen. Leider verzichtet er vollständig darauf, zu spezifizieren, was er darunter versteht; er äussert sich auch nicht zur Frage, wie zwischen diesen – beziehungsweise in der globalisierten Welt zwischen allen beteiligten Parteien – ein Konsens über eine faire Verteilung zustande kommen könnte, oder wie ein solcher Konsens durchgesetzt werden könnte. Die Tatsache, dass er offenlässt, wer für die Festlegung von Rahmenbedingungen und Regularien verantwortlich ist, erweckt sogar eher den Eindruck, dass die Verantwortung für eine richtige oder faire Verteilung in der täglichen Geschäftspraxis bei den privaten Akteuren liegt, unabhängig von staatlichen Instanzen. Das würde letztlich darauf hinauslaufen, dass Politik oder die ‚Gesellschaft at large‘ keinerlei Verantwortung für das Wohl der Menschheit übernehmen müssten.
Ausserdem:
- Wenn es so ist, dass die zunehmende Tendenz, die Menschen in eindimensionale Identitäts-‚Schubladen‘ zu sperren, und dass dies Ursache für zunehmende Gewalt zwischen diesen Menschengruppen ist, wie lässt sich dann erklären, dass Gewalt zwischen diversen menschlichen Gruppierungen, Ethnien, Völkern, Stämmen, Nationen etc. seit Menschengedenken immer wieder gegeben hat. Entweder ist die Identitäts-Zuspitzung kein neues Phänomen, oder sie erklärt nicht die Zunahme von Gewalt.
- Wenn es die Identitäts-Zuspitzung schon immer gegeben haben sollte, könnte es dann nicht sein, dass sie die notwendige Folge des urmenschlichen Bedürfnisses nach Abgrenzung ist. Identitäts-Zuspitzung ist doch letztlich nichts anderes als eine konkrete Ausprägung des menschlichen Grundbedürfnisses nach Vereinfachung von Komplexität. Denn sie ist in den meisten Fällen nicht a priori falsch, weil sie einen Menschen oder eine Menge von Menschen nach einem dominierenden Element ihrer multidimensionalen Identität auf eine einzige Dimension reduziert oder verdichtet. Natürlich führt dies auch oft zu ‚terribles simplifications‘, die Sen zu Recht kritisiert und beklagt.
- Sen betreibt in seinem Furor, die Identitäts-Verdichtung für die meisten Übel der heutigen Zeit verantwortlich zu machen, selber so etwas wie eine ‚terrible simplification‘, weil er die Bedeutung von dominierenden Identitäts-Dimensionen herunterspielt oder verkennt; er gerät damit in die Gesellschaft der Beliebigkeits-Apostel.