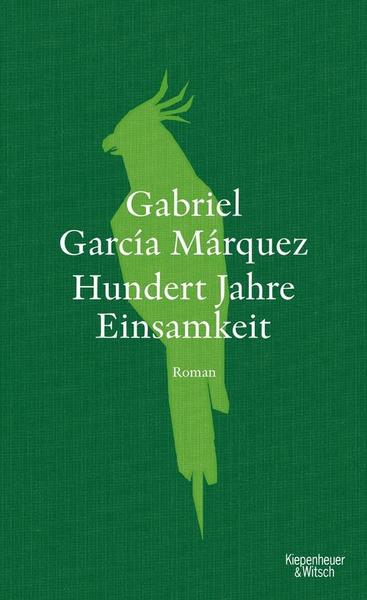
(Neuübersetzung aus dem Spanischen von Dagmar Ploetz. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2017)
Ich begann die Lektüre dieses Weltromans, mir jedoch völlig unbekannt, sozusagen ‚nackt‘, d.h. völlig unvorbereitet. Ich hätte das Buch wahrscheinlich schon nach wenigen Seiten beiseitegelegt, wenn ich nicht auf die Idee gekommen wäre, zunächst einmal nachzuforschen, was das überhaupt für ein Buch ist. Die Einführung in Wikipedia half mir dann über die Einstiegsschwierigkeiten des Einführungskapitels hinweg, denn zunächst fand ich die fantastische, unrealistische, geradezu mystisch-magisch-esoterische Welt von Macondo und der dort lebenden Menschen so abwegig, dass ich keinen Zugang finden konnte.
Ich habe mich dann durch das erste Drittel des Romans durchgekämpft und durchgebissen. Der Zugang blieb mir jedoch weiterhin verwehrt. Das ständige Schwelgen von Márquez in der mystischen Welt Macondos und der Familie Buendia, das völlig unglaubwürdige Auftauchen einer Zigeunergruppe mit einem Anführer, der übernatürliche Kräfte hat, im Nirgendwo des Regenwalds des Amazonasgebiets, der in der Wolle eingefärbte Aberglaube von Macondos Bewohnern und deren Bigotterie, das alles ist zu viel für mich. Es mag ja sein, dass das Auftauchen ausländischer Plantagenbetreiber, die de-facto-Versklavung der Eingeborenen (die allerdings im ersten Drittel nicht vorkommt), und schliesslich die Zerstörung Macondos eine allegorische Darstellung des Schicksals Lateinamerikas ist – aber was geht mich das alles an? Wenn ich die Geschichte Lateinamerikas kennenlernen möchte, griffe ich zu einem Geschichtsbuch, Punkt! Die poetische Sublimierung der Biografie einer Familie oder einer Dorfgemeinschaft ist für mich weder ein Tatsachenbericht noch eine repräsentative Darstellung der Geschichte und des Schicksals eines Kontinents. Und soweit sie symbolisch gemein sein sollte, kann ich damit wenig anfangen, weil ich die Symbole weder verstehe noch einordnen kann.
Aber wahrscheinlich hat genau diese poetische Sublimierung die Rezeption des Romans in Literatenkreisen bis zu Nobelpreis-Höhen anschwellen lassen. Was die (post)koloniale Ausbeutung der Natur und von Naturvölkern kritisch aufarbeitet, muss gut sein, weil die gute Sache, die gute Moral zu Wort kommt. Der Eigenbeitrag der ‚Opfer‘, die Selbstverantwortung, das eigene Schicksal in die Hand zu nehmen, die Komplizität der ‚eingeborenen‘ Eliten mit ausländischen Investoren, das alles kann selbstverständlich ignoriert werden – es genügt, die Opferperspektive zu zelebrieren.
Auszug aus Wikipedia-Besprechung (Stand 5. Mai 2020)
Bedeutung
Seit der Erstveröffentlichung am 5. Juni 1967 in Buenos Aires wurden weltweit über 30 Millionen Exemplare verkauft. Der Roman wurde bis 2017 in 37 Sprachen übersetzt und gilt als eines der wichtigsten Werke des Magischen Realismus sowie der lateinamerikanischen Literatur überhaupt. Der Autor selbst behauptete, es keineswegs für sein bestes Werk zu halten, doch die lange Entstehungsgeschichte, wie sie u.a. in der García-Márquez-Biographie von Juri Paporow (siehe unter Quellen) beschrieben wird, deutet darauf hin, dass der Autor es als sein Magnum Opus ansah. Erstausgaben des Werkes werden heute zum Kulturerbe Kolumbiens gezählt.
Handlung
Der Roman «Hundert Jahre Einsamkeit» begleitet sechs Generationen der Familie Buendía und hundert Jahre wirklichen Lebens in der zwar fiktiven Welt von Macondo, die sich jedoch auf die kolumbianische Heimat des Autors bezieht. Dabei ist der chronologische Ablauf zunächst nur wenig erkennbar. Das umfassend angewendete Stilmittel der Vor- und Rückgriffe (Pro-und Analepse) lässt bei einer ersten Lektüre den Eindruck entstehen, dass es sich hier um ein Durcheinander von Episoden aus dem Leben der Protagonisten handelt. Ergänzt wird dieser Eindruck durch zahlreiche Homonymien der Charaktere. Tatsächlich befolgt die Reihenfolge der einzelnen Kapitel die Chronologie der erzählten Ereignisse – mit Ausnahme des Auftaktkapitels, bei dem es sich um einen einzigen grossen Vorgriff handelt.[1] Eine Reihe von Literaturwissenschaftlern, darunter Mechthild Strausfeld, kommen zum Schluss, dass sich die Geschichte Macondos, und somit die Handlung des Romans, grob in vier Perioden aufteilen lässt:
Auszug der Buendías und Gründung Macondos
Der Stammvater der Buendías zieht, da er einen Mord begangen hat und vor dem Geist des von ihm Ermordeten flüchtet, mit seiner Frau sowie einigen anderen Familien durch den Dschungel, auf der Suche nach einem geeigneten Ort zur Gründung eines Dorfes. Sie gründen schließlich Macondo. Bald darauf taucht eine Gruppe von Zigeunern auf, zu denen u. a. Melchíades gehört, eine weitere Hauptperson des Romans.
Auftauchen des Landrichters und Verlauf der Bürgerkriege
Das Auftauchen eines corregidor (‚Landrichter‘), besiegelt die Eingliederung Macondos ins System staatlicher Verwaltung und Gewalt, vor dem seine abgelegene Topographie die Bewohner ja gerade bewahren sollte. Da dieses Dorf nun ebenfalls Teil der Republik ist, spielt auch der Bürgerkriegzwischen Konservativen und Liberalen für die Bewohner von Macondo eine Rolle. Oberst Aureliano Buendía, die wichtigste Figur des Romans, tut sich hier besonders hervor.
Die Bananenfabrik
Nach dem Bürgerkrieg wird eine nordamerikanische Bananenfabrik zum wichtigsten Arbeitgeber des Dorfes. Deren Umgang mit den Arbeitern ist von Härte und Brutalität gekennzeichnet. So kommt es u. a. zu einem vertuschten Massaker auf dem Bahnhof, bei dem alle anwesenden streikenden Arbeiter getötet werden.
Der langsame Verfall und die völlige Zerstörung des Dorfes
In den letzten Kapiteln liegt Macondo in einer tiefen Agonie, in der alles verfällt bzw. der Urwald sich das ihm einst von dem Menschen abgetrotzte Territorium langsam zurückholt, ohne dass es die Bewohner besonders stört oder auch nur verwundert. Die Geschichte kulminiert in einem mystischenund unerwarteten Schluss: Aureliano Babilonia, der letzte noch lebende Nachfahr José Arcadio Buendías, entziffert die verschlüsselten Schriften des Melchíades, die sich als eine Chronik und Prophezeiung der Geschichte Macondos herausstellen; sie endet mit der Zerstörung des Dorfes, bei der auch Aureliano Babilonia zu Tode kommt – just in dem Moment, als er davon in Melchíades’ Prophezeiung liest.
Interpretationsansatz
Der Roman enthält viele Bezüge zum katholischen Glauben und der Bibel, nicht zuletzt in dem Bogen, den er von der Gründung des Ortes (Genesis) bis zu seiner Zerstörung (Apokalypse) spannt. Ausserdem gilt die Handlung des Buches unter vielen Literaturwissenschaftlern als eine Allegorie auf die Geschichte Lateinamerikas. Diese Geschichte wird von Strausfeld in vier Epochen eingeteilt, die sie den oben aufgeführten vier Abschnitten des Romans zuweist:
1) Entdeckung, Eroberung, Kolonialzeit (1492–1830)
2) Republik: Beginn der Bürgerkriege (1830–1902)
3) Beginn des Imperialismus: Bananen etc. (1899–1930)
4) Aktualität – Neoimperialismus (1930–Gegenwart)