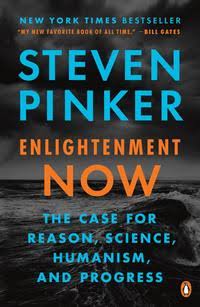
In diesem 450-Seiten starken Wälzer vertritt Pinker die These, dass die Menschheit insgesamt seit der Aufklärung eindrückliche Fortschritte (‚progress‘) erzielt hat, dass es der Menschheit heute so gut geht wie noch nie.
Für ihn ist dafür kausal die Aufklärung verantwortlich. Den wichtigsten Beitrag der Aufklärung sieht er im Prinzip, dass wir Vernunft und Mitgefühl einsetzen können, um das Wohlbefinden der Menschen zu steigern. Er selbst qualifiziert zunächst dieses Prinzip als vordergründig ‚obvious, trite, old-fashoned‘; insistiert dann aber, dass es dies nicht ist. Er findet, dass es heute mehr denn je notwendig ist, die Ideale ‚Vernunft, Wissenschaft (inklusive wissenschaftliche Vorgehensweisen), Humanismus und Fortschritt‘ hochzuhalten und mit Herzblut (‚wholehearted‘) hochzuhalten und zu verteidigen.
Aufklärung beginnt für Pinker bei Kants «Sapere aude!» (in Pinkers Übersetzung «Dare to understand!» Er sieht sich darin in der Verteidigung der Aufklärung durch den Physiker David Deutsch bestätigt; dieser postuliert, dass, wenn wir wagen zu wissen, Fortschritt in allen Dimensionen der Wissenschaft, Politik und der Moral möglich ist: «Optimism … is the theory that all failures – all evils – are due to insufficient knowledge… Problems are inevitable, because our knowledge will always be indefinitely far from complete. Some problems are hard, but it is a mistake to confuse hard problems with problems unlikely to be solved. Problems are solvable, and each particular evil is a problem that can be solved. An optimistic civilization is open and not afraid to innovate, and is based on traditions of criticism. Its institutions keep improving, and the most important knowledge that they embody is knowledge of how to detect and eliminate errors.» (Seite 7)
Fortschritt bedeutet für ihn:
«Most people agree that life is better than death. Health is better than sickness. Sustenance is better than hunger. Abundance is better than poverty. Peace is better than war. Safety is better than danger. Freedom is better than tyranny. Equal rights are better than bigotry and discrimination. Literacy is better than illiteracy. Knowledge is better than ignorance. Intelligence is better than dull-wittedness. Happiness is better than misery. Opportunities to enjoy family, friends, culture and nature are better than drudgery and monotony.
All these things can be measured. If they have increased over timer, that is progress.» (Seite 51)
Pinker weist nun in Teil II des Werks in zahlreichen Tabellen und Grafiken (deren seriösen und kaum anfechtbaren Quellen er peinlich exakt festhält), dass und wie sich die folgenden Kriterien des menschlichen Wohlbefindens in der Neuzeit zum Besseren entwickelt haben: Lebenserwartung, Gesundheit, Verfügbarkeit von Nahrung, Wohlstand, Ungleichheit, Umwelt, Frieden, Sicherheit, Terrorismus, Demokratie, Gleichberechtigung, Wissen/Bildung, Lebensqualität, Glück, existentielle Gefährdungen. Und aus diesen Analysen zieht er den Schluss, dass es der Menschheit heute so gut geht wie noch nie, oder anders gesagt, dass sie in allen Dimensionen des menschlichen Wohlbefindens riesige Fortschritte gemacht hat.
Da für ihn die kausale Verantwortung für diese Fortschritte bei den Werten der Aufklärung liegt, steht für ihn auch fest, dass ‚Aufklärung funktioniert‘, dass also die konsequente Anwendung der Vernunft, wissenschaftliches Vorgehen und Humanismus die Menschheit vorangebracht haben.
Natürlich sieht Pinker, dass die Aussage «Es geht uns heute besser als je zuvor.» nicht bedeutet, dass es uns, einigen von uns, oder allen von uns, heute ‚gut‘ geht. Er anerkennt vorbehaltlos, dass es der Welt und der Menschheit auch viel besser gehen könnte; dass viele Probleme, in denen wir zwar Fortschritte gemacht haben, noch weit davon entfernt sind, gelöst zu sein – falls sie überhaupt jemals als komplett und unwiderruflich gelöst erklärt werden können.
Aber die Überzeugung, dass in der Vergangenheit ‚Aufklärung funktioniert‘ hat, ist für ihn auch ein Versprechen für die Zukunft. Er postuliert, dass, bis zum Beweis des Gegenteils, die Faktoren des bisherigen Erfolgs der Aufklärung auch die beste Gewähr dafür bieten, bislang noch ungelöste sowie zukünftig auftauchende neue Probleme zu lösen. Er weist ausführlich und überzeugend nach, dass in der Vergangenheit alle Weltuntergangspropheten (von Malthus bis zum Club of Rome) mit ihren düsteren Katastrophenszenarien grundlegend falsch lagen, und dass sie dabei den Boden der Vernunft verlassen hatten und in der Tendenz kontraproduktive Wirkung erzielten (vereinfacht illustriert: «Wenn die Welt schon untergeht, dann müssen wir ja nichts mehr tun; dann wollen wir noch geniessen, solange es geht…!»). Für Pinker sind Optimismus, Innovation und Wissenschaft die besseren Werkzeuge, Probleme zu lösen, als missionarische Appelle zum Verzicht oder angstgetriebene Prophezeiungen, dass alles immer schlimmer wird.
Pinker erbringt in Teil II «Progress» den Nachweis, dass die Menschheit dank der Aufklärung in jeder Hinsicht gewaltige Fortschritte gemacht hat. Paradoxerweise leitet er diesen Teil mit dem Kapitel «Progressophobia» ein; hier setzt er sich mit den Geistesströmungen auseinander, die es vorziehen, die Welt auf einer schiefen Ebene zu sehen, auf der es stetig und nur nach unten geht. Dahinter sieht er einen tiefen Hass auf Fortschritt, der fortwährend Nahrung findet in einem ‚negativity bias‘ (wir erinnern uns besser an negative als an positive Erfahrungen; in einem ‚availability bias‘ (negative Nachrichten oder Ratschläge für den Umgang mit negativen Erfahrungen sind viel häufiger als positive und erzeugen in uns den intuitiven Eindruck, dass die Welt schlecht ist; typische Ausprägung gemäss Tom Lehrer: «Always predict the worst, and you’ll be hailed as a prophet.»). Pinkers Antwort auf diese negativen Kräfte ist: «to count».; z.B.: wie viele Menschen sind Opfer von Gewalt in Relation zur Gesamtheit der lebenden Menschen; wie viele sind krank, am Verhungern, arm, unterdrückt, Analphabeten, unglücklich, etc.? Steigen diese Zahlen, oder sind sie am Sinken?
Und damit ist Pinker wieder bei der Aufklärung: Einsatz der Vernunft, Fakten sind bedeutender als Ängste, ohne faktische Kenntnis der Situation gibt es keine vernünftigen Handlungsoptionen zur Verbesserung der Verhältnisse.
In Teil III fasst Pinker die Faktoren, welche den Fortschritt gemäss Teil II begründen, unter den Schlagworten ‚Vernunft‘, ‚Wissenschaft‘ und ‚Humanismus‘ zusammen. Er holt dabei weit aus und liefert viele und überzeugende Argumente für seine These, dass die Aufklärung mit den aufgezeigten Verbesserungen der ‚condition humaine‘ nicht nur korreliert, sondern kausal dafür verantwortlich ist. Er rechnet dabei auch sehr deutlich und spitz mit der Klasse der – vorwiegend in den Geisteswissenschaften oder Religionen beheimateten – Intellektuellen (und Hohepriester) ab, die grundsätzlich gegen faktisches Denken und Rationalität eingestellt sind. In seinen Überlegungen und Ausführungen vermisse ich ein Argument, das diese Wissenschafts- und Aufklärungsaversion am einfachsten erklären könnte:
- Mit der Aufklärung haben die vor-aufklärerisch im Besitz der Deutungshoheit zuständigen Kräfte und Klassen ihre herausragende Stellung verloren; sie wurden durch die Aufklärung und die durch sie ermöglichte oder begründete rationale Sicht auf die Welt geradezu desavouiert.
- Die post-aufklärerischen Geisteswissenschaften haben den Anspruch, (anstelle der Religion) für die Erklärung der Welt zuständig zu sein; dabei arbeiten sie mit nebulösen Werten, substanzfreien Behauptungen, unverständlichem Jargon (der eben gerade wegen seiner Abgehobenheit und Unverständlichkeit besondere Relevanz bekommt…). Wer mit Fakten kommt, instrumentalisiert die Menschen. Wenn sie Zahlen sehen, sehen sie rot.
- Die rationale, auf Fakten und empirischen Beweisen basierte Sicht auf die Welt stellt die Deutungshoheit der Geisteswissenschaften in Frage und muss deswegen ‚verteufelt‘ werden.
Fazit:
Das Buch fasziniert mit seiner Theorie über den Gewinn der aufklärerischen Ideen und der These, dass der bisherige Erfolg dieser Ideen am ehesten verspricht, dass die Menschheit auch dabei erfolgreich sein wird, noch bestehende und zukünftig auftauchende Probleme zu lösen – nach dem Motto «Aufklärung funktioniert! Weiter so!»
Pinker schreibt flüssig, sprachlich elegant, garniert seine Thesen auch mit viel Witz, Ironie und bissiger Kritik an allem, was nicht ‚aufgeklärt‘ ist, also was nach Aberglauben und eingebildet-intellektueller Besserwisserei riecht.
Vor allem in Teil I erschlägt er Leserinnen und Leser mit einem Zahlen- und Grafikenbombardement. Kritiker, die ihm vorwerfen, er reduziere den Menschen oder den Fortschritt auf das Zähl- und Messbare, tun ihm allerdings unrecht, denn Pinker verwendet sein Zahlenmaterial ausschliesslich für die Begründung seiner Behauptung, heute sei (fast) alles besser als früher. Er betont mehrfach und überdeutlich, dass er damit nicht sagt «Alles ist gut!» Er geht auch ausführlich und wohl begründet darauf ein, dass Zahlen und Messwerte nicht alles sind; das zeigt sich in seiner Wertung der Kerngedanken der Aufklärung, und insbesondere in der Bedeutung, die er dem Humanismus zuweist. Er bleibt aber konsequent beim Grundsatz, dass jemand, der Fakten nicht anerkennt (z.B. über die Entwicklung von Wohlstand, Ungleichheit oder Lebenserwartung), den Boden der Rationalität verlässt und nie in der Lage sein wird, Fakten mit aus der Luft gegriffenen philosophischen Behauptungen zum Verschwinden zu bringen.
Trotzdem: es bleibt ein schales Gefühl – Pinker ist zu sehr auf seine Kriterien für ‚progress‘ fixiert. Einerseits fehlen qualitative Kriterien für den Zustand der Menschheit, z.B. Leistungswille und -bereitschaft, Eigenverantwortung als Korrelat der Freiheit, evolutionäres Konkurrenzdenken versus Mitgefühl und Rücksichtnahme, Frustrationstoleranz und Resilienz, Anstand und Ehrlichkeit, Einsatz für das Wohl einer Gemeinschaft versus Hedonismus, Verlust von wesentlichen Grundlagen für das Zusammenleben als Folge einer grassierenden Beliebigkeit (‚anything goes‘). Anderseits tönt der Appell «Seid doch bitte rational oder vernünftig! Bleibt bei den Fakten und der Wissenschaftlichkeit! Vergesst Gefühle, Ängste; verdrängt Egoismus!» reichlich hohl.
Wenn er schon die in der bisherigen Entwicklung feststellbaren Erfolge aufklärerischer Gedanken in die Zukunft extrapoliert, wäre es mindestens auch angebracht, die Menschheitskatastrophen der Vergangenheit, welche durch Gier, Machtwille, Rücksichtslosigkeit oder ganz generell durch das Pochen auf das Recht des Stärkeren verursacht wurden, ebenfalls in die Zukunft zu projizieren; damit könnte wenigstens der überbordende Optimismus, der in der einfachen Formel ‚Aufklärung funktioniert!‘ steckt, relativiert werden.
Leider ist es auch eine Tatsache, dass die Menschen zu allem, auch zum Schlimmsten fähig sind; die aktuelle Realität zeigt jedenfalls, dass wir noch meilenweit davon entfernt sind, andere, d.h. bessere Menschen zu werden.