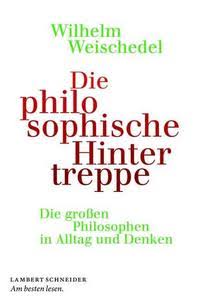
Die Suggestion des Titels, den Zugang zu grossen Philosophen über die Hintertreppe zu finden, löst die damit verbundenen Erwartungen nur teilweise ein. Natürlich wird die Hintertreppe, also der Einbezug von Alltagsleben, Gerüchten, Skurrilitäten und nicht-philosophischen Persönlichkeitsaspekten, im Buch auch benutzt; aber im Grunde kommen nur Dinge zur Sprache, die auch in einer ‚normalen‘ Biografie eines Philosophen Platz haben und finden müssen.
Sei’s drum – jedenfalls ist die Einladung, die Hintertreppe zu benutzen, ein guter Aufhänger dafür, dass Weischedel die porträtierten Philosophen und deren philosophisches Werk eher aphoristisch-essayistisch, eklektisch und selektiv behandelt, als dass er ihnen eine systematische Abhandlung des Entstehens ihres Denkens und dessen Resultate widmen würde.
Die Auswahl der von Weischedel porträtierten Philosophen und der Elemente ihres Werks ist – für meinen Geschmack etwas einseitig – auf die Suche der Philosophen nach dem Transzendenten, nach dem Göttlichen ausgerichtet.
Trotzdem bietet die Anthologie einen guten, lesbaren, teilweise amüsanten Zugang auf die Geschichte der abendländischen Philosophie von den ‚alten Griechen‘ (Platon, Aristoteles) bis zu Wittgenstein, der das eigentliche Ende der Philosophie einläutete.
Wenn man die Philosophie in dieser kompakten Form Revue passieren lässt, fallen zwei Dinge auf:
- Die Philosophen befassten sich ursprünglich, weil es eine differenzierte Abgrenzung einzelner wissenschaftlicher Disziplinen noch nicht gab, umfassend mit allen Aspekten der Wissenschaften – also mit Philosophie im engeren Sinne ebenso sehr wie mit Physik, Kosmologie, Geologie, Chemie, Biologie, Neurologie, etc.; dabei stützten sie sich ausserordentlich stark auf reine Spekulationen ab.
- Es erstaunt, dass Philosophen bis ins 19. Jahrhundert hinein Rücksicht auf die ursprünglich kirchliche, aber auch noch nach der Aufklärung zunehmende staatliche Zensur Rücksicht nahmen; eine Nebenwirkung der Zensur war, dass viele philosophische Werke ursprünglich anonym erschienen.
Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein gingen die Philosophen, weil sie zu wenig wussten und deshalb spekulieren oder bestehende feste ‚Glaubenssätze‘ kritiklos übernahmen, von einem Weltverständnis aus, das im Menschen die Krone der Schöpfung sah, der schon immer existiert hatte. Insofern haben die Erkenntnisse, welche die Menschen aus der Evolution sowie aus der modernen Biologie und Hirnforschung gewinnen konnten, grosse Teile ‚früherer‘ Philosophien obsolet und fast lächerlich gemacht.
So gesehen ist Weischedels Überblick in erster Linie nur geschichtlich interessant. Er stützt damit gewissermassen unfreiwillig die ernüchternde Gewissheit, dass alles Wissen vorläufig ist, und macht Leserinnen und Leser entsprechend vorsichtig, irgendwelche neue Erkenntnisse nicht zu schnell als neue Gewissheiten anzunehmen.
Die Lektüre ist auch eine Warnung davor, sich allzu spekulativ philosophisch mit Fragen zu befassen, die auf Grund des jeweiligen Wissensstands ausserhalb des rationalen Fassungsvermögens liegen. Manchmal wäre es auch früheren grossen Denkern gut angestanden, darauf zu verzichten, über Dinge, die sie weder wissen noch verstehen konnten, kategorische Aussagen zu machen. Offenbar fällt es jemandem, der ‚die Welt erklären will‘, schwer einzugestehen, dass er Vieles nicht weiss.