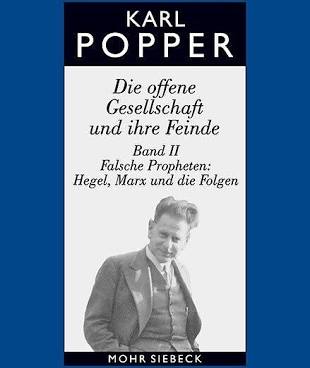
Schwere Kost: Popper widmet den gesamten ersten Band der Auseinandersetzung mit Platon, d.h. mit der platon’schen Erkenntnistheorie und dessen – in Poppers Terminologie – historizistischer Sicht auf Geschichte, Gesellschaft und Gesellschaftsentwicklung.
Auf Platons Erkenntnistheorie gehe ich nicht weiter ein; die einschlägigen Ausführungen sind zwar eine interessante und lehrreiche Lektüre; als Leser lernt man viel über die Anfänge der intellektuellen Versuche, die Welt und die ‚Dinge‘, die in ihr existieren, zu verstehen. Dabei geht Platon von einer apodiktischen, religionsähnlichen Prämisse über die Bedeutung von Wesen, Idee oder ähnlichen Begriffen aus; er hält das, was er als Grundlage für alle weiteren Gedanken ansieht, als a priori gegeben. Weil er vollständig auf Empirie verzichtet, sie sogar explizit verschmäht, ist dieser Teil seiner Philosophie aus meiner Sicht für die Gegenwart ziemlich irrelevant; er mag für Philosophiehistoriker von Bedeutung sein. Platon kommt mir vor wie ein Feuerwehrmann, der vor einem Feuer steht, sich aber weigert, mit dem Löschen zu beginnen, bevor er das ‚Wesen‘ des Wassers und Feuers philosophisch durchdrungen hat.
Platons Historizismus ist aus meiner Sicht auch heute noch viel relevanter, weil zahlreiche Gesellschaftsphilosophien ebenfalls historizistisch sind. Vereinfacht gesagt versteht Popper unter ‚Historizismus‘ eine Sozialphilosophie, welche die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft als determiniert ansieht, d.h. als auf ein bestimmtes Ziel oder Ergebnis ausgerichtet. Poppers ‚offene Gesellschaft‘ ist das Gegenteil dieser Vorstellung.
Zunächst eine Auslegeordnung dessen, was Popper unter Historizismus versteht:
«Es ist eine weitverbreitete Ansicht, dass eine wahrhaft wissenschaftliche oder philosophische Haltung der Politik gegenüber und ein tieferes Verständnis des Soziallebens im allgemeinen auf einer Betrachtung und Deutung der menschlichen Geschichte beruhen muss. Während der gewöhnliche Mensch den Rahmen seines Lebens und die Bedeutung seiner persönlichen Erfahrungen und kleinlichen Sorgen als gegeben hinnimmt, sagt man, der Sozialwissenschaftler oder Philosoph betrachtet die Dinge von einer höheren Warte aus. Für ihn ist das Individuum eine Schachfigur, ein ziemlich unbedeutendes Instrument in der allgemeinen Entwicklung der Menschheit. Und er findet, dass die wahrhaft bedeutenden Schauspieler auf der Bühne der Geschichte entweder die Grossen Nationen und ihre Grossen Führer sind, oder vielleicht die Grossen Klassen, oder die Grossen Ideen. … Wie dem auch sei – er wird versuchen, den Sinn des Spiels zu begreifen, das auf der historischen Bühne aufgeführt wird; er wird versuchen, die Gesetze der historischen Entwicklung zu verstehen. Und wenn ihm das gelingt, so wird er wohl auch zukünftige Entwicklungen voraussagen können. Er kann dann die Politik auf eine solide Grundlage stellen und uns praktische Anweisungen geben, indem er uns mitteilt, welche politischen Handlungen aller Wahrscheinlichkeit nach erfolgreich sein werden und welche nicht.
Das ist die kurze Umschreibung einer Einstellung, die ich Historizismus nenne. Dieser ist eine alte Idee oder vielmehr eine lose verbundene Gruppe von Ideen, die, unglücklicherweise, so sehr ein Teil unserer geistigen Atmosphäre geworden sind, dass sie gewöhnlich als gegeben hingenommen und kaum je in Frage gestellt werden.» (Seite 12)
Das Gegenteil des Historizismus nennt Popper ‚Sozialtechnik‘, die er so definiert oder umschreibt:
«Der Sozialtechniker stellt keine Fragen über die historischen Tendenzen oder über das Geschick der Menschen. Er hält den Menschen für den Herrn seines eigenen Geschicks, und er glaubt, dass wir ebenso, wie wir das Antlitz der Erde verändert haben, auch die Geschichte der Menschen in Übereinstimmung mit unseren Zielen beeinflussen oder verändern können; der Sozialtechniker glaubt nicht, dass uns diese Ziele durch unseren historischen Hintergrund oder durch geschichtliche Tendenzen auferlegt werden; er ist vielmehr der Ansicht, dass sie von uns selbst gewählt oder sogar geschaffen sind, ebenso, wie wir neue Gedanken, neue Kunstwerke, neue Häuser oder neue Maschinen schaffen. Im Gegensatz zum Historizisten, der meint, dass verständiges politisches Handeln allein dort möglich sei, wo der zukünftige Verlauf der Geschichte zuerst bestimmt worden ist, hat der Sozialtechniker von einer wissenschaftlichen Basis der Politik eine ganz andere Vorstellung; diese Basis besteht für ihn in der Kenntnis von Tatsachen, die für die Konstruktion oder Änderung sozialer Institutionen in Übereinstimmung mit unseren Wünschen und Zielen notwendig sind. Eine derartige Wissenschaft hätte uns mitzuteilen, welche Schritte wir unternehmen müssen, um zum Beispiel Depressionen zu vermeiden oder zu erzeugen, oder um eine mehr oder weniger gleichmässige Verteilung des Wohlstandes herzustellen. Mit anderen Worten: Der Sozialtechniker hält eine Art sozialer Technologie für die wissenschaftliche Basis der Politik (Platon, wie wir sehen werden, vergleicht diese Basis mit dem wissenschaftlichen Hintergrund der Medizin); im Gegensatz dazu sieht der Historizist in der Politik eine Wissenschaft von unveränderlichen historischen Tendenzen.» (Seite 29)
Popper unterscheidet bei den Sozialtechnikern klar zwischen einer Sozialtechnik der auf ‚trial and error‘ basierenden ‚kleinen Schritte‘ und einer auf ein (durch die a priori feststehende historizistische Entwicklungsrichtung der Gesellschaft) bestimmtes Ziel ausgerichteten ‚Utopie‘. Es wird später darzulegen sein, warum Popper die erste befürwortet und die zweite ablehnt.
Im Zentrum von Poppers Betrachtungen zu Platons Soziallehre stehen folgende Punkte:
- Für Platon beginnt die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft mit einem von den Göttern geschaffenen vollkommenen und deshalb unvergänglichen Staat. Es handelt sich dabei um ein Königtum der weisesten und gottähnlichsten Menschen. Vorbilder dazu sieht er in den zu seinen Lebzeiten noch existierenden Staaten Sparta und Kreta. Diese Staaten verlieren ihre Vollkommenheit, weil sich ihre Führungseliten in Unfrieden zerstreiten. Innerer Wettstreit, befeuert von Selbstsucht und materiellem oder ökonomischem Selbstinteresse, führt zur Verderbnis.
PS: Den Widerspruch, der zwischen der initialen Vollkommenheit und dem durch Unfrieden ausgelösten Zerfall liegt, löst Platon leider nicht auf.
- Daraus entsteht die Timarchie oder Timokratie, die Herrschaft der Vornehmen, die nach Ehre und Ruhm streben.
- Diesen wiederum folget die Oligarchie, die Herrschaft der reichen Familien.
- Nächste Entwicklungsstufe – zum Schlechteren – ist die Demokratie, die Herrschaft der Freiheit, für Platon gleichbedeutend mit der Herrschaft des Chaos und der Gesetzlosigkeit.
- Schliesslich kommt die Tyrannei, die vierte und endgültige Krankheit des Staatswesens.
- Aus dieser Sequenz: «Vollkommenheit des Staatswesens (göttliche Ordnung) ➯ Timokratie ➯ Oligarchie ➯ Demokratie ➯ Tyrannei» folgert Platon, dass jede Veränderung – von einem Zustand der Perfektion aus – zwangsläufig eine Verschlechterung sein muss, also dass Veränderung an sich etwas Schlechtes, Negatives ist; etwas Vollkommenes kann sich nicht zu etwas noch vollkommenerem verändern. Geschichte ist also für Platon eine Geschichte des sozialen Zerfalls.
Der zwangsläufige durch Veränderung des Vollkommenen entstehende Zerfall ist der rote Faden von Platons Historizismus. Das ‚Ziel‘ der sozialen Entwicklung ist gewissermassen der Selbstmord. Andere Arten des Historizismus gehen von anderen Ausgangspunkten und entsprechend anderen Zielen aus; allen Spielarten ist jedoch gemeinsam, dass sie der sozialen Entwicklung schicksalhafte Ziele oder Entwicklungsrichtungen unterstellen, die von den Menschen letztlich nicht beeinflusst werden können.
Die wichtigsten dieser anderen Arten des Historizismus beschreibt Popper in Band II von «Die offene Gesellschaft und ihre Feinde». Und das Gegenteil eines historizistischen Weltbildes behandelt Popper in Band I, Kapitel 10.
- Die detaillierte Auseinandersetzung Poppers mit Platons Weltbild und Staatsphilosophie (Band I, Kapitel sechs bis neun) mag für Philosophie-Historiker oder Antikenforscher von grosser Bedeutung und hohem Interesse sein – mein Fassungsvermögen übersteigt sie. Ich halte sie auch für die heutige Auseinandersetzung über Fragen der Gestaltung der Staatswesen für irrelevant, weil sie zwangsläufig von den tatsächlichen Zuständen der griechischen Stadtstaaten im 4. und 5. Vorchristlichen Jahrhundert geprägt sind.
Popper sieht in folgenden Elementen die wesentlichen Grundlagen für ‚seine‘ offene Gesellschaft:
- Natur und Konvention (Kapitel 5):
Popper postuliert eine bewusste und klare Unterscheidung von Naturgesetzen (à la Schwerkraft) und normativen Gesetzen (à la «Du sollst nicht töten!»).
Naturgesetze sind durch die Natur gegeben, bis sie widerlegt oder falsifiziert sind. Entschlüsse, etwas zu tun, was diesen Gesetzen widerspricht, sind sinnlos, weil sie nicht umsetzbar sind.
Normative Gesetze sind menschengemacht; entweder sind sie durch Entwicklungsprozesse von Gesellschaften spontan entstanden und von diesen Gesellschaften unbewusst respektiert oder bewusst anerkannt und akzeptiert, oder sie sind das Ergebnis bewusster Deliberations- oder Gesetzgebungsprozesse. Sie sind keinesfalls gottgegeben und unabänderlich. Jeder Mensch, auch wenn er an der Entwicklung dieser Normen nicht beteiligt ist, hat zu entscheiden, ob er eine Norm für richtig hält und einhalten will, oder ob er sie ändern will; er ist für diese Entscheidung verantwortlich. Popper hält die Haltung, eine Norm nur deshalb einzuhalten, weil die Religion es so vorschreibt, für eine moralisch schwache Begründung.
- (totalitäre) Gerechtigkeit (Kapitel 6)
Platons politisches Programm beruht auf folgenden zwei Maximen:
-
- «Bringt jegliche politische Veränderung zum Stillstand!
Veränderung, Bewegung ist übel, Ruhe göttlich; es ist möglich, der Veränderung Einhalt zu gebieten, wenn der Staat als eine genaue Kopie seines Urbildes, der Form oder Idee des Staates aufgebaut wird.» (Seite 104) - Das lässt sich durchführen mit der naturalistischen Formel: «Zurück zur Natur!» Zurück zum ursprünglichen Staat unserer Vorfahren, zurück in den primitiven Staat, der in Übereinstimmung mit der menschlichen Natur gegründet wurde und der deshalb beständig ist; zurück zum Stammespatriarchat der Zeit vor dem Niedergang, zur natürlichen Klassenherrschaft der weisen Wenigen über die unwissenden Vielen.» (Seite 104)
- «Bringt jegliche politische Veränderung zum Stillstand!
Diese Vorstellung basiert ihrerseits auf folgenden Voraussetzungen:
-
- strenge Klassenteilung, d.h. dass die herrschende Klasse, bestehend aus Hirten und Wachhunden, streng vom menschlichen Herdenvieh geschieden werden muss
- Identifikation des Schicksals des Staates mit dem Schicksal der herrschenden Klasse
- Monopol der herrschenden Klasse über Dinge wie kriegerische Tugenden und militärische Ausbildung; sie allein trägt Waffen, hat Anspruch auf Erziehung jeglicher Art; ist aber von der Teilnahme an wirtschaftlichen Tätigkeiten, insbesondere am Geldverdienen gänzlich ausgeschlossen
- Zensur kontrolliert gesamte intellektuelle Tätigkeit der herrschenden Klasse; unausgesetzte Propaganda prägt deren Gedanken und schaltet gleich; alle Neuerungen in Erziehung, Gesetzgebung und Religion sind zu verhindern oder zu unterdrücken
- selbstversorgender Staat; ökonomische Autarkie; Vermeidung jeglicher Abhängigkeit von Händlern
Popper nennt ein solches politisches Programm ‚totalitär‘. Platons Qualifikation dieses Programms als ‚gerecht‘ lehnt er kategorisch ab. Er kontrastiert die Vorstellung von Gerechtigkeit von Platon mit einer, die er schon für Platons Epoche für repräsentativ hält; sie zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: gleiche Verteilung der Lasten der Staatsbürgerschaft; gleiche Behandlung für Bürger vor dem Gesetz; Gesetze, die einzelne Bürger oder Gruppen oder Klassen weder begünstigten noch benachteiligen; Unparteilichkeit der Gerichte; gleicher Anteil an den Vorteilen (und natürlich auch Nachteilen), welche die Mitgliedschaft im Staat dem Bürger zu bieten vermag.
Er argumentiert überzeugend, dass Platons politisches Programm einem solchen Gesellschaftsmodell diametral entgegengesetzt ist und führt dessen Gerechtigkeitsbegriff mit folgender Formel ad absurdum: «… dass der Staat gerecht ist, sobald der Herrscher herrscht, der Arbeiter arbeitet und der Sklave front.» (Seite 109)
Zwischenbemerkung:
Für mich ist schleierhaft, wie Platon – noch zu meiner Gymnasialzeit – als Urvater der Philosophie und Ethik gelten konnte. Entweder hat Popper mit seiner Analyse recht, dann gehört Platon in die Geschichte der menschlichen Irrtümer und Irreführungen (‚fake‘ Geschichtsschreibung?), oder Popper hat unrecht, dann gehört «Die offene Gesellschaft und ihre Feinde» auf das Podest der verführerischsten Streitschriften. Ein kurzes Nachschlagen bei Wikipedia zeigt, dass mehr für die erste Variante (Popper hat recht) spricht als für die zweite.
Im Abschnitt «Rezeption» des in die Kategorie ‚exzellenter Beitrag‘ aufgenommenen Essays über Platon kommt u.a. Nietzsche mit folgendem vernichtenden Urteil zu Wort:
«Plato wirft, wie mir scheint, alle Formen des Stils durcheinander, er ist damit ein erster décadent des Stils: er hat etwas Ähnliches auf dem Gewissen, wie die Cyniker, die die satura Menippea erfanden. Dass der Platonische Dialog, diese entsetzlich selbstgefällige und kindliche Art Dialektik, als Reiz wirken könne, dazu muss man nie gute Franzosen gelesen haben, – Fontenelle zum Beispiel. Plato ist langweilig. – Zuletzt geht mein Misstrauen bei Plato in die Tiefe: ich finde ihn so abgeirrt von allen Grundinstinkten der Hellenen, so vermoralisirt, so präexistent-christlich – er hat bereits den Begriff ‚gut‘ als obersten Begriff –, dass ich von dem ganzen Phänomen Plato eher das harte Wort ‚höherer Schwindel‘ oder, wenn man’s lieber hört, Idealismus – als irgend ein andres gebrauchen möchte.»
Zu Poppers Beurteilung von Platon heisst es:
«Während des Zweiten Weltkriegs verfasste Karl Popper, der Begründer des Kritischen Rationalismus, unter dem Eindruck der damaligen politischen Verhältnisse eine fundamentale Kritik an Platons Staatstheorie. Er sah den platonischen Idealstaat als Gegenmodell zu einer demokratischen, offenen Gesellschaft, deren Vorkämpfer Perikles gewesen sei, und behauptete, Platon habe die Lehren des Sokrates pervertiert und ins Gegenteil verkehrt. Platon habe die Suche nach einer überlegenen Staatsordnung auf die Machtfrage reduziert, statt nach Institutionen zu fragen, die Herrschaft begrenzen und dem Machtmissbrauch vorbeugen können. Mit seinem Konzept eines kleinen, statischen, abgeschlossenen Ständestaats sei er ein Vorläufer des modernen Totalitarismus und Feind des Individualismus und der Humanität. Ausserdem wandte sich Popper gegen den unwandelbaren Charakter der platonischen Idee des Guten. Seine Streitschrift löste eine lebhafte Debatte aus.»
Leider fehlt eine Aussage zu Ergebnis oder Stand dieser ‚lebhaften Debatte‘.
Zu Platons politischem Programm gehören auch Überlegungen zum ‚Führertum‘ und Anleitungen für Auswahl und Ausbildung der ‚besten‘ und ‚weisen‘ Führer (Kapitel 7. Popper entlarvt Platons Fokussierung auf personelle Fragen («Wer soll herrschen?», oder «Wessen Wille soll der höchste sein?») als einerseits völlig nutzlos und fehlgeleitet, weil sie in letzter Konsequenz nichts anderes ist als der Versuch, die Privilegien der obersten Gesellschaftsschicht als unabänderlich zu zementieren. Platons Sicht von ‚Führung‘ ist verbrämter, aber in der Wolle eingefärbter Elitarismus und Totalitarismus. Popper empfiehlt, die Frage der Führung sowohl personell als auch institutionell zu sehen. Er empfiehlt, davon auszugehen, dass politische Führer a priori nicht immer hinreichend gut oder weise sind. Deshalb sollte politisches Denken von Anfang an von der Möglichkeit schlechter Regierungen ausgehen und die Frage «Wer soll regieren?» durch die neue Frage ersetzen: «Wie können wir politische Institutionen so organisieren, dass es schlechten oder inkompetenten Herrschern unmöglich ist, allzu grossen Schaden anzurichten?» (nach dem Motto: prepare for the worst, hope for the best)
In diesem Zusammenhang behandelt Popper auch das ‚Paradox der Freiheit‘ (die Möglichkeit, dass die Freiheit mit den Mitteln der Freiheit, oder die Demokratie mit demokratischen Mechanismen abgeschafft oder ausgehebelt wird). Er zeigt dabei, dass Platons Idee, dieses Paradox könne nur dadurch beherrscht werden, indem allein die besten Führer (selbstverständlich aus der obersten Schicht der Adligen und Weisen von Geburt oder Stand aus legitimiert) Gewähr dafür bieten, dass das beste aller Systeme nicht korrumpiert werden kann, ein Zirkelschluss ist.
In Kapitel 8 setzt sich Popper mit Platons Vorstellung vom ‚königlichen Philosophen‘ auseinander. Seine Basis ist Platons Vorstellung vom ‚vollkommenen Staat’:
- die von den Göttern gegebene Idee oder Urform einer Staatsordnung, die vollkommen ist und also durch Veränderungen nur verschlechtert werden kann
- die These, dass Menschen ein vollkommenes Staatswesen nur als Abbild dieser Urform nachbilden können, und
- das Postulat, dass nur Philosophenkönige oder königliche Philosophen dies vollbringen können, weil nur sie in die göttlichen Geheimnisse der Urform eingeweiht sind
Popper setzt sich ausführlich mit Platons Argumenten auseinander; er seziert sie und entlarvt sie als rassistisch, totalitär und irrational (weil schon die Grundlage von Platons Vorstellung haltlos ist und keinerlei rationale Begründung hat). Poppers Fazit spricht für sich:
«Welch ein Monument menschlicher Kleinheit ist diese Idee des Philosophenkönigs! Welch ein Gegensatz zwischen ihr und der Einfachheit und Menschlichkeit des Sokrates, der den Staatsmann vor der Gefahr warnte, von seiner eigenen Macht, Vortrefflichkeit und Weisheit geblendet zu werden, und der ihn die wichtigste Einsicht zu lehren versuchte, dass wir doch alle nur schwache, fehlbare Menschen sind. Welcher steile Abstieg aus dieser Welt der Ironie, der Vernunft und der Wahrhaftigkeit hinab zu Platons Königtum des Weisen, den seine magischen Kräfte hoch über die gewöhnlichen Menschen erheben; wenn auch nicht hoch genug, um auf den Gebrauch von Lügen zu verzichten oder auf das traurige Gewerbe des Schamanen – auf den Verkauf von Zauberformeln, von Züchtungs- oder Paarungszaubern, im Austausch für Macht über seine Mitmenschen.» (Seiten 185-186)
In Kapitel 9 beschäftigt sich Popper mit Platons Ästhetizismus, Perfektionismus, Utopismus. Er subsumiert darunter seine Theorie zur Sozialtechnik. Er unterscheidet dabei – wie schon früher erwähnt – zwischen einem Ansatz des langfristigen, gesamtheitlichen ‚social engineering‘ einerseits und einem pragmatischen Anpassen der Gesellschaftsordnung in kleinen Schritten anderseits. Er demontiert «die Methode des Planens im grossen Stil, die utopische Sozialtechnik, die utopische Technik des Umbaus der Gesellschaftsordnung oder die Technik der Ganzheitsplanung» und zeigt, dass sie – wenn auch von ganz unterschiedlichen Startpunkten ausgehend – als im Kern historizistisch, durch und durch totalitär und irrational ist. Popper anerkennt ausschliesslich eine Sozialtechnik als rational, die von Fall zu Fall angewendet wird, die Einzelprobleme angeht und nach dem Prinzip von ‚trial and error‘ löst, die einen schrittweisen Umbau der Gesellschaftsordnung anstrebt, kurz: die Sozialtechnik der kleinen Schritte.
«Die utopische Technik ist um so gefährlicher, als es den Anschein erwecken könnte, dass sie im klaren Gegensatz zu einem ausgesprochenen Historizismus steht, zu einem radikal historizistischen Vorgehen, das voraussetzt, dass wir den Lauf der Geschichte nicht ändern können; gleichzeitig scheint sie die notwendige Ergänzung eines weniger radikalen Historizismus, wie etwa des platonischen, darzustellen, der menschliche Einwirkung zulässt.»
Popper beschliesst dieses Kapitel mit folgender Analyse: «Der Ästhetizismus und der Radikalismus müssen uns dazu führen, die Vernunft über Bord zu werfen und sie durch eine verzweifelte Hoffnung auf politische Wunder zu ersetzen. Diese irrationale Einstellung, die sich an Träumen von einer schönen Welt berauscht, nenne ich Romantizismus. Der Romantizismus mag sein himmlisches Staatswesen in der Vergangenheit oder in der Zukunft suchen; er mag ‚Zurück zur Natur‘ predigen, oder ‚Vorwärts zu einer Welt von Liebe und Schönheit‘; aber er wendet sich immer an unsere Gefühle und niemals an unsere Vernunft. Sogar mit der besten Absicht, den Himmel auf Erden einzurichten, vermag er diese Welt nur in eine Hölle zu verwandeln – eine jener Höllen, die Menschen nur für ihre Mitmenschen bereiten.» (alle hier zitierten Stellen auf Seiten 187/188)
Im Kapitel 10 kommt Popper (endlich?) zur Sache, jedenfalls zum Thema, das im Titel seines Buchs angekündigt wird, nämlich zur offenen Gesellschaft und ihren Feinden.
Zuerst beschreibt Popper, was er unter ‚geschlossener‘ oder ‚offener‘ Gesellschaft versteht.
Eine geschlossene Gesellschaft hat folgende Eigenschaften oder Merkmale:
- Ähnlichkeit zu Stammesgesellschaften (z.B. Maori), kleine Kriegerbanden, die gewöhnlich in befestigten Siedlungen leben; von Stammeshäuptlingen oder Königen oder von aristokratischen Familien regiert, häufig im Krieg mit anderen Stammesgesellschaften
- magische und irrationale Einstellung zu Gebräuchen des sozialen Lebens und entsprechende Starrheit dieser Gebräuche; keine Unterscheidung zwischen gewöhnlichen oder konventionellen Regelmässigkeiten des sozialen Lebens und solchen, die sich in der Natur finden; Glaube, dass beide Arten von einem übernatürlichen Willen aufgezwungen sind
- alle Aspekte des Lebens von Tabus geregelt und beherrscht; kaum Zweifel, wie man handeln soll; richtiger Weg stets vorgezeichnet; Institutionen lassen kaum Raum für persönliche Verantwortung
Im Gegensatz dazu zeichnen sich offene Gesellschaften aus durch:
- klare Unterscheidung zwischen Gesetzen des Staates und gewohnheitsmässig beobachteten Tabus; grosses sich stets erweiterndes Feld persönlicher Entscheidungen, welche zu Änderungen von Tabus oder zur Änderung von politischen Gesetzen führen, die eben keine Tabus mehr sind
- Möglichkeit der rationalen Betrachtung dieser Dinge; Einsicht, dass die ‚beste Verfassung‘ den Charakter eines Problems hat, das sich rational diskutieren lässt
- Bewusstsein, dass Menschen rationale Entscheidungen treffen können, welche die Erwünschtheit oder Unerwünschtheit neuer Gesetze oder anderer institutioneller Veränderungen betreffen, und die auf einer Abschätzung von Konsequenzen und einer bewussten Bevorzugung einiger von ihnen beruhen
- Anerkennung einer rationalen persönlichen Verantwortung
Für Popper ist der Übergang von der geschlossenen zur offenen Gesellschaft eine der grössten Revolutionen, die die Menschheit durchgemacht hat. Dieser Übergang muss von den Menschen, die ihn durchmachen, als schwere Erschütterung empfunden werden. Er verortet den Beginn dieses Übergangs, also dieser Revolution (die er immer noch im Anfangsstadium sieht) bei den Griechen – zeitlich zwischen dem 6. und dem 4. vorchristlichen Jahrhundert. Der Übergang war nicht schmerzlos; es gab zeitweise heftigen Widerstand gegen die Auflösung der alten Stammesform und durchaus kriegerische Versuche, die begonnene Entwicklung zum Stillstand zu bringen. Aber die offene Gesellschaft setzte sich langsam durch, entwickelte sich zur grossen geistigen Revolution, zur Erfindung der kritischen Diskussion und damit zu einem Denken, das frei war von der Starrheit magischer Zwangsvorstellungen. Popper sieht aber auch, dass daraus ein neues Unbehagen entstand. Die inneren Spannungen der Zivilisation und die Last ihrer Anforderungen begannen fühlbar zu werden. (Seite 210) Die Last, das Unbehagen, diese inneren Spannungen sieht er als Folge des Zusammenbruchs der geschlossenen Gesellschaft (und wirken auch heute noch; Stichwort ‚Selbstentfremdung der Menschen‘). Sie entsteht primär dadurch, dass das Leben in einer offenen, teilweise abstrakten Gesellschaft dauernd von uns verlangt, vernünftig zu handeln; zumindest einige unserer emotionalen und natürlichen sozialen Bedürfnisse unbefriedigt zu lassen und Verantwortung für sich und andere zu tragen.
Der Wendepunkt der Geschichte unserer Zivilisation wurde durch eine Generation griechischer Denker und Staatmänner ermöglicht, die Popper die ‚Grosse Generation‘ nennt. Die wichtigsten Exponenten sieht Popper in Perikles, Demokrit, Sokrates und Perikles. Er charakterisiert diese, vor allem mit Zitaten, auf Seiten 220-222. Den Hauptbeitrag leistete gemäss Popper Sokrates, dessen genialster Schüler Platon werden sollte. Das Paradoxon, dass Sokrates ein entscheidender Verfechter der offenen Gesellschaft gewesen sein soll, und sein ‚genialster Schüler‘, Platon, ein noch vehementerer Gegner ebendieser Gesellschaftsform, löst Popper fast versöhnlich so auf: Platon sah in seinem Innersten, dass es eine wirklich geschlossene Gesellschaft nicht geben konnte; um sein Werben für die geschlossene Gesellschaft, das er in seinen Werken theoretisch begründet hat, nicht widerrufen zu müssen, deutet er die völlig gegensätzlichen Lehren von Sokrates zu seinen Gunsten um. So wurde es für ihn möglich, «den Lehren des einflussreichsten Mitglieds der Grossen Generation Schritt für Schritt einen neuen Sinn zu geben und sich selbst zu überreden, dass dieser Gegner, dessen übermächtige Kraft er nie direkt anzugreifen gewagt hätte, eigentlich ein Bundesgenosse war» (Seite 233). Popper sieht Platon als «Zeugen eines inneren Konflikts, eines wahrhaft gigantischen Kampfes in Platons Verstand (ebenda)».
Popper will damit Platon nicht ‚rehabilitieren‘. Er sucht – und findet – in seiner Deutung lediglich eine plausible Erklärung dafür, dass sich Platon, der am Anfang des Übergangs von der geschlossenen zum Entstehen einer offenen Gesellschaft stand, und der dabei auch wegen seiner privilegierten Herkunft am Verlust ehemaliger tabuisierter gesellschaftlicher Gewissheiten und an der Ablösung dieser Gewissheiten durch die Rationalität leiden musste, dieses Leiden für sich persönlich nur durch eine Umdeutung der rationalen Erkenntnisse erträglich machen konnte.
Für mich ist es fast unglaublich, dass ein Denker wie Platon, der – wenn Popper recht hat – im Kern ein ‚fake Philosoph‘ war, die europäische Sicht auf Entstehung und intellektuelle Rechtfertigung der Demokratie, auf Prinzipien wie Gleichheit vor dem Gesetz, Freiheit, Offenheit von Gesellschaften so massgebend prägen konnte.
Ich hätte Popper gerne schon in meinen Lehr- und Wanderjahren gelesen; am liebsten schon am Gymnasium. Meines Erachtens gehört Popper, im Originaltext oder in einer gekonnten Zusammenfassung und Würdigung, zur Pflichtlektüre für jeden Menschen, der an Gesellschafts-Philosophie interessiert ist, und erst recht für jeden Menschen, der sich politisch betätigen will.
PS:
Im Nachwort des Herausgebers (Hubert Kiesewetter) zur 8. Deutschsprachigen Auflage (2003, Mohr Siebeck), Seiten 502 – 531, wird anhand der Korrespondenz von Popper und seiner Ehefrau mit Freunden in den USA und England, berichtet, welche Schwierigkeiten Popper überwinden musste, um die englischsprachige Erstausgabe seines Werkes überhaupt publizieren zu können. Die Tatsache, dass er damals hochgeachteten Geistesgrössen an den Karren fuhr (to put it mildly), spielte dabei gewiss eine Rolle, aber eine Nebenrolle. Viel wichtiger in der damaligen Kriegszeit (1943 – 1945) waren sowohl in England als auch in den USA Faktoren wie: Papiermangel oder -rationierung; fehlende Arbeitskräfte für die Produktion von Büchern, insbesondere im Prozess der Herstellung von Büchern ab Druckbögen. Es dauerte damals rund 2 Monate, um einen Brief, geschweige denn ein Paket mit Hunderten von Manuskriptseiten) von Christchurch in Neuseeland, wo Popper damals als Universitätsdozent tätig war, in die USA und erst recht nach England zu transportieren. Und Popper war so mausarm, dass er den durchaus schon gebräuchlichen Telegramm-Kanal aus Kostengründen kaum nutzen konnte.
Es ist erstaunlich, dass die Publikation eines epochalen Werks beinahe an derartigen Banalitäten gescheitert wäre.
Heutigen Zeitgenossen, insbesondere jungen IT-natives, könnte es guttun, an diesem Beispiel zu lernen, dass die Welt einmal, d.h. vor erst 70-80 Jahren, anders ausgesehen hat.