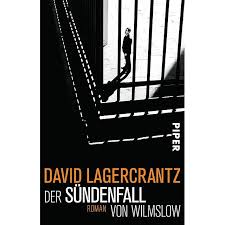
Vorbemerkung:
Der Autor, David Lagercrantz, erzeugte grosse Aufmerksamkeit, als er Stieg Larssons so genannte Millenium-Serie mit den ‚Helden‘ Mikael Blomquist und Lisbeth Salander fortsetzte und damit die Trilogie erweiterte. Ich habe keines dieser Bücher gelesen und bin also völlig unbelastet und unvoreingenommen an die Lektüre des Sündenfalls herangegangen.
Der Roman beginnt im Juni 1954, als Leonard Corell, der junge Mitarbeiter der englischen Kriminalpolizei in Wilmslow den Auftrag erhält, den Tod eines Alan Turing zu untersuchen. Turing war unter offensichtlich seltsamen Umständen ums Leben gekommen: alles sieht nach dem Selbstmord eines in Wilmslow kaum bekannten, zurückgezogen lebenden Exzentrikers aus. Allerdings handelt es sich, das wird im Rahmen der Untersuchungen der Todesursache schnell bekannt, bei Turing um einen Naturwissenschafter, der im zweiten Weltkrieg an einem geheimen Projekt Englands mitgearbeitet und sich für das Land verdient gemacht und dafür den OBE erhalten hatte. Aber: Turing war vor einigen Jahren wegen seiner Homosexualität verurteilt worden – in den 1950-er Jahren war dies in England und den meisten europäischen Ländern noch eine Straftat –; deshalb war er von der englischen Gesellschaft ausgegrenzt und de facto inexistent.
«Der Sündenfall von Wilmslow» ist ein seltsames Buch. Zuerst kommt es wie eine stinknormale Detektivgeschichte daher, in der es in erster Linie darum geht, die Ursache des Todes von Turing zu klären: Mord oder Selbstmord? Klar ist, dass er an einer Zyanid-Vergiftung verstorben ist; er hat von einem mit Blausäure durchtränkten Apfel gegessen.
Die Suche nach einer plausiblen Antwort ist aber ebenso durchtränkt mit der Seelensuche des jungen Polizisten. Corell ist voller Selbstzweifel über seine eigene Identität. Er kommt aus einer Familie, die einmal zur englischen ‚upper class‘ gehörte, aber wegen der Unfähigkeit seines eigenen Vaters, mit Geld umzugehen, verarmt ist. So verpasst er die klassentypische Ausbildung in Cambridge oder Eton. Sein Vater, ein Luftibus erster Klasse, war ein ziemlich angesehener Schriftsteller, belesen und geistreich, Gesellschaftslöwe, und dank seinem Eton-Cambridge-Hintergrund mit vielen Regierungsstellen und Home Office-Kadern bestens vernetzt. Er hatte sich selbst das Leben genommen, indem er sich vor einen Zug geworfen hatte. Corell möchte etwas werden, sieht sich auch immer wieder zu allem befähigt, stürzt aber auch immer wieder ab in die Tiefen des Sich-überfordert-Fühlens. Seine Unsicherheit bewirkt, dass er mit seinen Chefs, Kollegen und Kunden häufig kaum kommunizieren, ihnen nicht auf Augenhöhe begegnen und nicht in die Augen sehen kann. Gleichzeitig blitzen seine eben doch vorhandenen grossen Fähigkeiten immer wieder durch: er fällt auf mit brillanten Formulierungen, geistreichen und oft auch zynischen Wortwitzen, und mit einem Wissen, das bei einem einfachen Polizisten vom Land irgendwie deplatziert ist.
Bis die amtliche Todesursache offiziell festgestellt ist – Selbstmord –, plätschert der Roman langsam zwischen der Polizeiarbeit und der überpsychologisierten Selbstsuche Corells hin und her; dabei fordert er Leser und Leserinnen (von denen es bis zum Wendepunkt des Romans wohl nicht mehr viele geben dürfte) ganz schön heraus: er macht es richtig schwer, bei der Sache beziehungsweise beim Buch zu bleiben.
Der Wendepunkt ist die amtliche Verkündung der Todesursache Turings. Ab diesem Punkt erscheinen mehr und mehr Personen, die während der Kriegszeit, als Turing seine ‚Heldentaten‘ für England vollbrachte, mit ihm zusammengearbeitet oder ihn kennen gelernt hatten. Jetzt geht es nicht mehr um den Kriminalfall Turing, sondern um die Person Turing: Wer war er wirklich? Was bedeuten seine wissenschaftlichen und auch philosophischen Erkenntnisse für die Nachwelt? Wie ist er zu seinen Erkenntnissen gekommen? Aus welchen Quellen hat er sich genährt?
Der Roman wird ab hier zu einem Feuerwerk von Wissenschaft und Wissenschaftstheorie. Ausgelöst durch die Utopien von Turing, Menschen mit Maschinen zu kopieren, den Maschinen menschliches Denken und Urteilsvermögen beizubringen, werden Fragen der künstlichen Intelligenz, Robotik und generell der Grenzen menschlichen Erfindungsreichtums oder der Grenzen der menschlichen Suche nach Erkenntnis und Weisheit aufgeworfen und diskutiert. Der Roman wird damit zu einem äusserst unterhaltsamen, amüsanten und lehrreichen Seminar über ‚Gott und die Welt‘. Dass Corell dabei – das wird allerdings nur knapp angedeutet – sich selber findet, ist ein Bonus für diejenigen, die sonst den roten Faden verloren hätten.
Fazit:«Der Sündenfall von Wilmslow» ist eine genussreiche und bereichernde Lektüre für alle, die an Wissenschaft, am Diskurs über die Grenzen der Wissenschaft, über die Natur des Menschen und über den Umgang der Gesellschaft mit neuem Wissen interessiert sind – genau das Buch für Mitmenschen wie Hansjörg Anderegg und Jürgen Liedel!!!