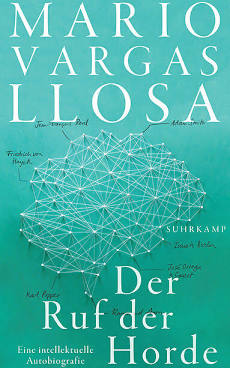
Raymond Aaron (1905-1983), Isaiah Berlin (1909-1997), sowie Jean-François Revel (1924-2006). Auf den ersten Blick sieht diese Liste nach einer sehr selektiven und voreingenommenen Auswahl aus; Llosa beschäftigt sich jedoch in diesen biografischen Einschüben auch sehr eingehend mit den inhaltlichen Gegenpositionen und Argumenten dieser Denker. Er kreiert aus der Gegenüberstellung des eigenen Lebens und seiner eigenen Entwicklung mit den Theorien und der Gedankenwelt seiner ‚Vordenker‘ und Vorbilder ein Gesamtbild, das eben seine eigene intellektuelle Autobiografie spiegelt.
Adam Smith (1723-17790) ist ein interessanter Einstieg in das Hauptthema von Llosa, d.h. in die Bedeutung der Freiheit für die Lebensqualität der Menschen. Wer wie ich Smith praktisch nur als Propheten der ‚unsichtbaren Hand‘ kennt, nimmt mit Erstaunen zur Kenntnis, dass Smith nicht ein Neoliberaler vor seiner Zeit war, sondern ein Sozialphilosoph, der sehr wohl die Notwendigkeit der sozialen Verantwortung und der Empathie erkannte und vertrat. In seinem Werk «Theorie der ethischen Gefühle» (1759) breitete er im Wesentlichen die Grundlagen seiner ‚Wissenschaft vom Menschen‘ aus, die sehr viel weiter und tiefer gehen als im allgemeinen Wissensstand über «Der Wohlstand der Nationen» bekannt ist.
Ortega y Gasset (1883-1955) gehört in meinen Augen eigentlich nicht in die Galerie vom Llosa – er ist zu sehr geisteswissenschaftlich und kulturell orientiert. Aber es ist doch interessant, ihn im Zusammenhang mit den Koryphäen der Freiheitsphilosophie näher kennen zu lernen.
Friedrich August von Hayek (1899-1992) und Karl Popper (1902-1994) sind allein schon durch die Titel ihrer Hauptwerke (Der Weg zur Knechtschaft, beziehungsweise Die Offene Gesellschaft und ihre Feinde) Programm und Leitidee. Die Einführung Llosas in diese Leuchtturmwerke der sozialphilosophischen und ökonomisch-politischen Literatur des 20. Jahrhunderts liefert jedoch zusätzlich wertvolle Informationen über das Gedankengut dieser beiden Verfechter der Freiheit, des Pluralismus und der Toleranz für andere Meinungen und Haltungen. Beide zeigen überzeugend, dass Freiheit die Grundlage jedes gedeihlichen zwischenmenschlichen Umgangs ist sowie der zwangsläufige Gegenpol zur Diktatur und zum Terror aller Gesinnungen, deren Ziel die Herstellung eines Paradieses auf Erden ist. Basis des Weltbilds dieser beiden Denker ist die Überzeugung, dass es kein vorherbestimmbares Ziel der Entwicklung der Gesellschaft geben kann (ausser die Paradies-Träume und -Phantome von Marxisten und Sozialisten, und teilweise sinngemäss gleich von Faschisten und Nationalisten), und dass Fortschritt nur möglich ist durch ‚Versuch und Irrtum‘ und kleine Schritte, die – wenn sie sich als Irrtum herausstellen – umgehend rückgängig gemacht oder korrigiert werden können, ohne dass ganze Welten zusammenbrechen und in Katastrophen münden.
Hayek und Popper weisen darauf hin, dass Kommunismus und Faschismus in dem Sinne konvergieren, als beide Etatismus (Staatsgläubigkeit) und Kollektivismus (Negierung der Bedeutung des Individuums) ins Zentrum ihrer Weltsicht stellen.
Interessant ist allerdings, dass – ausgerechnet der unerbittliche Verfechter der Freiheit und der Begrenzung des Staates – Karl Popper beim Thema Medien sich dafür stark macht, den Staat regulierend eingreifen zu lassen, um die Verbreitung von Dummheiten und Irrlehren zu verhindern. Allerdings erscheint die Antwort von Llosa, die Intelligenz der Menschen würde schon dafür sorgen, dass Exzesse von Medienverführung und ‚fake news‘ (er verwendet diesen Ausdruck nicht) sich im Verlauf der Zeit von selbst korrigieren, als ziemlich naiv und schlecht fundiert.
Hayek und Popper beschäftigen sich aus unterschiedlichen Blickwinkeln mit der Frage: Weshalb sind Weltanschauungen wie Marxismus und Sozialismus bei linken Denkern und generell bei Intellektuellen so beliebt; warum sind Intellektuelle mehrheitlich ‚links‘, wie wenn das die natürlichste Sache der Welt wäre. Llosa liefert dafür gute und nachvollziehbare Gründe. Allerdings – aus für mich nicht nachvollziehbaren Gründen – fehlt dabei der wichtigste, der in folgender Kausalkatte auf den Punkt gebracht werden kann: Intellektuelle wissen, oder meinen, es zu wissen, wie eine gute und gerechte Welt aussehen sollte; sie beanspruchen die hohepriesterliche Deutungshoheit für das Gute und Edle, das die Menschen anstreben sollten, und das diese glücklich machen würde; der ‚normale‘ Mensch ist nicht intelligent genug (oder schlicht und ergreifend zu dumm), selber darauf zu kommen, er muss zum Glück geführt werden; Vorstellungen oder Ideen für eine gerechte und gute Welt sind deshalb dem freien Meinungsmarkt zu entziehen; würde man die Entwicklung solcher gesellschaftliche Vorstellungen und Ziele dem Meinungsmarkt aussetzen, kämen ‚falsche‘ Ergebnisse zustande, die es um jeden Preis zu verhindern gilt; das Schlimmste an der Vorstellung, ein freier Meinungsmarkt könnte eine so wichtige Frage wie den wünschbaren Zustand der Welt beantworten, ist jedoch, dass damit das Privileg der Intellektuellen, also die hohepriesterliche Deutungshoheit für das Gute und Edle, verloren ginge. Links zu sein ist somit in letzter Konsequenz eine Machtfrage: Die linken Intellektuellen wollen die Macht, beziehungsweise die Deutungshoheit, wie eine gute und gerechte Welt, also das Paradies auf Erden, letztlich aussehen sollte, nicht aus der Hand geben; sie sehen sich im Besitz der einzig wahren und richtigen Meinung über den anzustrebenden Endzustand der Welt. Ihre Gegner, die Vertreter von Pluralismus und Freiheit, lehnen einen vorhersehbaren, wünschbaren und planbaren Endzustand der Zivilisation ab – das ist ihnen zu statisch und gegen alle Regeln der Evolution; sie glauben an den Weg von ‚Versuch und Irrtum‘, der schrittweise und kontinuierlich zu Verbesserungen führt; und sie glauben, dass es für alle am besten ist, wenn Notwendigkeit für Veränderungen sowie Natur und Richtung von Verbesserungen auf einem freien Meinungsmarkt erstritten und ausgehandelt werden. Sie akzeptieren die Imperfektion und sind gegen den Ersatz von Zufall durch den Irrtum. In letzter Konsequenz ist diese Kausalkette auch der Hintergrund dafür, dass Intellektuelle und Gesellschafts-Dogmatiker generell gegen den Markt sind und Markt für Teufelswerk ansehen. Denn, wo Markt ist, gibt es keine Deutungshoheit, sondern nur Mehrheiten und gesellschaftlich vereinbarte und durchgesetzte Spielregeln, keinen statischen und a priori dogmatisch festgelegten Endzustand, sondern nur kontinuierliche und nicht auf einen Endzustand ausgerichtete Veränderung. Die Intellektuellen wissen oder ahnen, dass ein freier Markt für Güter und Dienstleistungen auch auf Ideen überschwappen würde; und weil sie den Ideenmarkt ablehnen, und ihre Deutungshoheit nicht zu verlieren, lehnen sie die Idee ‚Markt‘ an sich ab. Markt ist für intellektuelle nicht nur gefährlich, weil er zu unerwünschten Zuständen führen könnte, sondern völlig überflüssig, weil sie es a priori besser wissen. Das ständige Klagen über Marktversagen ist auch ein direkter Beweis dafür, dass die linken Klagenden im ‚Konzept Markt‘ etwas sehen oder hineininterpretieren, was er nicht ist und per definitionem nicht sein kann: sie sehen im Markt ein Mittel zum Zweck. Der Markt ist jedoch nicht mehr, aber auch nicht weniger als ein Mechanismus zum Zusammenbringen von Angebot und Nachfrage, im Idealfall ein Ort, an dem eine ‚win-win-Verteilung‘ von Gütern entsteht. Ein Markt kann nicht versagen, sondern nur nicht stattfinden. Wenn das Ergebnis eines Markts nicht befriedigt, versagt nicht der Markt, dann versagen die Marktteilnehmer – allenfalls der Marktregulator
Raymond Aron (1905-1983) wird von Llosa als derjenige französische Intellektuelle vorgestellt, der zu seiner Zeit der Einzige war, der den Kommunismus selbst und die schon beinahe pathologische Nähe seiner Zeitgenossen (Sartre als wohl prominentester) zum Kommunismus blossstellte. Er wurde zu Lebzeiten vom politisch-geistigen Mainstream verkannt und ausgegrenzt, und auch nach seinem Tod, als sich die meisten seiner Analysen mit dem Untergang der Sowjetunion als richtig herausstellten, leider nicht aus der Versenkung hervorgeholt. Llosas Kurzporträt ist eine wertvolle Erinnerung daran, dass Freiheit und demokratische Werte es nicht nur verdienen, sondern dringend nötig haben, dass Menschen wie Aron für sie eintreten und auch ‚gegen den Wind‘ aktiv verteidigen. Auch wenn ich diese Zeit mindestens noch am Rande erlebt habe, erstaunt es noch immer, dass fast die vollständige geistige Elite einer Nation den Sirenenklängen des Kommunismus erliegen konnte und selbst die grössten Gräueltaten eines Stalin mit moralischem Ethos und Pathos verteidigten, weil sie ja einem guten Zweck dienten. Wer Beispiele für die Hohlheit, Verlogenheit und Selbstgerechtigkeit der Maxime «Der Zweck heiligt die Mittel.» sucht, ist bei Aron an der richtigen Adresse.
Ein sehr schönes Bonmot in Llosas Aron-Porträt ist eine Paraphrase eines Gedankens von Ortega y Gasset: Die Rechte und die Linke seien «zwei äquivalente halbseitige Lähmungen» (Seite 209).
Llosa entdeckte Isaiah Berlin (1909-1997) über dessen Marx-Buch. Berlin, lettischer Herkunft, wuchs in England auf und wurde in Oxford Professor für Sozialphilosophie und Politische Theorie, präsidierte die British Academy und «war einer der bemerkenswertesten Köpfe unserer Zeit, ein Denker von ausserordentlicher Gelehrtheit, dessen Texte zu lesen nicht nur ein seltenes Vergnügen ist, sie sind auch eine unschätzbare Hilfe, will man die moralischen und historischen Fragen unserer Zeit in ihrer ganzen Komplexität verstehen».
Die Kernthema für Berlin war die Erkenntnis, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Zielvorstellung haben, die miteinander unverträglich sind oder sich gar gegenseitig ausschliessen. Daraus schliesst er, dass «Pluralismus und Toleranz nicht nur moralische Imperative sind, sondern eine praktische Notwendigkeit für das Überleben der Menschen. Wenn es Wahrheiten gibt, die einander Feind sind, und Ziele, die einander negieren, müssen wir die Möglichkeit des Irrtums akzeptieren und den anderen gegenüber tolerant sein. Auch zugestehen, dass die Vielfalt – in Gedanken und Taten, Gebräuchen, Moralvorstellungen, Kulturen – unser einziger Garant dafür ist, dass der Irrtum, so er die Überhand gewinnt, nicht allzu grosse Verheerungen anrichtet, schliesslich gibt es nicht die eine Lösung für unsere Probleme, sondern viele, und sie alle sind ungewiss.» (Seiten 249-250).
Ein von ihm verwendetes typisches Beispiel für solche Zielkonflikte ist der dem Slogan der französischen Revolution «Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit» innewohnende Widerspruch zwischen Gleichheit und Freiheit. Sogar die französischen Revolutionäre mussten feststellen, «dass die Freiheit ein Quell von Ungleichheit ist» … also blieb «ihnen, wollten sie Gleichheit, nichts anderes übrig, als die Freiheit zu opfern und den Zwang einzuführen, die Überwachung und die allmächtige, alles nivellierende Aktion des Staates. Dass aber soziale Ungerechtigkeit der Preis für die Freiheit ist und die Diktatur der Preis für die Gleichheit – und dass Brüderlichkeit nur auf relative, vorübergehende Weise zu haben ist, aus negativem Anlass mehr denn aus positivem, bei einem Krieg etwa oder einer Naturkatastrophe, was die Bevölkerung solidarisch zusammenschweisst –, das ist ein trauriger Befund und schwer zu akzeptieren.» (Seiten 247-248)
Für Berlin sind nun widersprüchliche Wahrheiten kein Grund für Verzweiflung oder Gefühle der Machtlosigkeit; sie bedeuten nichts anderes, als dass wir uns über die Bedeutung der Wahlfreiheit – immer in untrennbarer Verbindung mit der Verantwortung – bewusst sein müssen.
Die letzte Koryphäe der Freiheit, die Llosa vorstellt, ist Jean-François Revel (1924-2006). Ich habe diesen Namen noch nie gehört; ob dies meiner persönlichen Ignoranz oder meiner fehlenden Vertrautheit mit der zeitgenössischen französischen Geisteswelt geschuldet ist, oder dem fehlenden Interesse meiner Hauptquellen (NZZ, The Economist, SRF, TA, Die Zeit, Der SPIEGEL) für zeitgenössisches Denken an der frankophonen Politik und Literatur, bleibe dahin gestellt. Auch nach der Lektüre dieses Kapitels kommt mir in der Liste der Vordenker, die Llosas Weg vom Kommunisten zum geradezu fanatischen Verfechter von Freiheit vorgespurt und begleitet haben, Revel eher wie ein Ausreisser oder Fremdkörper vor. Er ist nicht wie alle anderen Vorbilder ein eigenständiger Denker, sondern ‚nur‘ ein, wenn auch begnadeter und analytisch unanfechtbarer Berichterstatter, Kritiker, beissender Pamphletist, sozusagen ein Interpret von Gedanken anderer – gewissermassen wie András Schiff im Verhältnis zu Mozart oder Beethoven.
Trotzdem: ich zitiere die Einleitung zum Kapitel ‚Revel‘ im Originalton Llosas (Seiten 281-282):
«Wenn wir dem jüngeren Frankreich auf dem Gebiet der Ideen etwas Wertvolles verdanken, dann nicht die Strukturalisten, die Dekonstruktivisten oder die um Auffälligkeit bemühten, aber wenig konsistenten ‚neuen Philosophen‘. Das Prädikat gehört vielmehr einem Journalisten und politischen Essayisten: Jean-François Revel. Seine so besonnen wie ikonoklastischen, originellen wie bissigen Artikel und Bücher waren erfrischend, neben all den Stereotypen, Vorurteilen und konditionierenden Massnahmen, unter denen die politische Debatte erstickte. Mit seiner Unabhängigkeit und seiner Fähigkeit, wahrzunehmen, wann die Theorie nicht länger dem Leben folgt und es zu verraten beginnt; mit seinem Mut, den intellektuellen Moden zu trotzen, und seinem systematischen Eintreten für die Freiheit, wo immer sie bedroht oder entstellt wird, erinnert Revel an einen Albert Camus oder George Orwell in erneuertem Gewand. Wie bei ihnen war sein Kampf ein oft unverstandener und einsamer.
Vergleichbar dem Autor von 1984 zielte Revels härteste Kritik, auch wenn er einen nicht geringen Teil seines Lebens Sozialist war, auf die Linke, und von dieser Seite wurde er auch am heftigsten attackiert. In der Politik ist die Feindschaft unter den nächsten Verwandten nun mal am grössten. Aber wenn sich im intellektuellen Milieu jemand den heute so abgewirtschafteten Titel ‚fortschrittlich‘ verdient hatte, dann er, denn immer ging es ihm darum, die Klischees und geistigen Routinen aufzubrechen, die die jeweilige politische Avantgarde daran hinderten, die sozialen Probleme zu verstehen und radikale, aber auch praktikable Lösungen vorzuschlagen. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, entschied sich Revel – so wie Orwell in den Dreissigerjahren – für eine relativ einfache Haltung, auch wenn die herrschende Mode dagegensprach: zurück zu den Tatsachen, das Gelebte vor dem Gedachten. Die Gültigkeit einer politischen Theorie an der konkreten Erfahrung zu messen ist mittlerweile allerdings revolutionär, denn sehr viel verbreiteter und zweifellos auch der Klotz am Bein der Linken ist die gegenteilige Haltung: das Wesen der Fakten von der Theorie her zu bestimmen, bis die Fakten so weit verbogen sind, dass sie mit der Theorie übereinstimmen. … Dabei muss die politische Entfremdung schon sehr tief sein, wenn jemand, der bei seinen Überlegungen zur Gesellschaft den gesunden Menschenverstand ins Feld führt – denn nichts anderes tut, wer Ideen ein ums andere Mal an der konkreten Erfahrung misst – als geistiger Sprengmeister gilt.»
In meinen Augen ist Revel, den ich zukünftig auf dem Radar behalten werde, jedoch ein Fremdkörper und Aussenseiter, weil er kein originärer Verfechter der Freiheit war, sondern ein Sozialist. In Llosas Charakterisierung schimmert immer wieder durch, dass Revel seine linke Haltung nie aufgegeben hat, sondern zur Gruppe derjenigen Linken gehörte, die davon überzeugt blieben, dass der Sozialismus schon die weltrettende richtige politische Haltung wäre, dass er aber bisher immer und überall falsch praktiziert worden sei. Für mich sind ‚links‘ oder Sozialismus und Freiheit und Eigenverantwortung genauso unverträglich wie Feuer und Wasser. Und immerhin haben Hayek und Popper schon überzeugend nachgewiesen, dass Sozialismus, Kommunitarismus und Staatsgläubigkeit in letzter Konsequenz immer in die Diktatur oder Knechtschaft führen müssen.
Schlussbemerkung:
Die intellektuelle Biografie Llosas, «Der Ruf der Horde» (im spanischen Originaltext ist die Horde der ‚tribu‘, also der Stamm oder Clan) ist sehr lesenswert. Dank diesem Buch habe ich zum ersten Mal die Gedankenwelt von Adam Smith, Hayek, Popper oder Isaiah Berlin näher kennen gelernt. Wieviel davon authentisch ist, und wieviel davon Interpretation Llosas, kann ich natürlich nicht beurteilen – dies würde die Lektüre der Originaltexte voraussetzen. In Ermangelung eines zweiten Lebens werde ich darauf verzichten.
Trotz dieses Vorbehalts hat mich die Lektüre sehr bereichert. Und Llosa hat mich darin bestärkt, meine freiheitsbezogene politisch-gesellschaftliche Haltung nicht nur für mich zu behalten (siehe dazu auch meinen Wertekanon), sondern bei allen passenden und unpassenden Gelegenheiten mit Nachdruck zu vertreten und zu verteidigen.