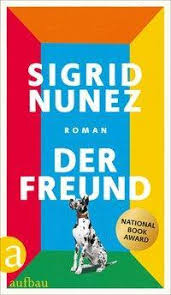
Der Roman erzählt eine auf den ersten Blick einfache Geschichte: eine namenlose Frau, Dozentin für ,creative writing’ an einer New Yorker-Hochschule und selbst Schriftstellerin, erfährt, dass ihr jahrzehntelanger Freund, ebenfalls Schriftsteller, zeitweise sehr erfolgreich, aber seit ein bis zwei Jahren ohne sichtbaren Output, sich das Leben genommen hat. Von seiner Ehefrau Drei erfährt sie, dass der Freund vor seinem Tod den Wunsch hinterlassen hat, dass sein schon ältlicher Hund, eine riesige Deutsche Dogge mit 80kg Lebendgewicht, von ihr, der namenlosen Frau, übernommen und betreut werden soll. Nachdem sie sich davon überzeugt hat, dass Ehefrau Drei schon alles versucht hat, aber erfolglos, für den Hund einen Platz zu finden, willigt sie widerstrebend ein, das Tier auf Zusehen hin zu übernehmen. Sie hat eine gut 40m2 kleine Wohnung in Manhattan, die für ein so grosses Tier viel zu klein ist, und in der sie keine Haustiere halten darf; sie riskiert also, die dank langjähriger Miete für Manhattan sehr kostengünstige Wohnung zu verlieren. Sie gewinnt den Hund mit dem sowohl passenden als auch prätentiösen Namen ‚Apollo’ mit der Zeit sehr lieb, so lieb, beinahe abgöttisch lieb, dass sie ihn wie einen menschlichen Gesprächspartner ‚auf Augenhöhe‘ behandelt. Obwohl Apollo krank ist und immer stärker altersschwach wird und sich kaum mehr bewegen kann, will und kann sie sich von ihm nicht mehr trennen. Der Roman endet damit, dass er während eines Aufenthalts auf Long Island, im leerstehenden Haus eines Bekannten, stirbt.
Dazwischen passiert fast nichts, jedenfalls nichts Nennenswertes. Der Inhalt besteht aus willkürlich aneinander gereihten Episödchen und Episoden, aus erinnerten Dialogen zwischen der namenlosen Frau, ihrem toten Freund, Ehefrauen Eins und Drei (mit Ehefrau Zwei kann sie’s nicht), und Schriftsteller- und Dozentenkolleginnen und -kollegen, und vor allem in inneren Dialogen zwischen ihr und dem Hund Apollo. Die einzelnen kleinen Episoden sind entweder an solchen Dialogen, an ähnlichen anthropomorphierten Erinnerungen an frühere Hauskatzen, oder an zahllosen Zitaten von älteren und zeitgenössischen Geistesgrössen ‚aufgehängt‘. Die Autorin beweist damit ihre grenzenlose Belesenheit, aber gleichzeitig entlarvt sie sich als eine Person, die kaum eigene und selbständige Gedanken über das Leben, über Gott und die Welt hat. Das ist sprachlich durchaus gekonnt, auch wenn der Stil (viele unvollständige Sätze, ständiges Spiel mit Personen, die nicht eindeutig bestimmt sind (es ist häufig nicht auf Anhieb klar, ob jetzt die Autorin selbst sich äussert oder ob sie Gedankengänge von jemand anderem wiedergibt) die Lektüre eher erschwert und mühsam macht.
Der Roman ist auch die wahrscheinlich unfreiwillige Verkörperung einer Blase, in der die namenlose Frau lebt. Die Blase ist das Milieu der New Yorker Intelligenzia, der Literaten, Journalisten, Kinokritiker, Schriftsteller und Galeriebesucher. Er spielt sich vollständig in dieser Blase ab. Der Hausmeister, der auch vorkommt, gehört als ‚Mobiliar‘ natürlich auch dazu, auch wenn er als Person ein Fremdkörper ist.
Ein roter Faden, der sich durch den ganzen Roman hindurchzieht, ist das Thema ‚Selbstmord‘. Fast alle Personen, die – wenn auch nur am Rande – im Roman vorkommen, haben sich das Leben genommen. Auch in den Gesprächen zwischen der namenlosen Frau und ihrem toten Freund ist der Suizid ein zentrales, obsessives Thema.
Vollends ein Ärgernis ist, dass Nuñez die im Roman vorkommenden Tiere (nicht nur Apollo, sondern auch andere Hunde und Katzen, einschliesslich Hunde und Katzen, die sie früher als Haustiere gehalten hat) auf penetrante und teilweise abstossende Art und Weise anthropomorphiert. Es mutet jedenfalls sehr seltsam an, dass eine Universitätsdozentin den Tod ihres Freundes und viele frühere und aktuelle Episoden ihres Lebens nur durch ihre Liebe zu einem Hund verarbeiten und annehmen kann.
Per Saldo ist der Roman für mich im Kern nichts anderes als eine Fingerübung in ‚creative writing‘. Die einzelnen Episoden haben kaum einen inneren Zusammenhang oder Zusammenhalt; sie sind willkürlich zusammengestellt, wie separat entstandene Schreibübungen. Für mich ist vollends unverständlich, dass dieses Buch von der New York Times im Klappentext emphatisch gerühmt wird: «Mit ‚Der Freund‘ ist Sigrid Nuñez über Nacht berühmt geworden als Titanin der amerikanischen Gegenwartsliteratur.» Dies wird noch überboten von Gary Shteyngarts Urteil: «Eine der schwindelerregend genialsten Autorinnen überhaupt.»
Zum Glück haben sowohl die New York Times als auch Gary Shteyngart unrecht! «Der Freund» ist bestenfalls gut geschriebener intellektueller Schund.