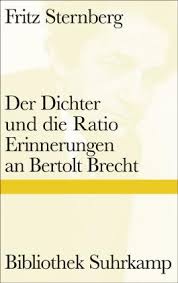
Es lebe der Sozialismus (oder, je nach Temperament, der Kommunismus)! Der Kapitalismus ist überwunden! Der Klassenkampf ist gewonnen, denn die Klassen sind abgeschafft. Die Welt wird gerecht und paradiesisch!
Das ist in etwa der Tenor, oder der rote Faden, der die hier zusammengestellten Essays, Zeitungsartikel oder Erinnerungsnotizen von Fritz Sternberg, beziehungsweise die Protokolle oder Aufzeichnungen von Gesprächen, die Sternberg mit Brecht und anderen intellektuellen Grössen der 1920-er und 1930-er Jahre geführt hat, kennzeichnet. Es ist aus heutiger Sicht – jedenfalls für mich – nur sehr schwer nachvollziehbar, dass noch vor weniger als 100 Jahren in der damaligen geistigen Elite so gedacht werden konnte. Die Ideale, die Träumereien und Fantasievorstellungen, welche repräsentative damalige Geistesgrössen (Schriftsteller, Theaterleute, Philosophen und Soziologen) pflegten und vertraten, sind so naiv und weltfremd, so von jeglichem Realitätssinn abgehoben, dass man nur staunen kann. Die Tatsache, dass sie im Vakuum zwischen der deutschen Niederlage im ersten Weltkrieg und dem aufkommenden Nationalsozialismus entstanden und hochkamen, mag das Phänomen teilweise erklären, aber eben nur teilweise. Die Überheblichkeit, die für Menschen, die voll und ganz davon überzeugt sind, dass sie im Besitz der absoluten Wahrheit sind und ganz genau wissen, was für die Menschen gut ist, spielt dabei wohl eine viel grössere Rolle. Es ist jedenfalls beinahe amüsant, aber auch erschütternd, mitzubekommen, wie die Protagonisten dieser Sammlung die Proletarier ihrer Zeit in die Weltrevolution einbeziehen und sie beglücken wollen, ohne je einem Proletarier begegnet zu sein oder von einem Proletarier in Erfahrung gebracht zu haben, was deren Sorgen, Nöte und Bedürfnisse gewesen sein könnten.
Bezeichnend ist auch, dass in allen wiedergegebenen Auseinandersetzungen mit dem idealen Zustand der Welt (d.h. Abschaffung der Klassen, Zustand der vollkommenen Gleichheit) das Stichwort ‚Freiheit’ kein einziges Mal vorkommt. Den Idealisten ist die Natur des Menschen wurst (Unabhängigkeitsbedürfnis, inhärenter Drang zur Selbstverwirklichung, Streben nach mehr, d.h. mehr als gestern, mehr als die Nachbarn, Eigennutz, Konkurrenz, Clan- oder Familiensinn, etc.). Die Tatsache, dass die Natur des Menschen weitgehend mit der Natur der ‚Natur’ konvergiert, ja: konvergieren muss, weil sie ein Teil dieser Natur und Ergebnis der Evolution ist, hat für sie keine Bedeutung. Dass der ideale Zustand der Welt nur erreichbar und haltbar (also eine eingefrorene, statische Welt ohne weitere Entwicklung) wäre, wenn die Natur des Menschen, insbesondere sein Bedürfnis nach Freiheit, völlig unterdrückt würde, wird entweder in völliger Verkennung der Wirklichkeit total ausgeblendet, oder – weil man ja a priori und ex cathedra besser weiss, was der Welt guttäte – bewusst ignoriert.
Dieser Teil des Buchs (die Auseinandersetzung mit der Weltrevolution) gehört in die Müllkiste der geistigen Entwicklung der deutschen Geisteselite und hat höchstens noch geschichtliche Bedeutung. Was durchaus auch heute noch interessieren kann, sind die Gedankengänge, die hinter Brechts ‚epischem Theater’ stehen und in extenso diskutiert werden. Der Kern dieser Theorien besteht darin, dass das ‚alte’ Theater, in dem seit der Antike primär bis ausschliesslich Individuen und deren Konflikte im Zentrum stehen, durch ein ‚neues’, d.h. episches Theater abzulösen ist, in dem nicht mehr Individuen, sondern nur noch gesellschaftlich relevante Themen zur Diskussion gestellt werden. Als Hintergrund für das heutzutage grassierende Autoren- oder Regie-Theater ist die Theorie natürlich noch heute lebendig. Ob sie damit die Qualität und Relevanz der Institution ‚Theater’ erhöht, ist allerdings eine andere Frage.
Mir scheint, dass die Ironie der Geschichte darin besteht, dass ausgerechnet Brecht, der selbsternannte ‚Erfinder’ des epischen Theaters, in vielen seiner Stücke und Gedichte dieses Postulat selbst sträflich verletzt: die Trennung oder Entflechtbarkeit von Gesellschaft und Individuum ist eine Illusion.
Eine wissenschaftlich nützliche, schwierige, aber keineswegs lustvolle Lektüre! Das Buch illustriert auch, soweit derartige Verallgemeinerungen überhaupt zulässig sind, dass deutsche Intellektuelle, vor allem im Unterschied zu angelsächsischen, umso mehr aufblühen, je weltfremder ihre Themen sind.
PS:
So nebenbei wird jedenfalls in der Erinnerung Sternbergs sehr deutlich: er hält Brecht für einen prinzipienlosen Opportunisten, weil der ‚Übergang’ Brechts in die nachmalige DDR nur damit erklärbar ist, dass er seinem Ehrgeiz, ein eigenes Theater zu bekommen, alles andere, insbesondere seine intuitive – also nicht rationale – Ablehnung des Kommunismus unterordnet. Das hätte ihm besonders schwer fallen müssen, weil eine seiner wichtigen Inspirationsquellen, Karl Korsch (1886 – 1961, linker Theoretiker und Philosoph), noch zu Lebzeiten Brechts zur Überzeugung gelangte: Alle Versuche, «die marxistische Lehre als Ganzes und in ihrer ursprünglichen Funktion als Theorie der sozialen Revolution wiederherzustellen, sind heute reaktionäre Utopie». (Seite 156, am Schluss des zweitletzten Abschnitts)
PSPS:
Preisfrage: Ist ‚reaktionäre Utopie’ ein Beispiel für die geschwollene und leerformelhafte Ausdrucksmanie vieler Intellektueller, oder ist der innere Widerspruch zwischen ‚reaktionär’ (d.h. rückwärts gewandt) und ‚Utopie’ (also vorwärts oder auf die Zukunft ausgerichtet) beabsichtigt und allenfalls sogar ironisch gemeint?