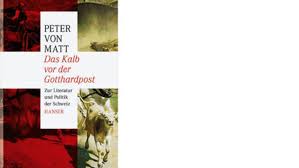
«Das Kalb vor der Gotthardpost», mein erster von Matt, beeindruckt mich sehr tief. Von Matt beschreibt, analysiert und kritisiert einen sehr breiten Bereich von Politik und Gesellschaft der heutigen Schweiz anhand der schweizerischen Literatur, überwiegend sehr scharf, pointiert, manchmal ironisch, und weitgehend ideologiefrei. Er hat mir eine ganze Anzahl von Schweizer Schriftstellern erschlossen, die ich zwar aus den Medien kenne, jedoch noch nichts gelesen habe, oder von denen* ich bisher noch nicht einmal die Namen kannte: Robert Walser, Ulrich Bräker, Arnold Kübler, Otto F. Walter, Adelheid Duvanel*, Niklaus Meienberg, Jürg Steiner*, Klaus Merz*, Gerold Späth*, Hansjörg Schneider*.
Es gelingt von Matt ausgezeichnet, die Befindlichkeit der Schweiz im Spiegel ihrer Literatur lebendig darzustellen, aber auch, die Befindlichkeit der Schriftsteller der Schweiz im Spiegel der wirklichen Schweiz zu hinterfragen und sehr behutsam zu entlarven.
Auch von Matts Essais, die nicht an einem Schriftsteller oder literarischen Werk ‚aufgehängt’ sind, belohnen den Leser mit überraschenden, originellen und bedenkenswerten An- und Einsichten.
Am meisten beeindrucken mich von Matts Auseinandersetzung mit der ‚Seelengeschichte einer Nation’ (Seite 9ff), Behagen und Unbehagen im Föderalismus (115ff), ‚Die Sprache in der Demokratie’ (Seite 122ff) und ‚Deutsch in der Deutschen Schweiz’ (Seite 127ff), ‚Deutschland, die Schweiz und die Literatur’ (Seite 178ff), die Würdigung von Max Frisch im ‚Schrecken der Vollkommenheit’, die Gegenüberstellung von Frisch und Dürrenmatt (Seiten 191ff) als Prototypen des Liberalen (Frisch) und Konservativen (Dürrenmatt).
Allerdings irritiert mich gerade im letztgenannten Beitrag, dass von Matt den Liberalismus als eine Haltung charakterisiert, welche vom Ziel der Vervollkommnung des Menschen und der Welt angetrieben ist. In meinem Verständnis von Liberalität ist es genau umgekehrt: der Liberale geht von der Unvollkommenheit der Menschen aus. Gerade deshalb postuliert er einen Lebensrahmen, der von ‚Recht und Ordnung’ und von den Prinzipien der Gleichheit aller vor dem Gesetz und vom Bedürfnis aller nach Freiheit ausgeht, weil auf dieser Grundlage die Unvollkommenheit der Menschen ‚gezähmt’ werden kann. Anders gesagt: der Liberale will, dass sich die Menschen Spielregeln geben, welche es jedem einzelnen erlauben, seine Unvollkommenheit – natürlich innerhalb der gegebenen Spielregeln – auszutoben. Unvollkommene Lösungen gibt es nicht, kann es in Anbetracht der Vielfalt der Bedürfnisse der Menschen gar nicht geben. Er nimmt also aus seiner Sicht ‚falsche’ Lösungen in Kauf. Denn er geht davon aus, dass die Ergebnisse der Handlungen vieler Einzelner, die unter Einhaltung von diesen sich selbst gegebenen Spielregeln zustande kommen, besser, mindestens das kleinere Übel, sind, als die Ergebnisse, die in Diktaturen oder Oligarchien willkürlich zustande kommen (die Diktatoren oder Oligarchen sind ja genauso unvollkommen wie alle andern Menschen auch).
Mit seiner Interpretation von Liberalismus kommt von Matt darum herum, Max Frisch als ‚Linken’ darzustellen. Mir kommt das schon so vor, wie wenn er den liberalen Frisch auf diese Weise ‚von hinten durch die Brust ins Auge’ herbeizaubern würde. Trotz dieser theoretischen Differenz: die Gegenüberstellung von Frisch und Dürrenmatt ist erhellend, und bestätigt im Grunde, worauf ich selbst schon gekommen bin: Frisch ist ein tragischer Missionar und Eiferer, Dürrenmatt ein komödiantischer Erzähler von tragischen, irren und lustigen Geschichten. Frisch hat sich seine Mission selbst geschaffen und gewählt, Dürrenmatt versucht lebenslang, mit seinem Werk vor seiner väterlichen Mission, Pfarrer zu werden und Gott zu verkünden, zu fliehen.
Die meist kurzen Aperçus von Schriftstellern, deren Werk oder Namen ich bisher nicht kannte, zeigen, was ich bisher verpasst habe. Das mag eine Bildungslücke sein, aber von Matt animiert mich nicht, sie zu füllen. Die Themen, in die sich diese Autoren verkrallt haben, sind mir zu abwegig.
Von Matt spricht häufig von Mythos, von der Bedeutung der Mythen für eine Gesellschaft, einer Nation – aus meiner Sicht zu Recht. Viele der von ihm sezierten Autoren beschäftigen sich mit der Zertrümmerung der schweizerischen Mythen. Leider unterlässt es von Matt, auch darauf hinzuweisen, dass dieser Zertrümmerungssucht oder -wut ein neuer Mythos zugrunde liegt, nämlich der (irrige) Glaube, die Schweiz sei a priori etwas Besseres, eine Art von auserwähltem Volk, das der Welt zeigen und vormachen müsse, wie sie funktionieren sollte. Das scheint mir typisch zu sein etwa für Frisch oder Meienberg. Es wäre schön, wenn von Matt die Inkonsequenz – und Unhaltbarkeit – dieser Haltung transparent machen würde.
Was ich für mich in jedem Fall mitnehmen will, sind von Matts Gedanken zur ‚Wut’ oder ‚Empörung’ als unheilvollen Antrieb bei der Einmischung in die Gestaltung einer Gesellschaft. Sätze (alle Zitate aus ‚Die Sprache in der Demokratie’, Seite 122-123) wie:
- «Denken bedarf der Beweise.»,
- «Anders ist es mit der Wut, der Empörung. Auch von ihr gilt: Sie begründet sich selbst. Sie hat zwar einen Anlass, aber sie bedarf keiner Argumente. Das Gefühl der Empörung fällt stets zusammen mit dem Gefühl des Rechthabens.»,
- «Empörung stiftet Ordnung. Wie geht das zu? Empörung stiftet Ordnung, indem sie Schuld bestimmt und Schuldige benennt. Wo die Schuld feststeht, scheinen alle Ursachen geklärt. Man braucht nicht mehr zu zweifeln und zu grübeln. Es herrscht Ordnung.»
- «Nicht die Religion ist Opium für das Volk, wie Marx einst meinte, sondern die Empörung.»,
- «Nicht die Wahrheit, in deren Besitz irgendein Mensch ist, oder zu sein vermeinet, sondern die aufrichtige Mühe, die er angewandt hat, hinter die Wahrheit zu kommen, macht den Wert des Menschen.» (Lessing)
sind etwas vom besten was ich bisher als Variation der Formel ‚Ersatz des Sachverstands durch Betroffenheit’ gehört habe. Ich schreibe sie mir – als innere rote Karte – für mein eigenes Verhalten in einschlägigen Diskussionen hinter die Ohren.
Per Saldo: Von Matts Sprache ist so präzis, humorvoll bis satirisch, geschliffen und gekonnt, dass sich die Lektüre des ‚Kalbs vor der Gotthardpost’ allein deswegen lohnt. Aber die Kombination von Sprachkunst, subtiler Literaturkenntnis und Wissen über die Schweiz und Einfühlen in die Befindlichkeit der Schweiz machen es zu einem Muss für jeden, der etwas über sein Land und sich selbst als dessen Bürger lernen will.