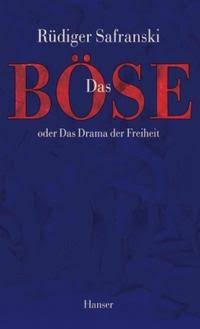
Das Inhaltsverzeichnis von «Das Böse» macht sehr deutlich, dass Safranski eine Geschichte der philosophischen Auseinandersetzung abendländischer Denker mit dem Bösen vorlegt. Er hält sich im Wesentlichen an die Chronologie der Philosophiegeschichte. Konsequenterweise beginnt er mit dem biblischen Sündenfall, fährt weiter mit den griechischen Philosophen (primär Sokrates, Platon), Augustinus, macht dann einen grossen Zeitsprung zu Schelling und Schopenhauer, macht dann einen Vorgriff auf den ‚wiedergekehrten Augustinus‘ Arnold Gehlen, wendet sich dann Thomas Hobbes und Hegel zu, Max Scheler und Carl Schmitt, Rousseau, Heine, Kant, der ‚Ästhetik des Schreckens‘ (ein Kunterbunt von Flaubert, Baudelaire, Joseph Conrad, Camus und Nooteboom), um sich anschliessend nochmals mit Kant, dem ‚Tolstoi-Syndrom‘ und ‚Kafkas Reinheit‘ auseinander zu setzen. Unvermeidbar sind dann Freud und Nietzsche, ebenso wie Hitler und Auschwitz. Schliesslich geht’s zurück zu Hiob, Epikur, der Leibniz’schen Theodizee und ‚Kants Solidarität mit Hiob‘. Zum Schluss konfrontiert er sich mit dem Weltvertrauen, Faust und Mephisto.
Es ist bei dieser Dramaturgie nicht verwunderlich, dass Safranski – mindestens in den Anfangskapiteln (ich bin jetzt im vierten Kapitel bei Schellings ‚Geschichte des Transzendenzverrats‘) – den Spuren des Bösen und dessen Wahrnehmung durch unsere Denker-Vorväter ausserhalb der säkularen Welt nachgeht; konkret: er bewegt sich im Reich des Glaubens, und damit in der Welt des Transzendenten, wo Fragen wie «Wer sind wir? Woher kommen wir? Wer hat uns erschaffen? Wer ist Gott? Was ist das Böse? Was zieht die Menschen hin zum Bösen? etc.» im Vordergrund stehen.
Safranski selbst hält sich sehr zurück, d.h. er ist der Rapporteur, der (auf die Thematik des Bösen ausgerichtete) selektive Philosophie-Geschichtsschreiber. Als Leser muss man also unterscheiden zwischen den Theorien, über die Safranski berichtet, und dem, was er womöglich selber zu den Theorien sagen würde. Mir erscheinen die philosophischen Gehversuche und Theorien dieser Epochen wie ein a priori untauglicher – d.h. zum Misserfolg verdammter – Versuch, für das ‚Glauben‘ eine rationale Grundlage und Begründung zu finden. Das ‚Glauben‘ ist für mich a priori etwas, das ausserhalb des Rationalen steht (wenn das nicht so wäre, wäre es Wissen, und damit nicht Glauben). Für mich sind Schellings gedankliche Klimmzüge ein Paradebeispiel für solch nutzlose Versuche, den Zirkel zu quadrieren.
Der Eifer, mit dem die ‚Post-Aufklärer‘ versuchen, den leeren Platz der bisherigen Deutungshoheit, d.h. der Kirche, durch (scheinbar) rationale Konstruktionen wieder zu besetzen, kann jedenfalls aus heutiger Sicht nur befremden. Es erinnert an die Austreibung des Teufels durch den Beelzebub.
Bis zum achten Kapitel (Kant, Max Scheler, Carl Schmitt) wird immer deutlicher, dass die von Safranski ausgewählten Denker das Böse, beziehungsweise die Ursache des Bösen im ‚Transzendenzverrat‘ sehen. Das ist – in verschiedenen Ausprägungen – der Abfall von Gott, die Negierung Gottes, des Transzendenten, Göttlichen oder Überirdischen vom Thron der Erhabenheit; es schliesst selbstverständlich das Verstossen der Stellvertreter oder Hohepriester Gottes auf Erden vom Thron der Deutungshoheit, von dem aus sie den Menschen mit einer (angeblich) von Gott zugewiesenen Autorität vorschreiben, wie sie zu leben und was sie zu denken oder glauben haben.
Anmerkungen BB:
Die unzähligen Versuche früherer Denker, die Transzendenz durch rationale Konstrukte irgendwie wieder zu beleben, sind zwar historisch und kulturell interessant, aber in ihrer zum Misserfolg verdammten Hartnäckigkeit auch bemühend. Bei Rousseau (Kapitel 9) kulminieren solche Versuche im ‚contrat social‘, der den Menschen nur noch die Möglichkeit eröffnet, sich ‚vom gesellschaftlich entarteten Tier zum gutartigen Gesellschaftstier‘ zu emanzipieren. Die von Rousseau entwickelte Zivilreligion einer ‚totalitären Vision des Aufgehens der Freiheit im Sozialen‘ zwingt die Menschen in ein System, in dem das öffentliche Wohl an der Spitze aller Zwecke steht; sie ersetzt das Transzendente durch den «Glauben an die Heiligkeit des Gesellschaftsvertrags und seiner Gesetze». Paradoxerweise erkennt Rousseau aber auch, dass er selbst gegen die von ihm postulierte Zivilreligion sündigt, weil er das ‚höchste Glücksgefühl im Rückzug aus eben dieser Gesellschaft‘ findet. Trotzdem: letztlich fordert er aber – mit Nachwirkungen bis in die Gegenwart: «Das Asoziale ist das Böse, das eliminiert werden muss».
In «Rousseau richtet über Jean-Jacques», einer seiner letzten Schriften, macht Rousseau sich selbst den Prozess, den er mit der Feststellung abschliesst, er sei kein schädlicher Mensch, sondern nur ein unbrauchbarer Bürger. Also: der unbrauchbare Bürger ist derjenige, der sich dem politischen Mainstream (den natürlich Rousseau oder einer seiner Nachfolger hoheitlich deutet) widersetzt.
Rousseau postuliert, selbst wenn er dies nicht (immer) expliziert, einen neuen Menschen als Voraussetzung dafür, dass seine Theorie überhaupt aufgehen kann. Es wäre wohl einfacher, den Menschen als gegeben zu betrachten und die Theorie auf eben diesen Menschen auszurichten. Für einen wahrhaftigen Denker wäre dies wohl zu pragmatisch…
Ob die Linken mit ihrer impliziten Voraussetzung, dass für die Wiedergewinnung des Paradieses auf Erden ein neuer Mensch erforderlich ist, von Rousseau inspiriert sind? Ich tröste mich damit, dass es ihnen wie den Schwulen im Witz von Radio Eriwan geht: «Stimmt es, dass Schwule keine Kinder machen können? Im Prinzip ja – aber sie probieren es trotzdem immer wieder.»
Safranski spinnt seinen Faden rund ums Böse weiter:
- über eine Kritik des Rationalismus,
- über Marx und dessen Anspruch, die Welt nicht nur erklären, sondern verändern zu wollen (gemäss Safranski eine wissenschaftlich drapierte Art von Eschatologie)
- über einen Exkurs zum Liberalismus in der Verkörperung der US Federalist Papers von Madison, der – zeit- und sinngemäss geistgleich wie Kant – das Prinzip formuliert: Wir konkurrieren uns empor! – wobei davon ausgegangen wird, dass das Konkurrieren allemal besser ist als sich gegenseitig Totzuschlagen, denn dann entsteht aus Konkurrenz eine ‚günstige Entwicklung des Menschengeschlechtes‘;
- über die überraschende Entdeckung des Marquis de Sade als Philosophen des Bösen,
- und natürlich immer wieder über Kant, der messerscharf erkannte, dass das Böse eine Option der Freiheit ist; aber nicht etwa im Sinne eines ‚Unfalls der Natur‘, sondern als eine Tat der Freiheit,
- über die Rechtfertigung der Kunst in einer bösen Welt (einschliesslich Brechts Frage, ob man in ‚bösen Zeiten‘ noch Bäume pflanzen darf),
- über Freud, Nietzsche, Goethe, Hitler und Mephisto,
- über die Geschichte von Hiob, den Atheismus von Epikurs und die Theodizee von Leibniz.
Zum Schluss befasst sich Safranski mit der Kontingenz. Er beendet damit seinen essayistischen Überschallflug über die Geschichte der abendländischen Philosophie von ‚Gut und Bös‘ beinahe optimistisch: In prekären Situationen, so nimmt er nochmals Kant zu Hilfe, gibt es eine Art Pflicht zur Zuversicht ; sie ist der kleine Lichtkegel inmitten der Dunkelheit, aus der man kommt und in die man geht.
Aber auch im letzten Satz kommt nochmals als wichtige Bezugsgrösse ‚Gott‘ vor. Safranski lässt offen, d.h. er befasst sich überhaupt nicht mit der Frage, ob es auch Gut und Böse ohne Gott geben könne, oder anders gesagt, ob die Menschheit, ohne Entzugserscheinungen zu bekommen, auch in Moral und Ethik ganz ohne Gott, d.h. vollständig säkular denken und handeln könnte.