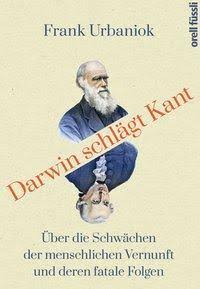
Warum eigentlich nicht: «Federer schlägt Mozart»?
Frank Urbaniok ist Psychiater und leitete von 1987 – 2018 als Chefarzt die grösste forensische Institution der Schweiz (Psychiatrisch-Psychologischer Dienst des Kantons Zürich). Er gilt als international führender Experte im Bereich der forensischen Psychiatrie und Psychologie und ist Professor an der Universität Konstanz.
Im Hinblick auf den beruflichen Hintergrund des Autors ist es keine Überraschung, dass sich sein Buch vor allem mit der forensisch relevanten Seite «der Schwächen der menschlichen Vernunft und ihre(n) fatalen Folgen» befasst. Es ist also Defizit-orientiert.
Die beruflichen Leistungen Urbanioks verdienen zweifellos hohen Respekt. Trotzdem kann man sich aber fragen, ob die Entwicklung einer neuen Version der Darstellung von Struktur und Logik der Art und Weise, wie Menschen ihre Welt wahrnehmen, diese zu verstehen und interpretieren versuchen und daraus allgemein gültige Regeln zu destillieren, notwendig und nützlich war. Das RSG-Modell jedenfalls (Registrieren, Subjektivieren, Generalisieren), mit dem Urbaniok dies unternimmt, erscheint auf den ersten Blick nicht nur überflüssig, sondern auch etwas zu simplistisch.
Besonders ärgerlich ist für mich, dass Urbaniok einerseits die Evolution völlig falsch darstellt und anderseits viel zu pauschal von ‚Schwächen der menschlichen Vernunft‘ spricht, anstatt darauf hinzuweisen, dass bestimmte Verhaltensweisen in bestimmten Situationen erfolgreich oder erfolgversprechend sein können, und in anderen Situationen nicht. Folgende Zitate (Seiten 82ff, 91ff) mögen illustrieren, worauf ich meine Kritik basiere:
- «… eine Vielzahl psychologischer Mechanismen, die als gravierende Schwachstellen unserer Erkenntnisfähigkeit anzusehen sind.»
- «Ist es nicht irritierend, dass unsere Vernunft so viele psychologische Konstruktionsmängel hat?»
- «Das Ziel der Evolution war beim Menschen wie auch bei allen anderen Organismen, Überlebens- und Reproduktionsvorteile für die gesamte Art zu schaffen.»
- «Ordnungen und spezielle Regeln begegnen uns in der Evolution an allen Ecken und Enden. Schon immer sind sie fester Bestandteil evolutionärer Programmierung.»
- « … Diese Perspektive macht deutlich, dass Regeln (und Ordnungen allgemein) – so wie wir diese zu erkennen in der Lage sind – elementar bereits am Anfang der Evolution und letztlich am Anfang des Universums standen. Regeln und andere Ordnungen sind auch für das Verhalten von Trieren prägend. Fischschwärme, Vogelfamilien, Wolfsrudel, Affengruppen, Bienen und Termitenstaaten – überall in der Natur begegnen uns ausdifferenzierte Regeln und Ordnungen. Wenn wir diese Regeln und Ordnungen im Verhalten von Tieren sehen, dann bedeutet das, dass deren Wahrnehmungs-, Bewertungs- und Entscheidungsfunktionen auf diese Regeln und Ordnungen ausgerichtet sind.»
Schon im Untertitel des Buchs «Über die Schwächen der menschlichen Vernunft und ihre fatalen Folgen» steckt der Kern der schiefen Darstellung. Es sind nämlich nicht die Schwächen der menschlichen Vernunft, sondern die meistens durch menschliche Bequemlichkeit entstehende Übermacht der nicht-vernünftigen Mechanismen der Intuition, die fatale Folgen haben kann.
Zu den von Urbaniok genannten Konstruktionsmängeln gehören (siehe vollständige Liste in Kapitel 2, Seiten 31 – 54): Rückschaufehler (oder Extrapolation), ‚What you see is all there is‘ (WYSIATI), Wiederholungen, Kausalitätsillusion, Generalisierung, Überschätzung geringer Häufigkeiten, Vermeidung kognitiver Dissonanz. Er macht dabei aber einen grundlegenden Kategorienfehler, wenn er solche allzu menschlichen Verhaltensweisen als Schwachstellen unserer Erkenntnisfähigkeit oder als Konstruktionsmängel ansieht. Er selbst bezieht sich auf Daniel Kahnemann, der hinter unserem Urteilsvermögen zwei verschiedene Systeme unterscheidet: ein langsames, das auf rationalem Denken aufbaut, und ein schnelles, das primär mit spontaner Intuition arbeitet. Urbaniok destilliert den Hauptunterschied zwischen diesen beiden konkurrierenden Systemen auf folgende Maxime: Besser falsch, dafür aber schnell und/oder eindeutig. Das mag in vielen Phasen der zivilisatorischen Entwicklung richtig gewesen sein, mag auch in der heutigen Zeit in bestimmten Situationen immer noch angezeigt sein; das ist aber kein Grund, die Fehler, zu denen das schnelle System häufig führt, als Konstruktionsmängel des langsamen Systems zu bezeichnen. Insgesamt kommt für mich in Urbanioks Analyse und These der Aspekt der Situativität viel zu kurz, nämlich dass bestimmte Wahrnehmungs- und Beurteilungsprozesse in bestimmten Situationen richtig, in anderen jedoch grundfalsch sein können, und dass es gerade den Menschen auszeichnet, dank seiner Vernunft solche Unterschiede auch bewusst wahrzunehmen, d.h. sich in jeder Situation auf das passendere Wahrnehmungs- und Beurteilungssystem zu verlassen. Urbanioks Mantra, dass schnell und eindeutig grundsätzlich besser sein soll als langsam und differenziert, fundiert und rational nachvollziehbar, leuchtet jedenfalls nicht ein. Es würde genügen zu sagen, dass in bestimmten Situationen (z. B. wenn ein Kind direkt vor dem Auto über die Strasse rennt ) schnelles, intuitives Handeln zweckmässiger ist als rationales Grübeln über Ursachen und mögliche Zusammenhänge mit dem Urknall.
Was Urbaniok über die Evolution sagt, mag seinem Bestreben entsprechen, sich einfach, um nicht zu sagen ‚populistisch‘, auszudrücken. Das macht es aber nicht besser. Die Evolution hat weder etwas konstruiert, mit oder ohne Mängel, sie hat auch keine Ziele; die Evolution ist eine Lotterie. Sie ist auch kein handelndes Subjekt. Was wir als Evolution bezeichnen, ist das, was passiert ist. Und das, was passiert ist, ist eine unendlich lange Kette von zufällig entstandenen Mutationen, die zu Eigenschaften von Organismen geführt haben, welche diese besser oder schlechter befähigt haben, sich an ihre Umgebungen anzupassen. Diejenigen Varianten, die dabei besonders erfolgreich waren, haben überlebt, die anderen sind verkümmert und ausgestorben (frei nach Darwin: ‚survival of the fittest‘). Überlebens- und Reproduktionsvorteile für gesamte Arten zu schaffen, war also nicht das Ziel der Evolution, sondern schlicht und ergreifend die Folge der evolutionären Lotterie, sowohl beim Menschen als auch bei allen anderen Organismen, die sich erfolgreich an ihre Lebensbedingungen anpassen konnten.
Evolution ist also eine deskriptive Bezeichnung, nicht ein Programm! Das Gleiche gilt für Regeln und Ordnungen. Ordnungen und Regeln existieren nicht in der Natur an sich; es sind Konstrukte, die wir Menschen aufgrund unserer Erforschung der Natur erkennen und beschreiben können. Kein Tier hält sich an Regeln oder Ordnungen, denn Tiere wissen davon nichts.
Man könnte Urbanioks Aussagen in etwa so umformulieren. Wir Menschen haben zwei verschiedene Wahrnehmungs- und Beurteilungssysteme: ein schnelles, das auf Intuition basiert, und ein langsames, das auf rationalem Abwägen basiert (und wahrscheinlich sind wir die einzige Spezies, bei der ein solches System entstanden ist oder sich so weit entwickelt hat). In vielen Situationen konkurrieren diese beiden Systeme, manchmal mit Vorteil für die Intuition, manchmal mit Vorteil für die Ratio. Es gibt zahlreiche Situationen, in denen es gar nicht auf Schnelligkeit ankäme, in denen aber doch die Intuition die Oberhand gewinnt, entweder weil die betroffenen Menschen nicht klug genug oder zu bequem sind, zu denken. Dies kann, muss aber nicht zu Fehlverhalten, falschen Einstellungen und Entscheidungen führen. In solchen Kontexten sind Urbanioks (defizitorientierte) Analysen, auch das RSG-Modell, hilfreich, auch wenn deren Begründungen falsch und die mantrahaften Verweise auf ‚Konstruktionsmängel‘ deplatziert sind.
Vollends ärgerlich wird’s mit Urbanioks Versuch, die Naturwissenschaft als Teil des (Erkenntnis-)Problems zu diskreditieren (Kapitel 6 «Naturwissenschaft: Der Königsweg?»), weil er dabei (Kapitel 6.4 «Irrtümer der Wissenschaft: Einige Beispiele») angebliche wissenschaftliche Fehlleistungen anführt, die a priori mit Wissenschaftlichkeit nichts zu tun haben, weil sie in keiner Weise den heutigen Ansprüchen wissenschaftliche Sorgfalt und Gründlichkeit entsprechen. Wenn Urbaniok dazu bemerkt: «Vieles, was man in früheren Zeiten als wissenschaftlich unumstössliches Wissen angesehen hat, stellte sich später als falsch, grotesk oder gar verstörend heraus.» ist das leider eine sehr manipulative Ausrede; es müsste nämlich in diesem Kontext viel eher heissen… «Vieles, was man in früheren Zeiten als unumstössliches Wissen (das von ‚höheren Autoritäten‘, meistens religiösen, als solches festgelegt worden war) angesehen hat, stellte sich später– gemessen an heutigen wissenschaftlichen Standards – als völlig unwissenschaftlich, als Hokuspokus und Aberglauben heraus.» Aber dass Hokuspokus und Scharlatanerie nicht der Königsweg zu Erkenntnisgewinn oder Wissenserweiterung sein können, ist gewiss keine Grundlage für die Aussage, Wissenschaftlichkeit an sich sei kein Königsweg. Und dass jedes heutige, wissenschaftlich gesicherte Wissen nur vorläufig ist und als Verfalldatum «solange nicht widerlegt» hat, ist ebenso wenig ein Grund, nicht wissenschaftlich seriös zu arbeiten.
Generell ist Urbaniok vorzuwerfen, dass er nicht unterscheidet
- zwischen der Wissenschaftlichkeit einer Methode oder einer Vorgehensweise an sich
- und der richtigen oder falschen Anwendung einer Methode.
In beiden Fällen steht für ihn die Tauglichkeit der Methode an sich in Zweifel. Einen Höhepunkt dieser krassen Gleichsetzung erreicht er, wenn er den Glauben, die Erde sei eine Scheibe, als Beweis dafür anführt, dass Wissenschaftlichkeit kein Königsweg sein kann.
Als neckisches Detail nur noch folgender Hinweis: Urbaniok zitiert (Seite 106) Professor John Ioannidis, Professor an der Stanford Universität und Experte für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Wissenschaft, der schätzt, dass 80% aller wissenschaftlichen Ergebnisse methodisch falsch sind. Als Quelle für diese Aussage dient ihm eine Publikation in The Lancet; gemäss Wikipedia ist The Lancet eine der ältesten und renommiertesten medizinischen Fachzeitschriften der Welt, die ein Peer Review einsetzen. Es wäre also interessant zu erfahren, ob die Schätzung von Ioannidis sich auf die wissenschaftliche methodische Qualität von medizinischer Forschung oder von Forschung in allen Fachgebieten bezieht, und auch wie die Schätzung sonst zustande gekommen ist. Es ist zu befürchten, dass Urbaniok mindestens in diesem Fall den Generalisierungsfehler praktiziert, den er sonst als «den unterschätzten Denkfehler» qualifiziert (Seite 46).
Urbanioks Argumentation legt nahe, dass er das Wesen der naturwissenschaftlichen Arbeitsweise nicht kennt und deshalb die Wissenschaftlichkeit der Sozialwissenschaften als der naturwissenschaftlichen Methodik gleichwertig betrachtet. Er verkennt dabei völlig, dass der naturwissenschaftliche Ansatz (Hypothese als Erklärung eines noch nicht erklärten Phänomens, Design und Durchführung von Experimenten zur Erhärtung oder Falsifizierung der Hypothese, Sicherstellung der Reproduzierbarkeit der Ergebnisse, Peer Review, etc.) wenn nicht sicherstellt, dann wenigstens eine hohe Gewähr dafür bietet, dass die von Urbaniok zu Recht genannten häufigen Fehler in Wahrnehmungs- und Erkenntnisprozessen (siehe RSG-Modell) entweder nicht vorkommen oder mindestens rechtzeitig entdeckt werden.
Im Übrigen missfällt mir die in geisteswissenschaftlichen Texten häufig anzutreffende verbale Schaumschlägerei. Ale Beispiel nenne ich Urbanioks favorisierte «pragmatisch-phänomenologische Betrachtungsweise» (Seite 113). Er könnte sich viel Leerlauf ersparen, wenn er schlicht fordern würde, Wahrnehmungs- und Erkenntnisprozesse unvoreingenommen und ohne Scheuklappen anzugehen – und diese Forderung als allgemeingültig für jedes rationale und respektable menschliche Tun und Lassen zu erklären.
Eine letzte Bemerkung zu Urbanioks gestörtem Verhältnis zur Wissenschaftlichkeit will und kann ich nicht unterdrücken. Auf Seite 123 schreibt er: «Jedenfalls glaube ich aus den dargelegten Gründen nicht daran, dass die empirische Vorgehensweise die einzige ist, wichtige Erkenntnisse über die Welt und uns selbst zu generieren. Sie hat zweifellos ein grosses Potential. … Der Nachteil dieser Methode hat aber mit der Reduktion von Einflussvariablen und der starren Anordnung eines Prozederes zu tun, die stets mit ihr verbunden sind. Da ist zum Beispiel das Gedankenexperiment grundsätzlich im Vorteil. Der Vorteil der empirischen Methode besteht umgekehrt aber darin, dass sie experimentell überprüfbar und damit falsifizierbar ist.»
- Allerdings bleibt Urbaniok eine Erklärung schuldig, worin denn der Unterschied zwischen einem Experiment in der Chemie und einem Gedankenexperiment bestehen könnte.
- Er behauptet, das empirische Vorgehen sei stets mit der starren Anordnung eines Prozedere(s) verbunden. Er verkennt offenbar, dass dem empirischen Vorgehen eine enge Verzahnung von kreativen Prozessen und schematischen, weil zwingend wiederholbaren Durchführungsprozessen, zugrunde liegt. Die Kreativität liegt in der Formulierung der Hypothese zur Erklärung eines bislang nicht erklärbaren Naturphänomens und im Design einer aussagekräftigen Kette von experimentellen Schritten bis zur Erhärtung oder Falsifizierung der Hypothese.
- Wenn Überprüfbarkeit und Falsifizierbarkeit Vorteile des empirischen Vorgehens sind, würde natürlich auch interessieren, wie diese Vorteile beim nicht-empirischen Vorgehen, also beim Gedankenexperiment, aufgewogen oder kompensiert werden.
Ich beende hier meine Lektüre von «Darwin schlägt Kant». Das Buch ist nichts für mich. Es mag für Gerichtspsychiater oder für andere Berufsgattungen, die sich primär oder ausschliesslich mit menschlichen Fehlleistungen oder Verbrechen befassen, nützlich oder hilfreich sein. Ich halte es aber auch für eine solche Zielgruppe für gefährlich, oder mindestens problematisch. Denn:
- Urbaniok schreibt «Über Schwächen der menschlichen Vernunft und ihre fatalen Folgen» (Untertitel). In Wirklichkeit geht es aber nicht um Schwächen der menschlichen Vernunft, sondern um Schwächen oder Mängel in der Anwendung der menschlichen Vernunft. Es geht um die Konkurrenz zwischen emotionalen, spontanen oder intuitiven Zugängen zu Erkenntnissen oder Handlungsanweisungen einerseits und dem sachlich abwägenden, rationalen Denken – oder, frei nach Kahnemann (Seite 31), zwischen dem schnellen und langsamen Wahrnehmungs- und Beurteilungssystem.
- In dieser Konkurrenz obsiegt nun häufig das schnelle System, obwohl Geschwindigkeit gar nicht zwingend gefragt ist, und manchmal das langsame System, obwohl es um Sekunden geht. Wer vor einem brennenden Haus steht und zuerst darüber grübelt, was die Ursache des Brandes sein könnte, kommt wahrscheinlich mit dem Löschen zu spät; und wer vor der Wahl der Studienrichtung steht und blindlings die Wahl des ‚besten Freundes‘ kopiert, stellt möglicherweise die Weichen für ein ganzes Leben falsch.
- Hinter solchem Verhalten stecken aber nicht Schwächen der Vernunft, sondern Schwächen oder allenfalls das Unvermögen von Menschen, sich situativ richtig zu verhalten. Der Begriff der ‚Situativität‘ kommt meines Erachtens bei Urbaniok viel zu kurz. In sehr vielen Fällen, vor allem in denjenigen, in denen Geschwindigkeit keine Rolle spielt, kann der Mensch nämlich frei wählen, ob er sich vom schnellen oder vom langsamen System leiten lassen will.
- Auch wenn Metaphern wie «es raschelt hinter dem Zelt, also muss ein Löwe da sein, also Flucht…» einprägsam sind und das entsprechende Verhalten mit der evolutionären Prägung einleuchtend erklärbar sein mag, kann oder muss man sich tatsächlich fragen, ob die Metapher in unserer Zivilisation des 21. Jahrhunderts, in dem kaum noch Menschen leben, die je in freier Wildbahn einem Löwen begegnet sind, noch ernst genommen werden kann.
- Per Saldo kritisiere ich an Urbanioks Buch, dass es Vernunft oder Rationalität schlechtredet und als dem Instinkt unterlegen darstellt.
- Das bringt mich zum letzten Punkt: Der Titel des Buchs lautet «Darwin schlägt Kant». Fairness gebietet, darauf hinzuweisen, dass Urbaniok selbst, jedenfalls bis auf Seite 130, diesen Titel oder einen dem Titel entsprechenden Gedanken nicht äussert. Natürlich kommen Kant und Darwin vor, Kant als Exponent der Erkenntnistheorie, und Darwin als Begründer und Ikone der Evolutionslehre.
Der Titel des Buchs ist erzdumm – etwa gleich dumm wie «Federer schlägt Mozart»! Er bringt nicht einmal die These Urbanioks, das schnelle Erkenntnissystem gewinne gegenüber dem langsamen meistens die Oberhand, adäquat zum Ausdruck, denn er impliziert, dass Darwin selbst mit dem ‚schnellen Erkenntnissystem‘ hinreichend erklärt sein könnte. Dabei ist gerade Darwin ein leuchtendes Beispiel dafür, dass das ,langsame Erkenntnissystem‘, situativ richtig eingesetzt, in Verbindung mit genauer, unvoreingenommener und scheuklappenfreier Beobachtung zu bahnbrechenden neuen Erkenntnissen führen kann.
Der Titel ist auch grundfalsch. Er verdrängt die Tatsache, dass auch die Vernunft durch evolutionäre Prozesse zu den Menschen gekommen ist. Es ist letztlich die Fähigkeit zur Vernunft, welche die Spezies Mensch so weit gebracht hat, dass sie sich – bis heute – gegenüber allen anderen Arten behaupten konnte und sich als diesen überlegen erweist. Ob es dem Menschen gelingt, diese Überlegenheit so einzusetzen, dass er die Lebensbedingungen auf dem Planeten Erde für die eigene Spezies soweit erhalten kann, dass die Spezies sich nicht selbst auslöscht, ist eine andere Frage. Aber nur schon die leise Suggestion, Intuition oder Instinkt wären dafür die bessere Grundlage, lässt einen erschauern und weckt Angst und Bangen vor einem Regime ‚Trump‘.
Der Titel ist auch eine Verhöhnung des Appells von Kant an die Menschen, sich aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit zu befreien und das eigenständige Denken zu wagen (‚sapere aude‘).
Es ist zu vermuten, dass der reisserische, aber idiotische und irreführende Titel von einen Verkaufs-fixierten Verlagsvertreter geprägt wurde. Urbaniok kann man vorwerfen, sich nicht dagegen gewehrt zu haben.