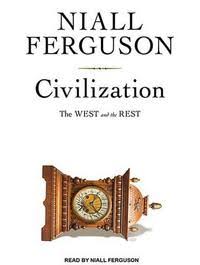
Ferguson setzt sich in seinem 2011 erschienen Buch auf knapp 400 Seiten mit der Frage auseinander, warum der sogenannte ‚Westen’ (gemeint ist damit im Wesentlichen die europäische Zivilisation und die von ihr geprägten Ausleger in Nord- und Südamerika sowie Südostasien, d.h. Australien und Neuseeland) in der zweiten Hälfte des zweiten Millenniums alle anderen Zivilisationen der Welt (in erster Linie die islamische und die asiatische Welt) wirtschaftlich und politisch überholt und weit distanziert haben.
Da Ferguson einer der renommiertesten englischen Historiker ist (er doziert und forscht in Harvard, Stanford und Oxford), kann man von ihm überzeugende Antworten erwarten – und man bekommt sie auch.
Unnötigerweise verwendet er für seine Erklärung die – aus meiner Sicht völlig unpassende – ‚zeitgeistige’ Metapher von sechs sogenannten Killer-Apps, mit denen der Westen den Rest der Welt distanziert hat. Es sind dies (übersetzt aus dem Schlusskapitel der englischsprachigen Hardcover-Ausgabe (Seiten 305-306):
- Wettbewerb; und das in einem Europa, das selbst politisch fragmentiert war, und in der in jeder Monarchie oder Republik zahlreiche konkurrierende kommerzielle Organisationen existierten
- Wissenschaftliche Revolution; alle bedeutenden wissenschaftlichen Durchbrüche des siebzehnten Jahrhunderts in den Bereichen Mathematik, Astrono0mie, Physik, Chemie und Biologie erfolgten in Westeuropa
- Eigentum; Herrschaft von Gesetz und repräsentativer Regierung; in der englischsprachigen Welt entstand ein optimales System von sozialer und politischer Ordnung, das auf privatem Eigentum und auf der Vertretung von Eigentümern in gewählten Gesetzgebungs-Organen basierte
Leider hat das entsprechende Kapitel 3 im Buch den Titel ‚property’. Wohl spielt das Privateigentum eine bedeutende Rolle. Der Hauptakzent liegt jedoch auf ‚rule of law’ (im Gegensatz zur Willkürherrschaft absolutistischer Herrscher), auf der damit eng verbundenen Gewaltenteilung, sowie auf der Vertretung der Betroffenen in den einschlägigen Gesetzgerbungsprozessen.
- Moderne Medizin; fast alle bedeutenden Entdeckungen des 19. und 20. Jahrhunderts in der Gesundheitspflege, einschliesslich die Beherrschung von tropischen Krankheiten, wurden in Westeuropa und Nordamerika gemacht
- Konsumgesellschaft; die industrielle Revolution fand dort statt, wo sowohl produktivitätssteigernde Technik zur Verfügung stand als auch eine Nachfrage nach mehr, besseren und billigeren Gütern, ausgelöst durch die Baumwollbekleidung
Ferguson bringt diese ‚Killer-App’ auch damit in Zusammenhang, dass im Westen erstmals der Zusammenhang erkannte wurde, dass Arbeitskräfte auch Konsumenten der sind, dass es sich also lohnen kann, sie so zu behandeln, dass sie auch fähig (d.h. zahlungsfähig) werden und die Zeit haben, um entsprechende Bedürfnisse zu entwickeln, die Produkte der industriellen Revolution auch selbst zu konsumieren.
- Arbeitsethik; die Menschen im Westen waren die ersten auf der Welt, die eine weit verbreitete und intensivierte Arbeitsleistung mit höheren Sparquoten kombinierte, was eine dauerhafte Akkumulation von Kapital ermöglichte
Die Hauptkapitel des Buchs sind so nummeriert, dass sie den sogenannten ‚Killer-Apps’ entspricht.
Leider – wie so oft in der Literatur, die wissenschaftliche Erkenntnisse popularisieren will – hätten die Grundgedanken Fergusons auf einem Viertel des Papiers Platz. Die Essenz befindet sich in den ersten drei Kapiteln (Wettbewerb, Wissenschaft, ‚rule of law’).
Der Rest ist eigentlich Garnitur, und teilweise Fremdkörper. Es ist beispielsweise nicht einzusehen, warum ‚Medizin’ in Kapitel 4 behandelt wird, und nicht als Teil der Wissenschaft (Kapitel 2). In Tat und Wahrheit ist Kapitel 4 nämlich hauptsächlich eine Philippika gegen Sklaverei und Kolonialherrschaft. Konsumgesellschaft (Kapitel 5) hätte genauso gut als Teil des Wettbewerbs (Kapitel 1) behandelt werden können. Arbeitsethik (Kapitel 6) wird eher zwiespältig behandelt: einerseits ist es mehr ein Exkurs über die Christianisierung der Welt und über das Christentum als bestimmendes Charakteristikum der ‚westlichen’ Zivilisation; anderseits wird nicht überzeugend dargelegt, warum die ‚protestantische’ Arbeitsethik so ausschlaggebend gewesen sein soll; und eine Erklärung der Unterschiede zwischen beispielsweise der angelsächsischen oder nordeuropäischen Ausprägung des Christentums und der südeuropäischen oder lateinischen fehlt ebenso.
Insbesondere geht Ferguson kaum darauf ein, dass die Aufklärung (sowohl Wurzel der wissenschaftlichen Revolution als auch der ‚rule of law’) die christlichen Grundlagen des ‚Westens’ weitgehend erodiert hat. Die Phase der Überlegenheit der westlichen Zivilisation beginnt paradoxerweise ja genau mit der Entmachtung der Religion und der alleinigen Deutungshohheit des Klerus; d.h. das Christentum eignet sich kaum mehr als Erklärung für diese Überlegenheit. Es wäre auch eine Überlegung wert, sich zu fragen, inwieweit die ‚protestantische Arbeitsethik’ auch sehr stichhaltige und überzeugend säkular damit begründet werden könnte, dass sie im Wesentlichen gar nicht auf Heilsversprechungen der Religion, sondern auf Selbstverantwortung und Eigeninteresse beruht.
Ich halte auch den Mangel an Begriffsbestimmungen und -abgrenzungen für problematisch. So wird beispielsweise im ‚grossen Bogen’ von der westlichen Zivilisation gesprochen – sie ist ja das eigentliche Thema des Buchs –, und wenn Ferguson für spezifische Entwicklungen Beispiele benötigt, spricht er vom russischen kommunistischen Regime und dessen Zusammenbruch, oder von der Finanzkrise 2007. Dabei sind solche Ereignisse – in Bezug auf die Entwicklung der westlichen Zivilisation im Vergleich zu ‚the Rest’ – unbedeutende Episoden oder nebensächliche Zufälle, keinesfalls zentrale Weichenstellungen, die für die gesamte Zivilisation repräsentativ sein könnten.
Ferguson geht mit Begriffen wie ‚Imperium’, ‚Nation’ oder eben auch ‚Zivilisation’ eher salopp um. Schon sein Buchtitel suggeriert etwas, das es so weder in der Wirklichkeit noch im Buch selbst gibt: Den ‚Westen’ und den ‚Rest’. Der ‚Westen’ oder der ‚Rest’ sind weder homogene, scharf voneinander abgegrenzte Zivilisationen, noch sind es in sich selbst homogene Entitäten. In den entsprechenden geografischen Räumen verlaufen gleichzeitig viele unterschiedlichen wirtschaftliche oder politische Entwicklungen. Als Leser muss man sich damit abfinden, dass Ferguson einen vielfach im Unklaren lässt, ob jetzt die Türkei selbst ein Imperium ist (dass das Osmanische Reich eines war, darf man wohl annehmen), ob sie zur islamischen oder europäisch-westlichen Zivilisation gehört, etc.; auch zivilisatorische Unterschiede (Religion, politischer Grundkonsens, wirtschaftliche Dynamik) zwischen Nordamerika und dem Rest des Westens werden in Fergusons Vogelschau häufig eingeebnet oder vernachlässigt.
So oder so: die Lektüre von «Civilization» lohnt sich allemal. Ferguson liest sich sehr unterhaltsam (reich an historischen Anekdoten und exzentrischen Details) und macht einem immer wieder bewusst, dass der ‚Erfolg’ von Zivilisationen (im Grossen und im Kleinen) nicht das Ergebnis eines ‚grand design’ sein kann, sondern eher zufällig und flüchtig ist; und das Wichtigste: zivilisatorischer Erfolg wird nicht geschenkt, sondern ist zu erarbeiten und mit harter Arbeit auch zu verteidigen und zu erhalten. Was er – leider, aber wohl unvermeidlich – offenlässt, ist die Frage: Wie steht es um die Zukunft der ‚Überlegenheit’ des Westens?
Im abschliessenden Kapitel ‚Conclusion : The Rivals’ setzt sich Ferguson zwar eingehend mit den Theorien der Zyklizität von Geschichte auseinander. Was ich vermisse, ist ein Ausblick auf die Möglichkeit, dass Zivilisationen nicht irgendwelchen zyklischen Regeln folgen (wie die Jahreszeiten, bei denen auf den scheinbaren Tod im Winter der Frühling wieder schön die Wiedergeburt kommt…), sondern einem ganz normalen evolutionären ‚survival of the fittest’; in strikt evolutionärer Sicht ist ja jede Entwicklungsstufe entweder eine Zwischenstufe – oder ein Endpunkt der Entwicklung. Auf den Westen übertragen würde sich die Frage stellen, ob er nicht ganz einfach den Endpunkt seiner Entwicklung erreicht hat; die Begründung könnte sein, dass er die Fähigkeit zum ‚survival’ verloren hat, weil er die Antriebskräfte, die mit der Aufklärung aktiviert wurden (Rationalität; Eigenverantwortung; Verzicht auf ein Jenseits, das für Leiden im Hier und Jetzt entschädigt; etc.) aufgebraucht hat; weil er nicht mehr die Mühe auf sich nehmen will, die Freiheit, die mit der Entthronung der Religion gewonnen wurde, auch tatsächlich zu verteidigen, zu leben, zu tragen und zu ertragen.
Und das hat man davon, wenn man meint, eine ‚Rezension’ ein paar Seiten vor dem Ende des Buchs abschliessen zu können – man wird bestraft. Auf den letzten drei Seiten geht Ferguson genau auf die Aspekte ein, die ich in den letzten paar Abschnitten angesprochen habe. Am besten lasse ich Ferguson selbst zu Wort kommen (in meiner Übersetzung von Zitaten aus den Seiten 323-325):
- «Die Westliche Zivilisation ist mehr als eine einzige Sache; sie ist ein Paket. Es geht bei ihr sowohl um politischen Pluralismus (viele Staaten und zahlreiche Autoritäten) als auch um Kapitalismus; sowohl um Gedankenfreiheit als auch um den Einsatz wissenschaftlicher Methoden; es geht bei ihr sowohl um die Vorherrschaft des Gesetzes als auch um Eigentumsrechte und Demokratie. Auch heute noch hat der Westen mehr von diesen institutionellen Vorteilen als der Rest.»
- «Die Chinesen kennen keinen politischen Wettbewerb. Die Iraner anerkennen keine Gewissensfreiheit. In Russland dürfen sie wählen, aber die Vorherrschaft des Gesetzes ist ein Schwindel. In keinem dieser Länder gibt es eine freie Presse. Diese Unterschiede mögen erklären, weshalb beispielsweise alle drei Länder hinter dem Westen herhinken.»
- «Die grosse Frage ist, ob wir immer noch dazu fähig sind, die Überlegenheit dieses Pakets anzuerkennen. Was eine Zivilisation für ihre Bewohner zur Wirklichkeit macht, ist schliesslich nicht das prächtige Gebäude in seinem Zentrum, noch das einwandfreie Funktionieren der Institutionen, die dort zuhause sind. In ihrem Kern besteht eine Zivilisation aus den Texten, die in ihren Schulen gelehrt werden, von ihren Schülern gelernt und in widrigen Zeiten wieder in Erinnerung gerufen werden.»
- «Die Zivilisation von China wurde einmal auf den Lehren von Konfuzius aufgebaut. Die Zivilisation des Islam – des Kults der Unterwürfigkeit – baut immer noch auf dem Koran auf. Aber welches sind die fundamentalen (‚begründenden’) Texte der westlichen Zivilisation, die unseren Glauben an die beinahe unbegrenzte Kraft des freien individuellen menschlichen Wesens stärken? Und wie sind wir darin, sie zu lehren, unter Berücksichtigung der Aversion unserer Erziehungstheoretiker gegen formales Wissen und Auswendiglernen?»
In einer Fussnote regt Ferguson folgende Liste an: King James Bible, Isaac Newton’s Principia, John Locke’s Two Treatises of Government, Adam Smith’s Moral Sentiments und Wealth of Nations, Edmund Burke’s Reflections on the Revolution in Fance und Charles Darwin’s Origin of Species – sowie William Shakespeare’s Stücke und ausgewählte Reden von Abraham Lincoln und Winston Churchill. Wenn Ferguson selbst nur ein einziges Werk als seinen ‚Koran’ wählen müsste, wären es Sheakespeare’s gesammelte Werke.
- «Vielleicht ist unsere grösste Gefahr nicht China, nicht der Islam oder die CO2-Emissionen, sondern unser eigener Verlust in das Vertrauen in die Zivilisation, die wir von unseren Vorfahren geerbt haben.»
- «Churchill traf ins Schwarze, als er «die Unterordnung der herrschenden Klasse unter das bestehende Gewohnheitsrecht des Volkes und unter den in dessen Verfassung ausgedrückten Willen» definierte:
Warum [fragte Churchill] sollen sich Nationen nicht in grössere Systeme zusammenschliessen und eine Rechtsordnung zum Nutzen aller errichten? Das ist sicher die höchste Hoffnung, die uns inspirieren sollte…
Aber es ist müssig, sich vorzustellen, dass allein … die Erklärung der richtigen Prinzipien … etwas wert sein könne, solange diese nicht von denjenigen hochstehenden Bürgertugenden und dem menschlichen Mut – und ja, durch diejenigen Instrumente und Organe von Macht und Wissenschaft – unterstützt werden, die in letzter Konsequenz nichts anderes sein können als die Verteidigung von Recht und Vernunft.
Zivilisation wird nur dann überdauern, Freiheit nur dann überleben, Frieden nur dann eingehalten, wenn sich eine sehr grosse Mehrheit der Menschheit zusammenschliesst, um diese zu verteidigen und sich als Besitzer der staatlichen Macht erweist, vor der barbarische und primitive Kräfte ehrfürchtig einhalten.»
1938 waren derartig barbarische und primitive Kräfte im Ausland [natürlich aus der Perspektive von Churchill oder Ferguson] am Werk, vor allem in Deutschland. Allerdings, wie wir gesehen haben, waren diese ebenso sehr Produkte der westlichen Zivilisation wie die Werte der Freiheit und des gesetzgebundenen Regierens, die Churchill so sehr hochhielt. Heute, wie damals, wird die westliche Zivilisation nicht am stärksten von anderen Zivilisationen bedroht, sondern von unserem eigenen Kleinmut – und von der Unkenntnis unserer Geschichte, die ihn nährt.
Meines Erachtens ist es sehr schade, dass Ferguson diese – zugegebenermassen – pessimistischen Gedanken nur kursorisch ganz ans Ende seiner im Übrigen brillanten Analyse stellt. Letztlich sagt er damit auch, dass seine sogenannten sechs Killer-Apps eigentlich gar nicht die eigentliche Ursache der Dominanz der westlichen Zivilisation sind, sondern unsere Zivilisation. Aber das kann oder darf er wohl nicht, denn er geriete damit auf die schiefe Ebene der politischen Unkorrektheit, indem er indirekt sagen würde, unsere Zivilisation sei allen anderen überlegen. Und das will ja niemand…