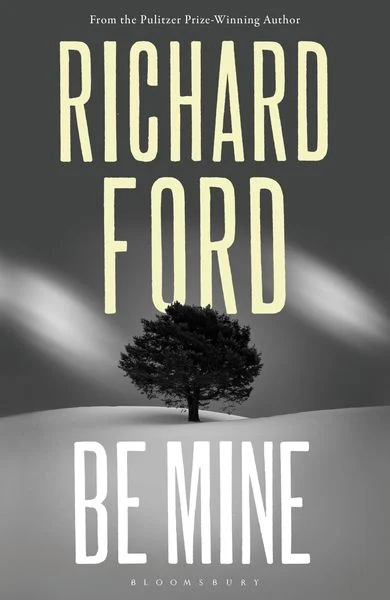
Ich habe dieses Buch gelesen, weil mich die erste Buchbesprechung, mit der mir ein Freund die Lektüre des Buchs empfohlen hatte, überzeugte, und natürlich, weil ich den Autor Richard Ford schon kannte und – vor allem wegen seiner Kurzgeschichten – schätzte.
Das Buch hat mich allerdings kalt gelassen. Ford schreibt so, wie immer: sprachlich hochstehend und anspruchsvoll, phantasiereich und bissig. Seine Dialoge packen einen, auch die irreal aberwitzigen und surrealen Gespräche zwischen Vater und Sohn (Frank und Paul Bascombe), die sich beide bewusst sind, dass sie nach ihrer verkorksten Beziehung die letzten Lebensmonate von Paul gemeinsam verbringen und erleben. Dieses gemeinsame Erleben, einschliesslich einiger Rückblenden ist das zentrale Thema des Buchs, nicht das sich selbst immer fremder werdende Amerika, und schon gar nicht Trump. Es geht um die Konfrontation der beiden – nach üblichen gesellschaftlichen Massstäben – Versager. Beide verweigern den Ehrgeiz, das Beste aus sich selbst zu machen; Frank, der Vater, indem er ambitionslos von Beruf zu Beruf mäandert, dabei durchaus gewisses Talent zeigt (z.B. als ,home wisperer’), sich aber nie richtig engagiert und hineinkniet; Paul, der Sohn, weil er mit 47 Jahren noch gar nicht erwachsen geworden ist, weil er sich schon weigert, sich ein Ziel vorzunehmen, sich mit Gelegenheits- und Hilfsarbeiten soweit über Wasser hält, dass er knapp davon eben kann, aber auch nicht mehr.
Die Tatsache, dass Paul die Diagnose ALS bekommen hat, wagt er seinem Vater Frank gar nicht selbst zu sagen; er benutzt seine jüngere Schwester als Überbringerin der schlechten Nachricht. Aufgrund des Psychogramms von Frank lässt dieser völlig unerwartet abrupt alles liegen und kümmert sich umgehend und mit einem Engagement, das er in seinem ganzen Leben noch nie gezeigt hat, um die Rund-um-die-Uhr-Betreuung von Paul. Er beschafft ihm einen Platz in einem einschlägigen ALS-Forschungsprogramm der Mayo-Klinik und setzt sich, nachdem Paul gewissermassen austherapiert ist, in den Kopf, diesem unbedingt das Präsidenten-Monument am Mount Rushmore zu zeigen. Das gelingt ihm sogar mit Erfolg, mit einem angesichts der körperlichen Behinderungen von Paul völlig ungeeigneten Old-Timer-Camper. Der Besuch findet zufällig am Valentinstag statt; es ist aber völlig unverständlich, dass dieser an sich belanglose Umstand der deutschsprachigen Version des Buchs den Titel gegeben hat. Die einzige Rechtfertigung dafür könnte sein, dass die Bedeutung des englischen Titels der Originalausgabe «BE MINE» ebenso unverständlich ist.
Die Reise von der Mayo-Klinik in Rochester (Minnesota) zum Mount Rushmore ist eine Art ,road fiction’; Richard Ford schildert interessante Begegnungen mit Bewohnerinnen und Bewohnern dieses ländlichen Teils der USA und spiegelt eine Gesellschaft, die himmelweit entfernt vom Milieu der Trumpanhänger oder der woken Küstengrossstädte ist. Trump erhält einige beiläufige abschätzige Spritzer, was aber keineswegs rechtfertigt, ihn – wie in der Besprechung von Nils Minkmar (Tagesanzeiger) – zum zentralen Thema des Buchs zu erheben.
Mein Eindruck ist allerdings, dass Richard Fords Phantasie mit dem Plot «entfremdeter Sohn hat ALS, Vater übernimmt Vollzeitpflege und fährt mit Sohn von Rochester zum Mount Rushmore» erschöpft war. Die Geschichte plätschert so vor sich hin. Ein grösserer Spannungsbogen fehlt. Eine tiefe Auseinandersetzung über sich aufdrängende Fragen wie Leben und Tod, oder mit dem Zustand der US-amerikanischen Gesellschaft findet nicht statt. Genauso unvermittelt wie Paul mit der ALS-Diagnose auftaucht, stirbt er. Richard Ford ist müde geworden.
So gesehen erscheint mir die zweite der zitierten Buchbesprechungen als eher zutreffend (Julia Kohl, NZZaS). Sie ist allerdings zu sehr ein Verriss und banalisiert den Anspruch Fords, in «BE MINE» die Geschichte von ganz gewöhnlichen Menschen, die mit einer aussergewöhnlichen Situation umzugehen haben, zu erzählen. Ausserdem kommt die Würdigung von Fords souveränem Umgang mit der Sprache, seines Humors und seiner kunstvollen Dialoge zu kurz.
Die Gegenüberstellung der beiden nachstehend wiedergegebenen, von professionellen Buchkritikern verfassten Besprechungen von «BE MINE» (in der deutschsprachigen Version «Valentinstag» illustriert, wie unterschiedlich ein und dasselbe Buch aufgenommen werden kann. Sie ist aber gleichzeitig eine Warnung vor Buchbesprechungen; man kann nämlich nie sicher sein, ob ein Kritiker extrem zum Verriss neigt oder dazu, ein Buch allzu sehr an seinem eigenen Weltbild auszurichten oder gar dazu, ein Werk nach sein eigenen Weltbild zurecht zu biegen. Wenn man’s genau nimmt, gibt’s nur eins: Selber lesen!
Buchkritik 1:
Vom Ende des Westens (Tagesanzeiger, ≈25.8.2023)
Neuer Roman von US-Autor Richard Ford Endlose Schnellstrassen, schäbige Motels und Donald Trump: Im phänomenalen Buch «Valentinstag» bereisen Vater und Sohn ein Land, das sich selbst immer fremder wird.
Nils Minkmar, Tagesanzeiger, ≈25.8.2023
Es ist schon das fünfte Buch, das Richard Ford über Frank Bascombe schreibt. Mit dem «Sportreporter» lernten wir den jungen Frank kennen, verfolgten seine Biografie dann in «Unabhängigkeitstag», der «Lage des Landes» und in dem Geschichtenband «Frank». Der neue Roman soll nun der letzte in der Reihe sein. Aber Clint Eastwood dreht ja auch sehr viele letzte Filme.
Die Rahmenhandlung von «Valentinstag» ist schnell erzählt: Frank Bascombes Sohn Paul leidet an einer unheilbaren Krankheit, und beide machen, nach dem finalen Aufenthalt des Sohnes in der Klinik, über den Valentinstag eine Tour im Wohnmobil zum Mount Rushmore – dem Felsen mit den Gesichtern von vier US-Präsidenten – Washington, Jefferson, Roosevelt und Lincoln. Die Umstände der Geschichte sind also schrecklich. Und was Vater und Sohn da am Mount Rushmore sollen, ist ihnen selbst unklar, aber das tut dem Vergnügen keinen Abbruch. Nicht alles im Leben wird von Sinn und Zweck regiert, und es gibt weit mehr wichtige Gefühle, als unsere Kinofilmweisheit vermuten lässt – das ist die fröhliche Moral, die Ford hier entfaltet.
Die alte amerikanische Welt steht kopf
In ihrer Ratlosigkeit liegt eine Form der Freiheit, die Vater und Sohn mit schwarzem Humor ausleben. Beide geniessen den Besuch absurder Institutionen wie eines Mais-Museums, ihre Freude entspricht so gar nicht den von solchen Einrichtungen intendierten Empfindungen, ist aber real und ansteckend.
Es sind die Jahre der Präsidentschaft Donald Trumps, und die amerikanische Welt, wie Bascombe sie kannte, steht kopf. Ein Merkmal der alten Ordnung war das Leistungsprinzip: Sportler waren Helden, weil ihre Rekorde für sich sprachen. Präsident wurde man aufgrund gewisser Fähigkeiten, Bildung spielte eine Rolle für den Status, und all das setzen Trump und die ideologischen Mächte, die ihn ins Amt befördert haben, ausser Kraft. Figuren kommen zu Ruhm und Geld, von denen das nie zu erwarten gewesen wäre, und alle machen so ihr Ding, pflegen ihre Werte und ihre Weltsicht, wie man den eigenen Vorgarten pflegt.
Bascombe ist eher ein Mann für öffentliche Parks und Sehenswürdigkeiten, aber diese entwickeln sich in den Vereinigten Staaten der Gegenwart zu Denkmälern der Absurdität: Zwischen dem Kult des Individuums und der Privatisierung des öffentlichen Raums bleibt der universelle Gehalt des republikanischen Ideals auf der Strecke. Bascombe liebt aber den Gedanken, Teil einer Gemeinde zu sein. Doch es geht nicht ganz auf: Immer wenn Bascombe eine städtische Freifläche betritt, sorgt er sich kurz über die Möglichkeit eines versteckten Amokschützen, der in die Menge feuert. Urbane Öffentlichkeit als Risikozone.
Bascombe durchquert das Land wie der Schadengutachter einer Versicherung nach einem Grossereignis. Erfreut über jedes Fragment der ursprünglichen Ordnung, alles andere wie zwanghaft protokollierend. An manchen Stellen wirkt es, als könnte Ford selbst nicht glauben, wie seltsam beliebig und egal das Land sich selbst geworden ist. Wie einst die Kandidaten bei Rudi Carrells «Am laufenden Band» zählt er atemlos auf, welche Läden und Filialen an so einer amerikanischen Vorortstrasse ihre Kundschaft erwarten, was für Shops in einer Mall zu finden sind und wie die Hotels beschaffen sind, wenn man über Land fährt. Wenig Qualität, viel Zwielicht. Toll ist es nicht.
Wie Michel Houellebecq deutet Ford die touristisch wahrnehmbare Oberfläche seiner Heimat als Symptom grösserer Probleme. «Valentinstag» ist ein Roman, der wie sein Protagonist in zurückhaltend-eleganten Klamotten daherkommt, dann aber viel mehr möchte und das auch spielend
Er folgt der Perspektive eines alten weissen Mannes
Man soll sich nur nicht von der die Veröffentlichung begleitenden Ansage abschrecken lassen, dies sei Fords letzter Roman mit Frank Bascombe, und deshalb eine Summe mehr oder weniger konventioneller Weisheiten erwarten. Die Lektüre von «Valentinstag» gleicht eher einer Fahrt im Kajak durch Stromschnellen: erschreckend, unvorhersehbar und aufwühlend. Und herrlich.
Ford hält es wie Michel de Montaigne und schreibt über das Thema, mit dem er sich am besten auskennt, nämlich sich selbst. So folgt das Buch konsequent der Perspektive eines alten weissen Mannes von Mitte siebzig, mit allen blinden Flecken, die sich aus so einer Position ergeben. Geld zum Beispiel ist genug da. Man merkt es daran, dass es nie Thema ist. Der Roman ähnelt seinem Protagonisten und ist insofern ein Zeugnis von dessen sozialer und kultureller Perspektive: Frauen sind Ex, mögliche Objekte der Begierde oder Nervensägen, manchmal all das.
Immer wenn er sich aus der erzählerischen Komfortzone herausbegibt und beispielsweise schildert, wie eine junge schwarze Frau so drauf ist, klingt es bemüht und nicht besonders überzeugend. Ford gerät dann in einen literarischen Furor, wie man ihn auch bei Jeffrey Eugenides und Jonathan Franzen lesen kann: Sie vermögen so viel, dass sie plötzlich wie im Rausch auch noch detailliert beschreiben müssen, was eine Randfigur in ihrer Handtasche mit sich trägt oder was die Oma im Vorratsschrank aufbewahrt. Das ist nicht falsch, aber es wirkt schon wie Jungs, die ihr Mountainbike auf das Hinterrad stellen, um andere zu verblüffen. Einfach, weil sie es können.
Am Ende der Reise zum Mount Rushmore liest man langsamer, weil die existenzielle Ungeschicklichkeit und der schräge Sarkasmus der beiden Bascombes so einnehmend sind. Dazu trägt in der deutschen Fassung die virtuose Übersetzungskunst von Frank Heibert bei, der die ford’sche Philosophie der Albernheit und das leicht Antiquierte der bascombeschen Sprache genau trifft.
Noch während Richard Ford beschreibt, wie sehr der Westen und seine Kultur, zu der die Idee vom grossen Gesellschaftsroman gehört, am Ende sind, beweist er in cooler Dialektik, dass das Ende der Literatur immerhin noch fern ist.
Buchkritik 2:
Richard Ford verbietet sich selbst das Wort (in «Valentinstag; «BE MINE» übersetzt von Franz Heibert)
US-Literatur: Der Pulitzer-Preisträger legt seinen letzten Frank-Bascombe-Roman vor. Der Protagonist nimmt seinen todkranken Sohn auf einen Roadtrip – das endet in einem abgehalfterten Schwank
Julia Kohli, NZZaS, 24.9.2023
Mit «Valentinstag» beendet der Pulitzerpreisträger und US-Bestsellerautor Richard Ford eine fünfteilige Romanserie, die aus den Beobachtungen eines weissen, abgekämpften Amerikaners namens Frank Bascombe, Jahrgang 1945, besteht. Zahlreiche Schicksalsschläge haben den gescheiterten Schriftsteller, Ex-Sportjournalisten und Ex-Immobilienverkäufer gezeichnet: Er hat einen 9-jährigen Sohn verloren und danach seine erste Frau. Im neusten Werk erhält sein zweiter Sohn, der 47-jährige Paul, die Diagnose ALS – eine Nervenkrankheit, die meist zum Tod führt.
«Das Gefühl, wenig mit ihm gemeinsam zu haben, hatte ich nie häufiger als in diesen Tagen und Wochen seines Dahinschwindens», stellt Frank fest. Obwohl das Vater-Sohn-Verhältnis auf gegenseitiger Abneigung beruht, setzt er sich in den Kopf, den ewig pubertierenden Sohn zu pflegen und ihn zum 960 Kilometer entfernten Mount-Rushmore-Monument zu fahren. Wenige Tage vor dem Valentinstag kauft sich Frank also ein Wohnmobil und entführt seinen Sohn samt Rollstuhl aus der Mayo-Klinik in Rochester, Minnesota, wo ohnehin nichts mehr für ihn getan werden kann.
Franks gute Tat beruht auch auf schlechtem Gewissen: Beim ersten Sohn flüchtete er sich in die Arbeit, als dieser mit dem Reye-Syndrom im Sterben lag. «Mein Geist schottet sich gegen zu viel Schlechtes ebenso ab wie gegen zu viel Gutes – das war immer mein Problem», weiss er.
Das könnte das Setting für eine brillante Road-Novel sein, die mitten in die Kommunikationshölle dieser zwei Männer vordringt, die aus schlüpfrigen Witzen und Pöbeleien à la «Fick dich, du bist ein Idiot» besteht. Leider aber muss die Leserin Franks innerem Monolog beiwohnen. «Onkel Theobald berichtet, was er alles sieht und sichtet – doch man sieht’s auch ohne ihn», schrieb einst Erich Kästner in seinem Gedicht «Im Auto über Land». Ein berichtender Onkel Theobald wäre eine Wohltat gegenüber Frank, der über alles und jeden seine abgelutschte Meinung kundtut: «Dass wir Frauen einfach mögen, dürfen wir Männer nicht mehr sagen» ist einer von seinen Geistesblitzen. Oft denkt er über die drei Frauen nach, in die er momentan verliebt ist. Die vietnamesische Masseurin, so findet Frank aber, «hat praktisch keinen Hintern, das gefällt mir nicht». Ähnlich einfallsreich: Sieht er eine schwarze Familie, nennt er sie in Gedanken «die Afrikaner». Damit die Erzählung nicht zu einer ranzigen Schmunzelorgie für Ewiggestrige wird, stellt sich Frank zwischendurch die ganz grossen Fragen, zum Beispiel: Was ist Glück? Darüber hat in den USA noch niemand nachgedacht.
Aus diesem Buch schreit es zudem unentwegt, dass hier gerade der «grosse Chronist Amerikas» die Seele seines Landes erklärt. Das geschieht zum Beispiel, indem unnötig detailgetreu die Ausstattung des Wohnmobils beschrieben oder ein traumatisches Basketballspiel aus der Kindheit wiedergekäut wird. Zu allem Überfluss tauchen in Franks Oberstübchen oft Heidegger, Nietzsche oder Tschechow auf, um seinen seichten Gedanken etwas Glanz zu verleihen.
Leider kann weder die Nähe zum Tod noch eine Prise europäischer und russischer Denker etwas gegen die Abgedroschenheit dieses Romans ausrichten. «Es ist komplett sinnlos und lächerlich, und es ist super», sagt Paul beim Anblick der Rushmore-Präsidentenköpfe. Eine Aussage, die die Selbstzufriedenheit des ganzen Buches widerspiegelt.
Männer bleiben hier Männer, «Arschloch» ist eine Liebeserklärung, politisch Unkorrektes soll für Schenkelklopfer sorgen. Was Richard Ford damit wohl unfreiwillig zeigt: Er verbietet sich selbst das Wort und wagt es nicht, von Stereotypen abzuweichen – dabei besässe er alle Freiheiten der Fiktion.