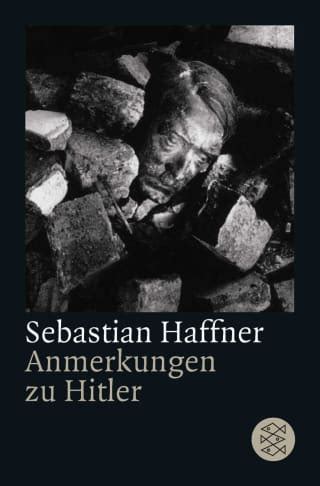
Das – trotz seines schweren Themas und vergleichsweise beiläufigen Titels – kurz und bündig abgefasste Buch ist erstmals 1979 erschienen und schnell zum ,block buster’ geworden. Es wurde immer wieder neu aufgelegt und bleibt, mit Einschränkungen, auch heute noch aktuell. Meine Besprechung basiert auf der Taschenbuchausgabe des Fischer Verlags von 1999 (192 Seiten).
«Anmerkungen zu Hitler» ist inzwischen knapp 50 Jahre alt. Das Buch entstand in der Zeit der Sowjetunion und des Kalten Kriegs. Man merkt ihm bei seinen aktuellen Bezügen sein Alter an. 1979 erschien die Welt als ziemlich stabil geordnet, d.h. in zwei Blöcke aufgeteilt, die sich zwar feindlich gegenüberstanden, aber durch das atomare Gleichgewicht gegenseitig in Schach gehalten waren. Indien, China, überhaupt der asiatisch-pazifische Raum spielten im öffentlichen Diskurs keine Rolle; Afrika war immer noch der ,dunkle Kontinent’; Lateinamerika war eine Spielwiese für missionarische sozialistische Weltverbesserer oder ausbeuterische Autokraten, insgesamt eine Lachnummer. Wer damals eine Welt mit einer in ihre Einzelteile zerbrochenen Sowjetunion, mit einem Ring von ehemaligen Sowjetrepubliken als Nato-Mitglieder, einen Zweikampf USA–China, eine neue tief nach Europa reichende Seidenstrasse; Afrika als aufstrebenden und bald bevölkerungsreichsten und wirtschaftlich interessantesten Kontinent der Welt zur Diskussion gestellt hätte, wäre im besten Fall als geistig amoklaufender Phantast verlacht, aber eher als geisteskranker Spinner in die Psychiatrie versenkt worden.
Aus heutiger Sicht wirkt also vieles, was von Haffner als Gewissheit und historische Zwangsläufigkeit dargestellt wird, veraltet und obsolet. Was aber überwiegend auch heute noch Bestand hat, sind Haffners Analysen von Hitlers Charakter, total fehlender Fähigkeit oder Erfahrung zur Staatsführung und Empathie, von Hitlers Fehleinschätzungen und katastrophalen politischen und militärischen Massnahmen und Aktionen.
In «Anmerkungen zu Hitler» behandelt Sebastian Haffner Hitler in folgende 7 Kapitel: Leben, Leistungen, Erfolge, Irrtümer, Fehler, Verbrechen und Verrat. Der Titel ,Anmerkungen’ ist tiefgestapelt; denn er liefert nicht nur mehr oder weniger beiläufige Anmerkungen, sondern tief schürfende Analysen und Wertungen.
Oberflächlich ist klar, dass die verschiedenen Kapitel keine grosse Trennschärfe besitzen. Schon die Kapitel ,Leistungen’ und ,Erfolge’ erzwingen eine eingehende Differenzierung und Begründung; diese läuft darauf hinaus, dass Haffner unter ,Leistungen’ wertfrei Ergebnisse versteht von Hitlers Politik, oder auch einfach Ereignisse, die zu Hitlers Zeit und in Hitlers Einflussbereich passiert sind: demgegenüber konzentrieren sich Erfolge’ auf Dinge, bei denen ein kausaler Zusammenhang zwischen Hitlers Absichten und den Ergebnissen besteht. Bei den Kapiteln ,Irrtümer’, ,Fehler’ ,Verbrechen’ und ,Verrat’ ist eine Trennschärfe schon rein sprachlich kaum zu erwarten; dies zeigt sich im Text selbst, der häufig zwischen diesen Begriffen jongliert.
Das Kapitel ,Leben’ ist eine solide und kompakte Zusammenfassung der Epoche, in der Hitler gelebt und gewirkt hat, und der persönlichen Lebensgeschichte Hitlers. Für Menschen, die wie ich im Geschichtsunterricht kaum etwas darüber erfahren haben, ist das eine wertvolle Nachhilfestunde, oder das Schliessen einer beklagenswerten Lücke, welche die meisten Bildungs-Curricula der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts (und wohl auch der Gegenwart) hinterlassen haben. Das Kapitel zeigt sehr deutlich, dass Hitlers Werdegang (eines Nichtsnutzes, der bildungsfrei aufgewachsen ist und nichts gelernt hat) keinerlei Voraussetzungen schuf zu seinem späteres ,Erfolg’ als einer der einflussreichsten Politiker und grössten Verbrecher des 20. Jahrhunderts.
Haffners Text ist so kompakt, dass sich nur schon der Versuch, eine Kurzversion in Form einer Zusammenfassung zu erstellen, verbietet. So unangenehm das Thema ist, die Lektüre des Originals lohnt sich – ganz besonders für Nachgeborene.
Der rote Faden Haffners, der alle Kapitel miteinander verbindet und die ganze Geschichte auch zusammenhält, basiert auf drei Thesen:
- Hitlers Deutschland war geprägt vom Trauma des Verlierers des Ersten Weltkriegs, also Deutschlands, das – aus deutscher Sicht – zu Unrecht und einseitig verurteilten wurde; das war das Trauma, das der Versailler Vertrag ausgelöst und genährt hatte.
- Hitlers Erfolg war völlig substanz- und grundlos; er hatte keine Ausbildung, besass keinerlei Qualifikation und konnte sich auch nicht durch tatsächlich erbrachte Vorleistungen auszeichnen. Er beruht ausschliesslich auf seinem – von seinen Zeitgenossen so wahrgenommenen – rhetorischen Charisma.
Auf mich wirkt, nachdem ich einige Filmauszüge mit Hitlerreden gesehen und erduldet habe, ein Schreihals und besessener Fanatiker wie Hitler aber gar nicht charismatisch. Es ist für mich weder nachvollziehbar noch verständlich, dass dieser Hitler die deutsche Gesellschaft – immerhin eine zwar selbst ernannte Kulturnation, das Land der Dichter und Denker – derart verführen und ins Verderben führen konnte. - Sein Antrieb bestand aus zwei Obsessionen: Weltbeherrschung durch Deutschland (und somit Überwindung des Traumas) einerseits und Vernichtung der Juden anderseits. Er hatte über den Drang nach Osten (Unterwerfung der Sowjetunion) hinaus nicht die geringste Vorstellung, wie er mit welchen Ressourcen und über welche Zeiträume hinweg die Weltherrschaft erlangen und bewahren könnte. Es fehlte ihm auch die Einsicht, dass seine zweite Obsession, die Auslöschung des Judentums, der Erlangung der Weltherrschaft im Wege stehen musste, weil er sich damit Feinde schuf, die ihn bei der Erlangung der Weltherrschaft hätten unterstützen können.
Hitlers Einschätzung der ihn umgebenden Welt war so voller Fehler und Irrtümer, dass er zwangsläufig im Verderben enden musste. Er hat letztlich das Gegenteil seiner Obsessionen erreicht: bedingungslose Kapitulation und weitgehende Zerstörung seines Landes; Stärkung der Sowjetunion; Gründung von Israel, trotz Auslöschung von Millionen von Juden.
Haffner bringt das Fazit von Hitler sehr gut und prägnant auf den Punkt (Seite 115): «Hitler hat nichts ausgerichtet, sondern nur (aber immerhin) Ungeheuerliches angerichtet.»
In Kapitel «Fehler» befasst sich Haffner mit der Frage, welche der beiden Geschichtsauffassungen zutreffender ist (Seiten 113 und 114):
- erstens (Seite 113) die «Tendenz, Geschichtsschreibung so weit wie eben möglich einer exakten Wissenschaft anzunähern, also Gesetzmässigkeiten zu suchen, das Augenmerk hauptsächlich auf soziale und ökonomische Entwicklungen zu richten, wo solche Gesetzmässigkeiten am ehesten zu vermuten sind, die Rolle der eigentlichen politischen Elemente in der Geschichte dementsprechend herunterzuspielen und insbesondere den Einfluss der Politik gestaltenden Einzelpersönlichkeiten, der ,grossen Männer’, auf den Geschichtsverlauf geradezu abzuleugnen.»
- zweitens «dass gerade ein Phänomen wie Hitler beweist, dass diese ganze historische Richtung auf dem Holzweg ist – ebenso übrigens wie die Phänomene Lenin und Mao, deren unmittelbare Wirksamkeit sich aber immerhin auf ihre eigenen Länder beschränkt (Anmerkung BB: für diese waghalsige Behauptung bleibt Haffner allerdings jede Begründung schuldig), während Hitler die ganze Welt in eine neue Richtung gestossen hat – freilich in eine andere, als er beabsichtigte; das macht seinen Fall so kompliziert und interessant.
Unmöglich kann ein Historiker behaupten, dass ohne Hitler die Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts genauso verlaufen wäre, wie sie verlaufen ist. Es ist durchaus nicht sicher, dass ohne Hitler ein Zwelter Weltkrieg überhaupt stattgefunden hätte; es ist ganz sicher, dass er sich, wenn er stattgefunden hätte, anders abgespielt hätte – möglicherweise sogar mit ganz anderen Bündnissen, Fronten und Ergebnissen.»
Offensichtlich favorisiert Haffner die zweite Geschichtsauffassung: «Die Welt von heute, ob es uns gefällt oder nicht, ist das Werk Hitlers. Ohne Hitler keine Teilung Deutschlands und Europas; ohne Hitler keine Amerikaner und Russen in Berlin; ohne Hitler kein Israel; ohne Hitler keine Entkolonialisierung, mindestens keine so rasche, keine asiatische, arabische und schwarzafrikanische Emanzipation und keine Deklassierung Europas. Und zwar, genauer gesagt: nichts von alledem ohne die Fehler Hitlers. Denn gewollt hat er das alles ja keineswegs.»
Das ist allerdings leider übler Hokuspokus; denn auf die Frage «Was wäre, wenn es Hitler nicht gegeben hätte?» kann es nur eine einzige rationale Antwort geben: «Wir wissen es nicht.» Der historische ,Waswärewennismus’, den Haffner hier betreibt, krankt grundsätzlich daran, dass er stillschweigend von der Annahme ,ceteris paribus’ ausgeht; Hitler hätte es zwar nicht gegeben, aber alles andere wäre gleich geblieben; das ist Nonsense. Denn eben: «Wir wissen das nicht, und wir können es nicht wissen.» Wenn wer anfinge, Geschichte a posteriori neu durchzudenken, müsste bereit sein, alle Parameter, nicht nur den fehlenden ,grossen Mann’, neu zu denken. Und dann entstünde ein Denkraum, der viel zu viele Variablen hat; das ergäbe eine unlösbare Gleichung. Vor allem sind das nutzlose, wenn auch möglicherweise intellektuell anregende Gedankenspielereien; Geschichte hat sich nun einmal so abgespielt, wie sie sich abgespielt hat. Da gibt es nichts mehr zu ändern. Und weil Geschichte sich nicht wiederholt, gibt es auch nichts zu lernen.
Die einzig sinnvolle Anwendung der Frage «Was wäre, wenn…» ist das zukunftsgerichtete Szenario-Denken. Jede vergangenheitsorientierte Anwendung ist Kaffeesatzlesung, ist intellektuelle Selbstbefriedigung.
Schliesslich begibt sich Haffner mit den erwähnten Aussagen zu dem was passiert wäre, hätte es Hitler nicht gegeben, ausgerechnet auf das Feld der von ihm verworfenen ersten Auffassung von Geschichte, nämlich dass alles vorbestimmt und gesetzmässig auf ein bestimmtes Ende der Geschichte hinauslaufen müsste.
Unabhängig von dieser Kritik lohnt sich die Lektüre des Kapitels «Fehler», denn Haffner stellt anregende und durchaus sinnvolle Überlegungen an zu Fragen wie «Warum werden Kriege geführt?», «Ist es sinnvoll, mehrere Ziele gleichzeitig zu verfolgen?»
Die Lektüre des Kapitels «Verbrechen» ist deprimierend. Die kompakte und nüchterne Schilderung von Hitlers Verbrechen (155ff), Massenmord an den (geistes)kranken Deutschlands (,unwertes Leben’), Ausrottung der Zigeuner (zu Haffners Zeit durfte man das Wort noch verwenden), die fast totale Vernichtung der polnischen Intelligenz- und Führungsschicht, Massenmord an der russischen Zivilbevölkerung, und schliesslich die industriell abgewickelte millionenfache Auslöschung der jüdischen Bevölkerung Europas, dies alles ist erschütternd und schockierend; Haffner stellt dabei hohe Anforderungen an die Leidensfähigkeit seiner Leserinnen und Leser.
Im letzten Kapitel «Verrat» schildert und begründet Haffner, dass und warum Hitlers grösstes Verbrechen der Verrat am deutschen Volk war. Nach Haffners numerischer und qualitativer Bilanz – deren Logik man durchaus in Frage stellen kann – hat Hitlers Politik dem deutschen Volk den grössten Schaden zugefügt. Er hat mit seiner grimmigen Entschlossenheit, den längst verlorenen Krieg nicht aufzugeben, sondern bis zum bittersten Ende zu führen, das deutsche Volk gewissermassen in den kollektiven Selbstmord führen wollen. Schon im November 1941 (Seiten 181-182), als die Möglichkeit des Scheiterns zum ersten Mal aufgetaucht war, sagte er: «Ich bin auch hier eiskalt. Wenn das deutsche Volk einmal nicht mehr stark und opferbereit genug ist, sein Blut für seine Existenz einzusetzen, so soll es vergehen und von einer anderen Macht vernichtet werden. Ich werde dem deutschen Volk keine Träne nachweinen.» Folgerichtig erliess er im März 1945, als Deutschland wirklich unwiderruflich geschlagen war, zwei Führerbefehle (Seiten 180-181). Im ersten verlangte er, die westdeutschen Invasionsgebiete «sofort, hinter dem Hauptkampfgebiet beginnend, von sämtlichen Bewohnern zu räumen». Hinweise aus seinem Umfeld, das sei in Anbetracht der Kriegslage und der fehlenden Transportmöglichkeiten völlig unmöglich, konterte er mit «Dann sollen sie zu Fuss marschieren». Im zweiten Führerbefehl verlangte er: «Alle militärischen Verkehrs-, Nachrichten-, Industrie- und Versorgungsanlagen sowie Sachwerte innerhalb des Reichsgebiets, die sich der Feind für die Fortsetzung seines Kampfes irgendwie sofort oder in absehbarer Zeit nutzbar machen kann, sind zu zerstören.» Gegenüber Albert Speer, dem damaligen Rüstungsminister, erklärte er dazu: «Wenn der Krieg verloren geht, wird auch das Volk verloren sein. Es ist nicht notwendig, auf die Grundlagen, die das deutsche Volk zu seinem primitiven Weiterleben braucht, Rücksicht zu nehmen. Im Gegenteil ist es besser, selbst diese Dinge zu zerstören. Denn das Volk hat sich als das schwächere erwiesen, und dem stärkeren Ostvolk gehört ausschliesslich die Zukunft. Was nach diesem Kampf übrigbleibt, sind ohnehin nur die Minderwertigen, denn die Guten sind gefallen.» Zynischer ist kaum möglich.
Haffners letzter Absatz verdient die ungekürzte Wiedergabe:
«Die Vernichtung Deutschlands war das letzte Ziel, das Hitler sich selbst setzte. Er hat es nicht ganz erreichen können, so wenig wie seine anderen Vernichtungsziele. Erreicht hat er damit, dass Deutschland sich am Ende von ihm lossagte – schneller als erhofft, und auch gründlicher. Dreiunddreissig Jahre nach dem endgültigen Sturz Napoleons wurde in Frankreich ein neuer Napoleon zum Präsidenten der Republik gewählt. Dreiunddreissig Jahre nach Hitlers Selbstmord hat niemand in Deutschland auch nur die kleinste politische Aussenseiterchance, der sich auf Hitler beruft und an ihn anknüpfen will. Das ist nur gut so. Weniger gut ist, dass die Erinnerung an Hitler von den älteren Deutschen verdrängt ist und dass die meisten Jüngeren rein gar nichts mehr von ihm wissen. Und noch weniger gut ist, dass viele Deutsche sich seit Hitler nicht mehr trauen, Patrioten zu sein. Denn die deutsche Geschichte ist mit Hitler nicht zu Ende. Wer das Gegenteil glaubt und sich womöglich darüber freut, weiss gar nicht, wie sehr er damit Hitlers Wunsch erfüllt.»
Ein prophetisches Wort, das im Jahr 2025 so aktuell und gültig ist wie 1979, vor rund 50 Jahren, als es geschrieben wurde.
Ein allerletzter kritischer Gedanke: Ich konstatiere, dass in Haffners «Anmerkungen zu Hitler» ein Ansatz zur Erklärung vollständig fehlt, wie es dazu kommen konnte, dass das Volk der Dichter und Denker bis hinauf zu seinen intellektuellen und kulturellen Eliten dem Verführer und Fanatiker Hitler bis zum schrecklichen Ende Folge leisten konnte. Meine eigene These dazu ist sehr intuitiv und erhebt keinen Anspruch auf Gültigkeit: Das deutsche Volk des 20. Jahrhunderts war über die vergangenen Jahrhunderte als Untertanenvolk sozialisiert und erzogen worden. Wer da nicht mitmachen wollte, war ausgewandert oder wurde umgebracht. Dass aber in allen Volksschichten nur Mitläufer, Profiteure und zum Teil fanatische Anhänger und Mittäter am Werk waren und kein klug organisierter Widerstand entstand, ist für mich ein Rätsel.