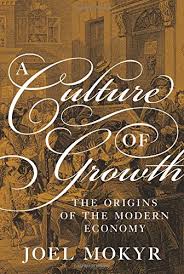
Mokyrs Kernfragen sind:
- Was waren die Ursachen der Industriellen Revolution im 18./19. Jahrhundert und des daraus entstehenden und sich über die über die ganze Welt ausbreitenden Wohlstands?
- Weshalb begann diese Revolution im sogenannten Westen und nicht anderswo auf der Welt?
Kultur des Wachstums, welche das Fundament für wissenschaftlichen Fortschritt und bahnbrechende Erfindungen legte, welche ihrerseits schliesslich eine explosionsartige technische und wirtschaftliche Entwicklung auslösten. Mokyr zeigt und begründet, dass Kultur – im Sinne eines kohärenten Kanons von Überzeugungen, Werten und Präferenzen, welche imstande sind, das Verhalten einer Gesellschaft zu verändern – ein ausschlaggebender Faktor für gesellschaftliche Transformationen ist.
Er illustriert, dass in der Periode 1500-1700 das politisch fragmentierte Europa einen wettbewerbsorientierten ‚Markt für Ideen’ sowie eine grosse Bereitschaft, die Geheimnisse der Natur zu erforschen, entstehen liess. In der gleichen Zeit bildeten brillante Denker ein als ‚Republic of Letters’ bekanntes Netzwerk, in dem sie ihre Ideen und Schriften frei verteilen und zirkulieren lassen konnten.
Die politische Fragmentierung Europas – mit dem dadurch ermöglichten und begünstigten kompetitiven Umfeld – und das für Intellektuelle der Zeit förderliche Umfeld erklären, weshalb die industrielle Revolution in Europa entstand, und nicht etwa in China, obwohl der dortige ‚state of the art’ bezüglich technischem Knowhow sowie naturwissenschaftlichen und philosophischen Erkenntnissen ein durchaus vergleichbares Niveau hatte. In China steuerte – und blockierte – eine herrschende Elite die wissenschaftliche und intellektuelle Erneuerung, während im zersplitterten Europa heterodoxe und kreative Denker jederzeit in einem anderen Land Zuflucht finden und von dort aus ihre Gedanken über alle Grenzen hinweg verbreiten konnten.
Das Buch scheint aus einer Vorlesungsreihe entstanden zu sein (die Titelseite enthält den Hinweis: «The Graz Schumpeter Lectures»; allerdings endet die Liste der Vorlesungen auf der Homepage der diese Lectures organisierenden Grazer Schumpeter Gesellschaft im Jahr 2007, und Professor Mokyr ist darauf nicht aufgeführt). Jedenfalls ist das Buch sehr gelehrt, enthält unzählige Zitate, z.T. von mir völlig unbekannten Autoren, und fast noch mehr Fussnoten und Erläuterungen. Mit der Fülle dieser Quellen und Hinweise ist zwangsläufig eine riesige Redundanz verbunden; die Stringenz der Argumentation von Mokyr wird dadurch eher vernebelt als unterstützt. Mein Eindruck ist, dass sich dieses Buch eher an die akademische Welt richtet, welche der Grundthese Mokyrs nachgehen will, als an ‚normale’ Leser, die diese These eher aus allgemeinem politischem oder gesellschaftlichem Interesse für verstehen und nachvollziehen möchten.
In Mokyrs theoretischen Überlegungen steht das Konzept des ‚cultural entrepreneur’ im Zentrum. Er versteht darunter Menschen, die – in ihrer jeweiligen Zeit – überkommene kulturelle Werte oder Überzeugungen über Bord werfen und mit neuen ersetzen wollen. Dazu gehört die zwischen 1500 und 1700 in der europäischen kulturellen Elite virulente Auseinandersetzung über das aristotelische oder deduktive Weltbild versus die induktive Sicht, die, basierend auf empirischen Beobachtungen natürlicher Phänomene, erkennt, dass bisher gültige ‚Glaubenssätze’ (z.B. die geozentrische Sicht des Universums) nicht mehr haltbar sind, weil sie durch diese Beobachtungen widerlegt werden. Als besonders prägende solche ‚cultural entrepreneurs’ porträtiert er Francis Bacon (1561-1626) und Isaac Newton (1642-1726).
Mokyr behandelt ausführlich den Zusammenhang zwischen der Auflösung des päpstlichen Monopols sowie der Entstehung einer multikonfessionellen Gesellschaft in Europa und der zunehmenden und sich beschleunigen Entwicklung des ‚state oft the art’ der Wissenschaften dank der ideellen Konkurrenz innerhalb der ‚Republic of Letters’. Ebenso gründlich geht er auf die wettbewerblichen Einflüsse, die durch die politische Fragmentierung des damaligen Europas begünstigt wurde. Er zeigt, dass die im gleichen Zeitraum dank technischen Neuerungen in Schifffahrt, Navigation und Schiffbau stattfindende Entdeckung neuer Welten eine grosse Offenheit für neue intellektuelle Horizonte entstanden ist und durch die Kontakte mit fremden Kulturen dank der Übernahme ‚fremden Wissens’ oder fremder Errungenschaften eine wesentliche Bereicherung der europäischen Wissenschaften erzielt wurde.
In den beiden letzten Kapiteln untersucht Mokyr, weshalb die Aufklärung und die industrielle Revolution in Europa stattfanden und nicht etwa in China. Mit gelegentlichen beiläufigen Hinweisen deutet er an, dass China sehr wohl auch für den Islam stehen könnte. Zunächst behauptet er, dass es keine grundsätzlichen Unterschiede zwischen Europa und China gibt, die derartige Umwälzungen in China verunmöglicht hätten; im Gegenteil: er weist darauf hin, dass im frühen Mittelalter Chinas Zivilisation weitaus weiter fortgeschritten war als die europäischen. Hauptsächlich sieht er folgende Gründe:
- China war ein zentral regierter und intellektuell sehr monolithischer Staat. Alles war darauf ausgerichtet, die geistig-intellektuelle Welt der herrschenden Eliten zu bewahren. Geisteswissenschaftler kümmerten sich (fast) ausschliesslich um die richtige Interpretation und Anwendung der klassischen chinesischen Lehren, nicht um die Gewinnung von neuen Erkenntnissen.
- In China gab es weder einen Bacon noch einen Newton. Die vor allem von Bacon propagierte Vorstellung, dass alles, was den materiellen Wohlstand der Gesellschaft mehren könnte, grundsätzlich zu unterstützen sei, fand in China nie einen günstigen Nährboden.
- In China wurde die Druckerpresse (mit ‚moveable types’ lange vor Europa erfunden. Sie diente aber bis ins späte 19. Jahrhundert nie dem Zweck, neues Wissen breit zu streuen und bekannt zu machen. Die chinesische Schrift mit ihren Tausenden von Zeichen war ein grosses technisches Hindernis.
- In China gab es im Unterschied zu Europa keinen Wettbewerb zwischen kleinräumig aufgeteilten Staaten um die besten Ideen oder Köpfe. Entsprechend entstand in China nie so etwas wie die ‚republic of letters’, welche in Europa alle Zensurbemühungen von Kirchen und Herrschern unterlaufen konnte.
- In China waren ‚savants’ und ‚fabricants’ meilenweit voneinander entfernt, sodass der Wert von ‚nützlichem Wissen’ nie grosse Wertschätzung bekam und dessen Propagierung keine Bannerträger finden konnte.
Mir erscheint die Theorie, dass Aufklärung und industrielle Revolution auch in China hätten stattfinden können, wenn es all diese Einschränkungen nicht gegeben hätte, als eher schale Umschiffung der politisch unkorrekten Aussage, die westliche Kultur sei eben den anderen Kulturen überlegen (gewesen). Es wäre meines Erachtens klüger und wahrhaftiger, zuerst die Kriterien festzulegen, die erfüllt sein müssen, damit eine Gesellschaft Fortschritt im Sinne von besserem Verständnis unserer Welt, Regierungs-Governance auf Basis von ‚rule of law’, Mitwirkung der breiten Bevölkerung, individueller Freiheit sowie Mehrung des Wohlstands des überwiegenden Teils machen kann. Basierend auf solchen Kriterien wäre es dann ein Leichtes festzustellen, welche Gesellschaften in Bezug auf diese Kriterien anderen überlegen waren oder sind. Ob dies dann für alle Ewigkeit so bleiben würde – das wäre eine andere Frage.
Per Saldo ist das Buch eine interessante, wegen der Redundanz und Wissenschaftlichkeit allerdings auch ermüdende Lektüre; es zeigt in aller Ausführlichkeit, dass und weshalb die ‚westliche’ Zivilisation in Bezug auf ihre Innovationskraft, naturwissenschaftlich unerschöpfliche Neugierde und ihren unbändigen Drang, dem Individuum und dessen Bedürfnissen ein höheres Gewicht beizumessen als einer gesellschaftlichen Norm, einzigartig ist. Es illustriert überzeugend, dass diese Zivilisation, unsere Zivilisation, kulturelle, wissenschaftlich-technische sowie ökonomische Leistungen hervorgebracht hat, von denen die gesamte Welt profitiert, an deren durch die lange Zeit ignorierten ‚Flurschäden’ verursachten negativen Folgen die ganze Welt allerdings auch leidet.
PS:Interessant finde ich, dass Mokyr das Buch von Niall Ferguson «Civilization: The West and the Rest» mit keinem Wort erwähnt. Er zitiert aktuellste Quellen bis 2017, aber Fergusons Buch, das die gleiche Frage wie Mokyrs Buch behandelt, ist keiner Erwähnung wert. Die Hypothese (u.a. in einer Buchbesprechung des Guardian festgehalten; https://www.theguardian.com/books/2011/mar/25/civilization-west-rest-niall-ferguson-review), dass Mokyr Fergusons ‚Killer App’-Theorie, die sich erklärtermassen an ein junges Publikum wendet, für pubertär hält, ist meines Erachtens kaum stichhaltig. Eher spielt hier professoraler Zickenkrieg eine Rolle.