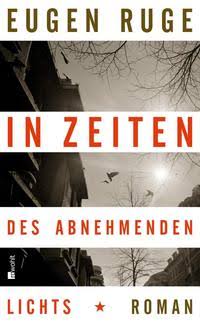
Wer sich überwinden kann, die eigentlich wirklich total abgelutschte Ostalgie der Deutschen nochmals aufzusaugen, trifft mit diesem Roman keine schlechte Wahl.
Es handelt sich um einen Familienroman (über vier Generationen), dessen Handlungsorte das Deutschland vor dem zweiten Weltkrieg, Russland, Mexiko, die DDR, die Bundesrepublik (der sogenannte «Westen») und das (wieder) vereinigte Deutschland sind.
Die Protagonisten sind
- Vertreter der deutschen intellektuellen Elite – Wilhelm und Charlotte Powileit, Urgrosseltern –, die zunächst vor dem Nazitum nach Russland fliehen (angezogen vom noch hell «strahlenden» Licht des Kommunismus und dessen Heilsversprechen der Wiederherstellung des Paradieses), aus Enttäuschung nach Mexiko auswandern und dort die possenhafte Rolle russischer/trotzkistischer Agenten spielen, nach dem zweiten Weltkrieg dann in die DDR zurückkommen, um dort am Aufbau einer besseren Welt mitzuarbeiten
- Kurt (Sohn aus Charlottes erster geschiedener Ehe) und Irina (geborene Petrowna, eine Russin) Umnitzer – Grosseltern –, ebenfalls in der Wolle eingefärbte Kommunisten; Kurt wird während seines Exils in Russland wegen einer kritischen Äusserung über den Hitler-Stalin-Pakt in den Gulag geschickt und nach Verbüssung der Haft auf «ewig» verbannt, später dann im Rahmen von Chruschtschows ersten Regimeänderungen begnadigt und kann mit seiner Frau Irina, die er in der Verbannung kennen gelernt hat, in die inzwischen gegründete DDR zurück; dort entwickelt er sich zum angepassten opportunistischen Regime-Intellektuellen
- Alexander Umnitzer, Sohn von Kurt und Irina, typisches Kind der DDR, Volkssoldat mit jahrelangem Einsatz zur Bewachung der Grenze, opportunistisch, etwas regimekritisch (ohne es zu sagen), Schürzenjäger, dessen Beziehungen aber alle auseinanderfallen, läuft mal einfach mit, bis er wenige Monate vor dem Mauerfall in den Westen geht
- Markus Umnitzer, missratener Sohn von Kurt, der sich weder in der DDR – noch vor dem Mauerfall – noch im vereinigten Deutschland moralisch zurechtfindet
Zusammengefasst charakterisiert:
- Wilhelm: zwar ein Ur-Kommunist, wird aber als Witzfigur vorgeführt
- Kurt: vom Gulag geprägt, unter dem DDR-Regime zum Opportunisten mutiert
- Alexander: DDR-Intellektueller, Grenzgänger zwischen Anpassung und berechnend harmlosem Meckern, zwischen akademischem Ehrgeiz (und das in der DDR) und sublimer Langeweile; experimentiert und kokettiert l mit seiner scheiternden Existenz
- Markus: schon mit 20 eine gescheiterte Existenz – was denn sonst bei dieser erblichen Belastung?
Der Roman ist süffig und mit viel sarkastischem Humor geschrieben, leidet aber an einem – unmotiviert, jedenfalls nicht erkennbar zwingenden – ständigen Hin- und Herschieben der Zeitachse.
Die handelnden Personen zeichnen sich aus durch entweder grenzenlose Naivität bezüglich der prokommunistischen Einstellung, oder durch einen abgründigen Zynismus gegenüber allem, was Politik, Staat und Gesellschaft darstellen können.
Die ‚typisch’ deutsche Haltung – die sich auch im Gegensatz von Ossie und Wessie zeigt – manifestiert sich im Titel des Buchs, der unterstellt, dass der Kommunismus je eine erstrebens- und unterstützenswerte Utopie (eben: ein strahlendes Licht) gewesen sein könnte (und jetzt, nach der Wende, an Strahlkraft abnimmt), und suggeriert letztlich, dass seine Anhänger von den kommunistischen Eliten getäuscht und missbraucht worden seien. Die Idee, dass der Kommunismus – genau so wie das Nazitum – a priori als Irrlehre erkennbar gewesen sein könnte, taucht nicht auf. Mit diesem «Trick» werden die enttäuschten ex-DDR-Kommunisten zu Opfern. Und wir alle dürfen auf die nächste Materialisierung dieser oder einer anderen Irrlehre hoffen, die dann – endlich – richtig umgesetzt wird, d.h. so, dass auf Erden wieder das Paradies ausgerufen werden kann.
Mit zunehmender Länge wird der Roman langfädig und abgedroschen; es ist schwer einzusehen, warum es der 90. Geburtstag von Wilhelm verdient, in sechs verschiedenen Kapiteln ausführlich und je aus der Perspektive einer anderen handelnden Person «zelebriert» zu werden. Der DDR-Mief, der dabei scharfzüngig präsentiert wird, gewinnt durch die Ausführlichkeit weder Profil, noch wird er geniessbarer.
Alexanders Vita zerbröselt ziemlich unmotiviert am Pazifik in Mexiko; er geht dorthin, vordergründig, um – nachdem bei ihm eine tödliche Erkrankung diagnostiziert wird – seinen Wurzeln nachzugehen; das wird aber nicht glaubwürdig, denn seine Bemühungen, dies auch tatsächlich zu tun, sind äusserst kärglich; es macht vielmehr den Eindruck, dass diese Reise aus Langeweile oder als Flucht vor seiner letzten gescheiterten Beziehung erfolgt; jedenfalls wirkt dieser Teil der Geschichte äusserst kitschig.
Die Deutschen können keine Komödie; sie überzeichnen und sind selten fähig, eine feine Klinge zu führen. Der Roman zeigt, dass auch die Mischung von satirischer DDR-Komödie mit tragischem Schmerz über den Zustand dieser Welt nicht geht. Er – der Roman – kann sich nicht entscheiden, was er nun sein will: eine parodistische oder sarkastische Abrechnung mit der DDR, oder eine Aufarbeitung eines Kapitels deutscher Geschichte, das etwas mehr an Tiefgang und Rationalität verdienen würde. Die sechsmal beschriebene Feier zum 90. Geburtstag von Wilhelm wird als linientreuer und miefiger Schwank inszeniert und reduziert die ganze Geschichte auf ein Schmierentheater. Dass Wilhelm am Schluss der Feier sogar noch stirbt, setzt dem Fass im wahrsten Sinn des Wortes die Krone auf.
Per Saldo: ein gut geschriebenes Buch, das viel zu lang geraten ist und die Lorbeeren, mit denen es vom deutschen Feuilleton überhäuft wurde, («überragend», «der grosse DDR-Buddenbrooks-Roman», etc.) nur deshalb verdient, weil seine moralisch zutiefst zersetzende Grundhaltung und sein Zynismus im heutigen deutschen Mainstream so eingefärbt sind, dass es nicht mehr auffällt.