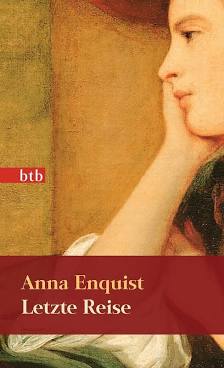
Roman über die Frau des Seefahrers James Cook, Elizabeth Cook, ab dem Ende der zweiten Reise Cooks in den Pazifik
Mit allem Respekt vor Elke Heidenreichs überschwänglichem Lob «Ein grossartiges Buch» – I beg to disgree:
Die «Letzte Reise» (gemeint ist James Cooks dritte Reise in den Pazifik, mit dem Ziel die Nord-West-Passage von der Beringstrasse aus zu entdecken) ist ein spannend und – bis auf das letzte Drittel – packend geschriebener Roman, der aber doch in den Papierkorb gehört. Er verstösst gegen die Grundanforderung, die an einen historischen Roman zu stellen ist, nämlich den ‚Zeitgeist‘ und die gesellschaftlichen und kulturellen Grundlagen der Epoche, in denen er spielt, zu respektieren.
Elizabeth Cook wird als eine Frau porträtiert, deren Mentalität dem 20. Jahrhundert entspricht. James Cook werden Gedanken und Wertvorstellungen unterstellt, die mit Sicherheit nicht dem 18. Jahrhundert entsprechen.
Der Roman lässt völlig offen, wieviel des Inhalts Fakt ist, und wieviel Fiktion. Die Autorin macht es sich extrem einfach, indem sie im Nachwort Leserinnen und Leser, die diese Grenze kennen möchten, auf die Literatur, die sie für den Roman verwendet hat, verweist. Jedenfalls ist klar, dass sie Alles der Logik unterwirft: Was gut ist, bestimme ich; und massgebend für mich ist dabei nur meine Betroffenheit, nicht etwa intensive intellektuelle Faktensuche, Analyse und Auseinandersetzung. Journaleinträge, die Cook unmittelbar vor seinem tragischen Ende geschrieben haben soll, sind offenkundig fiktiv, denn gemäss dem Roman selbst hat Elizabeth Cook die Originale dieser Niederschrift (von der es keine Kopien geben kann) verbrannt. Es ist unvorstellbar, dass Cook solche Journaleinträge gemacht haben könnte, denn sie zeugen von einem total verwirrten und kranken Geist, der mit Cooks sonstigem Verhalten schlicht und einfach nicht kompatibel ist.
Auch die Beziehungen Elizabeth Cooks mit der Admiralität, insbesondere ihre (platonische) Liebesgeschichte mit Hugh Palliser, passen überhaupt nicht ins 18. Jahrhundert, und schon gar nicht zur gesellschaftlich völlig unterschiedlichen Situation, in der sich Cook beziehungsweise Palliser befanden.
Der Roman lässt sich nur lesen, wenn man den Bezug der handelnden Personen zur historischen Periode, in der sie gelebt haben, völlig ausblendet.
Dann ist aber nicht mehr einzusehen, warum der Roman im späten 18. Jahrhundert angesiedelt ist.Es wäre noch herauszufinden, ob zwischen «Letzte Reise» und dem Cook-Roman von Lukas Hartmann (Mann von Bundesrätin Simonetta Sommaruga) «Bis ans Ende des Meeres» ein direkter Zusammenhang besteht, denn Hartmann begeht den gleichen Kardinalfehler der Geschichtsverfälschung, einzig und allein mit dem Unterschied, dass bei ihm James Cook im Vordergrund steht, nicht dessen Frau Elizabeth.