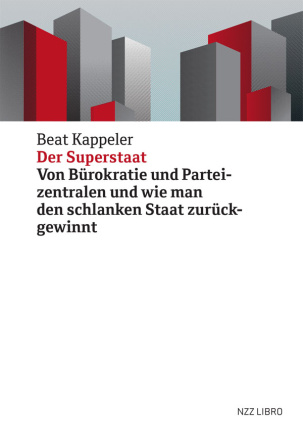
Beat Kappeler hat sein Pamphlet 2020 publiziert. Seither hat sich die Welt allerdings verändert. Kappelers Hauptkritik (in Teil 1, Kapitel 1 – 6) gilt hingegen unverändert: In der Schweiz, aber insbesondere auch in der EU und im von der EU dominierten Europa verlagert sich die politische Entscheidungsfindung und -kompetenz unaufhörlich von unten nach oben, von der Peripherie in die Zentrale; parallel dazu wächst bei Bürgerinnen und Bürgern das Gefühl des Ausgeliefertseins, der Machtlosigkeit und Terrorisierung durch unbeherrschbare Bürokratien. Das führt dazu, dass der Moloch ,Superstaat’ immer mehr Macht und Geld erhält und dass das mit harter Arbeit erzielte Einkommen der Steuerzahler zunehmend in intransparenten und von aussen gesehen nutzlosen Kanälen und Aktionen verdampft und verpulvert wird; das Subsidiaritätsprinzip wird schleichend zur Leerformel. Diese Entwicklung belegt Kappeler anhand unzähliger konkreter Beispiele aus dem nationalen und internationalen Kontext überzeugend.
Er schöpft dabei aus dem Vollen seiner jahrzehntelangen Beobachtung staatlichen Handelns, schwelgt dabei allerdings in grenzenloser Redundanz und ohne Rücksicht auf ein Ordnungsprinzip, das beispielsweise vom Grossen zum Kleinen oder vom Wichtigen zum Nebensächlichen führen könnte. Mehr Gewicht auf Relevanz würde die Kritik Kappelers massiv überzeugender und wohl auch wirksamer machen.
Im Teil 2 (Kapitel 7 – 9) präsentiert der Autor seine Therapievorschläge. Diese sind erheblich vager als seine Kritik. Sie riechen stark nach Wunschdenken. Der diagnostizierte Zustand wurde ermöglicht
- erstens im Wesentlichen durch Bürgerinnen und Bürger, die ihre Macht als Wähler aus Desinteresse, Bequemlichkeit oder (Denk-) Faulheit ruhen liessen,
- zweitens durch gewählte Gesetzgeber, die kaum je das Gemeinwohl im anstrebten, sondern den eigensüchtigen Nutzen und Vorteil ihrer eigenen Klientel, und
- drittens durch ebenfalls gewählte, aber mehr am Machterhalt (sprich Wiedergewähltwerden) als an sachlichen Lösungen interessiert sind; das hat der frühere EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sehr schön auf den Punkt gebracht mit seinem Diktum (frei zitiert): Wir wüssten schon, was wir tun müssten, aber nicht wie wir dann, wenn wir es täten, wieder gewählt würden.
Kappelers Therapie basiert im Kern auf einem Appell an die Wähler, ihre durch Inaktivität verschüttete Macht wieder auszugraben und tatsächlich auszuüben. Allerdings wird kein Hebel sichtbar, der für ein derartig radikal anderes Verhalten der politischen Akteure sorgen könnte. Kappeler postuliert richtigerweise wiederholt, dass die politisch-gesellschaftlich Gestaltung von unten nach oben erfolgen muss, und er kritisiert, dass aus den oben skizzierten Gründen dieser Grundsatz mehr und mehr auf den Kopf gestellt wurde; d.h. heute erfolge die Politik im Wesentlichen von oben nach unten, und das sei die tiefe Ursache der Genese aller Missstände. Wie die grundlegende Veränderung der Verhältnisse tatsächlich ausgelöst und konsequent durchgezogen werden könnte, lässt er leider im Dunkeln.
Wenn Kappeler das Buch heute schreiben würde, käme er kaum an den aktuellen Vorbildern vorbei, die in Ansätzen eine Umkehrmöglichkeit andeuten; da ist einmal Javier Mileis Kettensäge, und da ist das Gespann Trump-Musk. Aber da beisst sich die Katze in den Schwanz, denn beide Ansätze funktionieren nur top-down, nicht bottom-up.
Meines Erachtens fehlt in Kappelers Kritik ein wesentliches Element: auf allen Ebenen der Gestaltung des gesellschaftlichen Zusammenlebens (nicht nur in der Schweiz) fehlt der Prozess der Zielsetzung*, des institutionalisierten Soll-Ist-Abgleichs sowie der damit begründeten Korrektur der Ziele oder der für die Erreichung getroffenen Massnahmen. Politik ist ein Prozess der strukturellen Ziellosigkeit. Und das ist eine schiefe Ebene, deren Endergebnis ein nicht mehr lebenswerter Zustand ist. Denn es ist klar, ohne Zielsetzungen fehlt der Bezugspunkt, an dem die Qualität aller politisch-gesellschaftlichen Massnahmen emessen werden könnten – und müssten. Es gilt die uralte Weisheit: wer nicht weiss, wohin er will, kommt anderswo an!
Möglichweise ergibt sich daraus das einzige realistische Rezept: Abwarten, bis es uns so schlecht geht, dass wir gar nicht mehr anders können als… siehe die Wünsche von Kappeler.
Oder die Gesellschaft stellt sich ergebnisoffen und unbefangen der kritischen Frage, was überhaupt mit dem heutigen Menschenmaterial realistisch möglich sein kann; die Antwort auf diese Frage könnte sehr wohl darin bestehen, in der Gesellschaft mehr top-down Elemente zu etablieren und auf den Luxus des bottom-up zunehmend zu verzichten.
* Ich stelle mir unter einem solchen Prozess der Zielsetzung (nur grob skizziert) in etwa vor:
- Auf jeder politischen Ebene (am Beispiel der Schweiz also auf Ebene des Bundesstaates, der Kantone und der Gemeinden) wird im demokratischen Prozess, der in diesem Fall tatsächlich auf dem Prinzip des ,winner takes all’ basieren muss, wird ein Leitbild vereinbart, z.B.: Wer wollen wir für wen sein? Welche Werte und Grundregeln leiten uns? Welches Menschenbild leitet uns? Was ist in unserer Gesellschaft der Stellenwert von Eigenverantwortung und Mitverantwortung für das Wohl aller?
- Innerhalb dieses Leitbilds legen wir auf jeder politischen Ebene (am Beispiel der Schweiz: Staat, Kanton, Gemeinde) fest:
- welche Ziele verfolgen wir, selbstverständlich immer in Übereinstimmung mit den Zielen der übergeordneten Ebenen
- wie unterstützen wir die Zielerreichung der übergeordneten Ebene
- unsere Aufgaben; wofür sind wir zuständig, wofür nicht
- Mittel (Einnahmen), die uns zur Verfügung stehen
- Zielgruppen, für die wir sorgen wollen
- wie kontrollieren wir, ob wir die angestrebten Ziele erreichen, wenn nicht, warum nicht; welche Massnahmen ergreifen wir, um die Zielerreichung trotzdem zu gewährleisten
- an wen sind wir rechenschaftspflichtig
- wie steuern wir politische Vorstösse, Vorschläge, Petitionen/Initiativen?
- sagen sie klipp und klar, welches Problem sie lösen wollen
- warum muss dieses Problem jetzt gerade dringend gelöst werden, und warum
- welche anderen Lösungsoptionen wurden untersucht und weshalb verworfen?
- was kostet der Vorstoss? welchen Nutzen erbringt er?
- welche anderen Vorstösse werden wegen des neuen Vorstosses zeitlich oder materiell beeinträchtigt