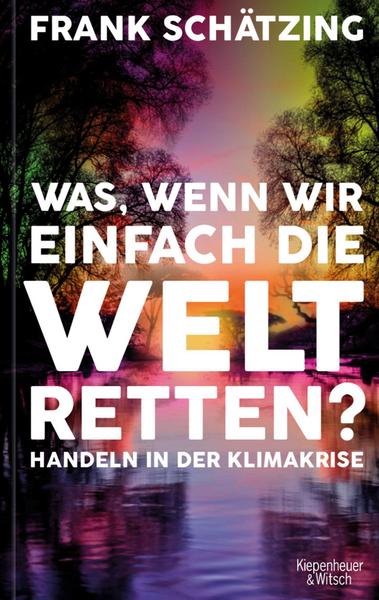
Es ist zwar lange her, seit ich meinen ersten und bisher einzigen Schätzing gelesen habe: «Der Schwarm». Im Unterschied zum Schwarm, der alles Drum und Dran der Schwarm-Intelligenz in einen packenden Roman verpackte, ist der neue Schätzing ein Sachbuch. Aber ein Sachbuch, das die zeitgeistige Maxime, man müsse den Menschen Geschichten erzählen, wenn man sie mitnehmen wolle, im Exzess verwirklicht. Nach meinem Eindruck kann man Schätzings Klima-Buch gut vergleichen mit «How to avoid a Climate Disaster – The Solutions We Have and the Breakthroughs We Need» von Bill Gates; beide schildern die Problematik der Klimaerwärmung, deren absehbaren Folgen eingehend mit Zahlen und Fakten; beide stellen die Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, oder die wir erst noch ,erfinden’ müssen, die Krise zu mildern oder gar zu meistern in den Brennpunkt ihrer Betrachtungen. Und beide, ich greife hier zwar etwas vor, beschwören und zerreden nicht die Katastrophe des Weltuntergangs, sondern sie stellen mit viel Optimismus und Mut das ins Zentrum, was wir tatsächlich tun können, um die Lebensgrundlagen unserer Spezies zu erhalten. Der Unterschied liegt im Stil;
- Bill Gates: furztrocken, sehr systematisch, top-down (im Sinn einer ABC-Analyse, aufs Wichtige konzentriert
- Frank Schätzing: schwärmerisch fantasievoll, anbiedernd, schwatzhaft, ins Geschichten-Erzählen (und wohl auch etwas in sich selbst) verliebt, gross und klein beliebig durcheinander wirbelnd (nicht einmal das Ogi-Prinzip zum Eierkochen fehlt; Seite 233 «kochen Sie nie ohne Deckel»)
Mir sagt der Gates-Stil viel mehr zu. Da es die Menschen, die man nur mit Geschichten, oder mit Geschichten besser erreicht, wohl auch gibt, hat der Schätzing-Stil natürlich seine Berechtigung – auch wenn er es mit seinem Buchtitel mit der ,Weltrettung’ sehr übertreibt; im Inhalt selbst widerspricht er dem nämlich in aller Deutlichkeit, indem er immer wieder betont, dass es der Erde ziemlich wurst ist, ob wir Menschen sie bewohnen können oder nicht, dass es also nicht um die Rettung der Welt gehen kann, sondern um die Erhaltung unserer Lebensbedingungen.
Die Schlüsselpassage aus Schätzings Buch befindet sich meines Erachtens auf Seiten 111-112; nach ätzender Kritik an der Energie-Industrie (Erdöl, Kohle) und den Autokonzernen wendet sich Schätzing der Rolle der einzelnen Menschen zu:
«SIE UND ICH
Was? Wir beide? In einem Atemzug mit Kohle-, Erdöl- und Autokonzernen? Ja, was machen wir denn Schlimmes?
Nichts Schlimmes. Dennoch sind wir Teil des Problems. Wenn niemand die Autos kaufen, den Strom verbrauchen, heizen, essen und trinken würde, hätten die Industrien nichts zu emittieren. All dies geschieht, um uns das Leben zu ermöglichen, das wir leben wollen. So richtig es ist, die weltgrössten Emittenten in die Kritik zu nehmen, vergisst man doch schnell, dass sie nur unseretwegen existieren. Der grösste Treibhausgasemittent sind wir.
Müssen wir uns darum schuldig fühlen? Ich erzähle Ihnen was aus dem Nähkästchen der Erdgeschichte. Kleine Abwechslung von den ganzen Zahlen. Vor zweieinhalb Milliarden Jahren war das Leben nicht so vielgestaltig wie heute. Vornehmlich Einzeller, erste Versuche der Evolution, Zellen zu verketten. Aber es wimmelte schon von Lebensformen. Ungezählte Arten Mikroorganismen bevölkerten die Meere. Das Land lag öde da, zu unwirtlich, als dass dort etwas hätte grünen können, krabbeln und flattern wollen. Lurchis legendärer Landgang, dem Sie und ich unser Dasein verdanken, wird noch auf sich warten lassen. An einem Donnerstag nun (ein Donnerstag, der viele Millionen Jahre dauerte) erfanden die Vorläufer der Cyanobakterien aus lauter Langeweile etwas Phänomenales. Sie nutzten Sonnenenergie, um Wasser in seine Bestandteile aufzuspalten, konnten so lebenswichtige organische Moleküle herstellen und setzten als Abfallstoff gewaltige Mengen an Sauerstoff frei.
Das war unser Glück. Ohne Sauerstoff keine biologische Höherentwicklung. Allerdings vertrugen etliche Spezies den plötzlich freigesetzten Sauerstoff nicht. Pures Gift für sie, und es hörte nicht auf. Infolge der ungebremsten Kontaminierung verabschiedeten sich fast alle anaeroben (nicht auf Sauerstoff angewiesene) Lebensformen gleich wieder aus der Weltgeschichte. Anders als wir pflegten Cyanobakterien keine Klimagipfel abzuhalten und trugen sich nicht mit Schuldgefühlen, weshalb sie den Planeten weiter munter nach ihren Bedürfnissen umgestalteten. Wir sind somit nicht die erste Spezies, die einen vernichtend grossen ökologischen Fussabdruck hinterlässt. Aber wir sind die erste Spezies, die darüber nachdenken kann: was wir unserer Umwelt antun. Was wir uns selber antun.
Das Dilemma: der Nutzen, den wr aus unserem Vorgehen ziehen, ist zugleich unser Fluch. Den Planeten umzugestalten, kann unser Ende in sich tragen; ihn nicht umzugestalten, allerdings auch. Jede Lebensform verändert die Ökosphäre durch ihr blosses Dasein, umso stärker, je zahlreicher sie auftritt. Das ist in Ordnung. Wir haben ebenso ein Existenzrecht wie Amöben, Sardellen, Wiedehopfe, Flusspferde und der gar nicht so böse Wolf. Wir fressen einander, stoffwechseln, scheiden aus, emittieren. Die Abschaffung der Menschheit, von der Ökoromantiker meinen, sie brächte die Natur wieder ins Gleichgewicht, würde nichts ändern. Die Natur war nie im Gleichgewicht. Wie sollte dieses Gleichgewicht ausgesehen haben? In welchem Erdzeitalter lag es? Die Geschichte unseres Planeten ist die Geschichte des Einander-Verdrängens. Es geht nicht darum, zu verschwinden, um niemanden zu stören. Wir werden die Welt auch weiterhin verändern, Arten weden unseretwegen aussterben, irgendwann werden wir selber aussterben, vielleicht weil Bakterien im Meer etwas freisetzen, das wir nicht vertragen. That’s life. Wir müssen verstehen, dass wir die Welt nicht zerstören können.
Wir können nur unsere Welt zerstören.
Und daran sind wir zurzeit alle irgendwie beteiligt.»
Das leuchtet ja ein und ist alles schön und richtig: Wir sind das Huhn, die Industrie ist das Ei; und das Huhn war zuerst. Wie die Cyanobakterien auf das Huhn gekommen sind, das kann uns jetzt egal sein. Mit seinem Ausflug in die Erdgeschichte stellt Schätzing einiges sehr klar:
- Option 1: Wir wollen weiterhin so leben wie bisher; die Industrien liefern, was wir wollen; und unsere Umwelt geht kaputt.
- Option 2: Wir reduzieren unsere aggregierten Ansprüche, einigermassen synchron, weltweit, freiwillig. Weil das nicht geht, tritt Option 1 in Kraft.
- Option 3: Wir reduzieren unsere Ansprüche, differenziert nach aktuellem Wohlstand; d.h. die ,reichen’ Gesellschaften reduzieren massiv, die ,armen’ Gesellschaften erhöhen mässig, so dass das Aggregat der Ansprüche sinkt, auf 1.5º bis 2100?. Aber: Wie soll das funktionieren? Freiwillig oder durch Zwang? Wer befiehlt? Wer setzt das alles wie durch? Zurück zu Option 1.
- Option 4: Schätzing weist selbst darauf hin, dass in der bisherigen Erdgeschichte ganze Ökosysteme untergegangen sind, «irgendwann werden wir selber aussterben … That’s life».
Aber der Reihe nach:
In seiner Einleitung «Eigentlich…» bekennt Schätzing, dass er ursprünglich einen Thriller zur Klimakrise schreiben wollte. Dann kam er auf die Idee, dass die Klimakrise selbst ja ein Thriller ist, und wir sind mittendrin. So kam er von der Thriller-Idee ab und schrieb ein Sachbuch, in dem der Thriller ,Klimakrise’ und wir selbst die Hauptdarsteller sind.
Im Teil 2 «Frankenstein und die Klimakatastrophe» behandelt Schätzing gewisse Grundbegriffe, wie etwa ,Klima’, den natürlichen und menschengemachten Klimawandel sowie die Rolle und den Stellenwert der Klimaforschung.
Teil 3, mit dem fantasielosen Titel «Thriller» schildert, wie sich das Klima im Verlauf des 21. Jahrhunderts gemäss verschiedenen Szenarien entwickeln wird. Im Teil 4 «Ursache, Wirkung» beschreibt Schätzung die Rolle der Treiber des Klimawandels, z.B. globale Eismassen, Ozeane, Atmosphäre und Winde, Wälder, etc. sowie die Auswirkungen des Klimawandels.
Teil 5 widmet sich den ,Tätern’ und ist mit «Die Guten –und die Bösen» überschrieben. Dabei unterscheidet er zwischen den ,Verursachern’, den ,Aktivisten», der ,Politik’ und den ,Gegenspielern’. Leider tritt hier die These, die er in der zitierten Schlüsselpassage vertritt, dass nämlich letztlich wir alle, d.h. das Aggregat unserer Wünsche und Bedürfnisse, die Treiber des Klimawandels sind, in den Hintergrund. Die Bösewichte sind wieder die üblichen Industrien, Bolsonaro & Co.
In Teilen 6 «Handeln» und 7 «Wie wir wachsen – oder auch nicht» behandelt Schätzing alle erdenklichen Möglichkeiten, wie wir anders leben könnten, um unsere Lebensbedingungen auf dem Planeten Erde zu erhalten, beziehungsweise nicht zu zerstören. Leider kommt dabei nicht viel mehr heraus als ein Katalog von frommen Wünschen. Denn Schätzing gibt auf zentrale Fragen wie:
- Wie soll das gleiche Personal, das in den letzten 200 Jahren den Klimawandel frisch-fröhlich angetrieben hat, jetzt plötzlich Vernunft annehmen und mit Rücksicht auf einen erträglichen ökologischen Fussabdruck freiwillig auf Konsum, Komfort und Klasse verzichten?
- Wie soll das funktionieren, wenn – Schätzing selbst weist mehrfach darauf hin – grosse Teile der Menschheit noch immer in bitterer Armut leben, aber alles daran setzen, den gewohnten westlichen Lebensstandard zu erreichen?
- Welche Autorität soll das mit welchen Mitteln durchsetzen, wenn’s nicht freiwillig geht?
- Auf Seiten 285-286 schreibt Schätzing zum Stichwort ,Wachstum’; «Mehr Suffizienz wäre wunderbar! Hingegen nur Suffizienz – dem liegt die Vorstellung einer Welt im Gleichgewicht zugrunde, letztlich indigener Kitsch. Die Mär vom selbstgenügsamen Naturvolk. Sorry. Gab’s nie. In aller Regel haben sich Naturvölker mit schöner Regelmässigkeit ihrer Lebensgrundlagen beraubt. Von Ökologie verstanden sie nichts. … Doch selbst, wenn die Suffizienz-Absolutisten recht hätten, reicht die Zeit nicht aus, um eine auf Wachstum und Höherentwicklung konditionierte Menschheit mental umzuprogrammieren. (Anmerkung BB: das Wort ,umzuprogrammieren’ verrät einen völlig unrealistischen Machbarkeitswahn; die Menschheit liesse sich, auch wenn unendlich viel Zeit verfügbar wäre, nie mental umprogrammieren.) Wir müssen jetzt das Klima retten. Wir – und nicht eine ferne, runderneuerte Version unserer selbst.»
Wunderbar! Dann sag’ uns doch bitte, WIE?
- Das bringt mich zurück auf die bereits zitierte Schlüsselpassage Schätzings: «… Arten werden unseretwegen aussterben, irgendwann werden wir selber aussterben, vielleicht weil Bakterien im Meer etwas freisetzen, das wir nicht vertragen. That’s life.» Wenn das so klar ist, warum soll ausgerechnet die Spezies Mensch vom Untergang verschont werden? Darauf geht Schätzing gar nicht ein, bleibt also auch eine Antwort schuldig.
Teil 8 trägt den bescheidenen Titel «Science Fiction». Das trifft den Kapitelinhalt gut, insbesondere das Stichwort .fiction’. Schätzing umreisst fantasievoll, wie unsere Welt im Jahr 2050 aussehen könnte (und impliziert dabei, dass die Menschheit mental doch umprogrammiert werden konnte – im Widerspruch zu den Ausführungen zu Teil 6 und 7), nachdem es der Menschheit gelungen ist, den Klimawandel zu stoppen, qualitativ zu wachsen, und die ganze Menschheit zu Wohlstand zu bringen.Das ist zwar lustig und anregend, aber bezüglich Machbarkeit in knapp 30 Jahren totaler Bullshit.
Das ist enttäuschend. Denn die Auslegeordnung, die Schätzing zur Klimakrise vorlegt, zu ihren Ursachen und Verursachen, zu ihrem Ausmass und ihren Wirkungen, zu den bereits vorhandenen und zukünftig denkbaren technischen Lösungsansätzen sowie wünschbaren Veränderungen der Lebensweise, zu den Möglichkeiten, Wohlstand und Wachstum klimaverträglich zu erhalten und dazu noch die Entwicklungsländer mitzunehmen, ist gut und umfassend, verständlich geschrieben und auch für Laien verständlich. Umso grösser ist der Kontrast zu Schätzings Lösungsansätzen, die sich zu sehr auf fromme Wünsche und Hoffnungen beschränken und per Saldo sehr hilflos wirken.