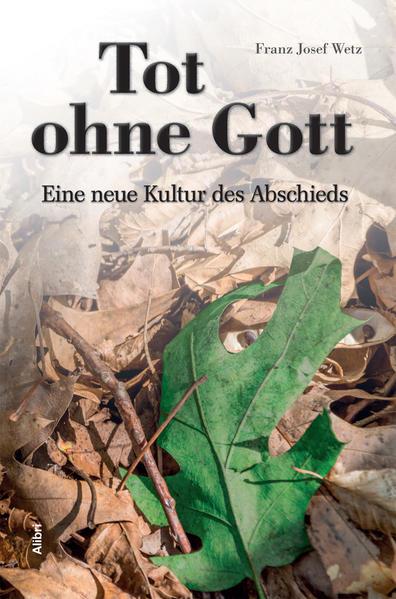
Franz Josef Wetz, *1958, ist Professor für Philosophie und Ethik in Schwäbisch Gmünd und Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Giordano-Bruno-Stiftung. Er hat verschiedene Bücher publiziert und ist Herausgeber von «Endlichkeitsphilosophisches – Über das Altern» von Odo Marquard (2021-16). Von 1981 –1983 arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Assistent von Odo Marquard an der Universität Giessen.
In seinem vorliegenden neusten Werk beschäftigt er sich mit dem Tod und mit dem Umgang unserer Zivilisation mit dem Tod.
Seine Kernthesen lassen sich – vereinfacht – auf folgenden Nenner bringen:
- Der Mensch ist wie alle Pflanzen und alle anderen Tiere ein biologisch-organisches Wesen, das dem Zyklus «Werden, Sein, Vergehen» unterworfen ist.
- Der Mensch besteht nur aus seinem Körper.
- Auch seine intellektuellen und kreativen Fähigkeiten ,hausen’ in diesem biologischen Gebilde. Es gibt keine Seele, die unabhängig oder ausserhalb vom Körper der Menschen existieren könnte. Jedenfalls ist bis heute nichts Greifbares, Sichtbares, Messbares oder Beobachtbares gefunden worden, das auf die Existenz einer Seele hinweisen könnte. Sinngemäss das Gleiche gilt auch für das menschliche Bewusstsein.
- Somit gibt es weder ein Leben nach dem Tod, noch eine Wiedergeburt oder Wiederauferstehung und Wiedervereinigung des gestorbenen Körpers mit ,seiner’ Seele.
Wetz behauptet nicht, dass diese Thesen bewiesen seien; er betont jedoch, dass bis heute nichts Greifbares, Sichtbares, Messbares oder Beobachtbares gefunden worden ist, das auf die Existenz einer Seele hinweisen könnte, und, darüber hinaus, dass es, auch im Vergleich zur Tier- und Pflanzenwelt, höchst unplausibel wäre, wenn es sich anders verhalten würde.
Er gliedert seine Ausführungen in die fünf Kapitel:
Endlichkeit Er sich befasst sich hier ausführlich mit der menschlichen Manie, die Tatsache der Sterblichkeit zu verdrängen
Gibt es ein Leben nach dem Tod? Hier setzt sich Wetz kritisch damit auseinander, in Erfahrungen wie Nahtod, Konzepten der Wiedergeburt und Auferstehung Beweise für ein Leben nach der Tod zu sehen.
Wer stirbt schon gerne? Hier stehen die auf die Anfänge unserer Zivilisation zurückgehenden Bemühungen, den Tod zu überwinden, auf dem Prüfstein.
Metaphysik der Metastasen Themen dieses Kapitels sind der Umgang mit finalen Erkrankungen.
Wie ist Trost möglich? Im abschliessenden Kapitel geht es Wetz um Bestattungsmoden (Wortwahl Wetz), Trauerarbeit und ein «zeitgemässer Geleitschutz auf dem Weg ins Nirgendwo».
In weiten Strecken ist das Buch keine selbstständige und selbsttragende theoretische Auseinandersetzung mit den aufgeworfenen existentiellen Fragen, sondern eine mengenmässig erdrückende Fülle von Zitaten, die Wetz mit Verbindungstexten aneinanderreiht. Die Bandbreite der Aussagekraft dieser Zitate reicht vom Banalsten bis zum Erhabensten. Die Zitate umfassen den gesamten schriftlich erfassbaren Zeitraum unserer (westlichen) Zivilisation. Damit illustriert Wetz, dass die Fragen um Tod, Existenz einer Seele, Unsterblichkeit, Leben nach dem Tod unsere Kultur seit deren Anbeginn beschäftigt.
Man ist fast versucht zu sagen, dass diese Tatsache doch ein Hinweis dafür sein könnte, dass der Mensch mehr ist als sein Körper. Ich ziehe eher einen gegenteiligen Schluss: Die Tatsache, dass die Menschen sich so intensiv und dauerhaft mit diesen Fragen befasst, ist ein Hinweis darauf, dass der Glaube, der Mensch sei die Krone der Schöpfung, trotz aller gegenteiligen wissenschaftlichen Erkenntnisse unausrottbar ist. Und darauf basiert dann der Irrschluss: Weil der Mensch die Krone der Schöpfung ist, muss er unsterblich sein, muss er – im Unterschied zu allen anderen Tieren — aus mehr bestehen als aus seinem Körper, muss er also eine Seele haben, die unsterblich ist. Weil der Mensch die Krone der Schöpfung ist, kann es nicht sein, dass der Mensch mit seinem Tod buchstäblich am und zu Ende ist. Nur für den, der glaubt, der Mensch sei die Krone der Schöpfung, ist der Tod oder die Sterblichkeit eine Kränkung, ist der Mensch zum «Tod verurteilt» (Originalton Wetz). Nur wer glaubt, der Mensch sei etwas Besonderes, sei mehr als ein Tier, kommt auf die Idee, die Sterblichkeit überwinden zu wollen, dem Tod oder der tödlichen Erkrankung einen Sinn zu geben.
Bis zur Mitte des Buches setzt sich Wetz mit der Frage, weshalb wohl die Menschen so grosse Mühe mit ihrer eigenen Sterblichkeit und Endlichkeit haben könnten, nicht auseinander. Er nimmt, was sein gutes Recht ist, die Tatsache, dass es so ist, einfach als gegeben hin. Das Buch wäre auch wesentlich kürzer, wenn er einfach sagen würde: Der Mensch kommt, ungefragt, auf die Welt, lebt eine Weile, stirbt früher oder später, und dann ist Schluss: That’s the way the cookie crumbles.
Die Fülle und Breite von Zitaten, die Wetz gesammelt hat, ist allerdings erstaunlich. Es scheint, dass fast jeder Denker oder Schriftsteller (um nicht zu sagen: Denkende oder Schriftstellernde), der oder die je gelebt hat, sich irgendwann zu den vermeintlich existentiellen Fragen von Leben und Tod äussert. Man denkt dabei unwillkürlich an Karl Valentins Weisheit: « Es ist schon alles gesagt – nur nicht von allen.»
Einige Auszüge aus dem Buch mögen illustrieren, wo die Schwerpunkte liegen:
(Seite 66): Die Idee der Unsterblichkeit ist aus Angst und Sehnsucht geboren. Zugleich verbirgt sich dahinter eine ungeheure Anmassung. Warum sollte gerade die Seele des Menschen (Anmerkung BB: die es ja wohl gar nicht gibt) unsterblich sein, wo doch alles Sonstige auf der Erde dem Gesetz von Werden und Vergehen untersteht? David Hume schreibt: «Nichts ist ewig in dieser Welt. Alles, wie beständig es auch scheinen mag, ist in beständigem Fluss und Wechsel. Die Welt selbst zeigt Symptome von Schwäche und Auflösung. Wie entgegen aller Analogie ist es daher, sich einzubilden, dass eine einzige Art, die anscheinend schwächste von allen und den grössten Störungen unterworfen, unsterblich und unauflöslich sei? Was für eine verwegene Theorie ist das! Wie unbesonnen, um nicht zu sagen, wie überstürzt aufgestellt!» Pflanzen und Tieren gleich ist der Mensch zum Tode verurteilt. (Anmerkung BB: mich stört die Metapher ,verurteilt’; verurteilt wird man doch normalerweise, weil man etwas verbrochen hat; wenn man mit dem Tod bestraft wird, weil man – ungefragt – gezeugt wurde und geboren ist, wäre das ja nicht besonders gerecht; die Metapher impliziert, dass die Sterblichkeit eine Strafe ist, und damit wiederum eine Kränkung, die völlig deplatziert ist, wenn man sich an den Zyklus ,Werden, Sein, Vergehen’ hält).)
(Seite 66) Wie sollen wir bei unserer Geburt ewig geworden sein, wenn doch alles Übrige unbeständig und vergänglich ist? Nur was nicht lebt, stirbt nicht. Dass es einen Sonderbestandteil ideeller Art im Menschen gibt, die Seele, der im Gegensatz zum Organismus von diesem Gesetz ausgenommen bleibt, ist weder offensichtlich noch wahrscheinlich. Unser Leben ist von beiden Seiten, vom Anfang und vom Ende her klar begrenzt.
Dementsprechend stellt im 18. Jahrhundert Holbach fest: «Wenn alles entsteht und vergeht, wenn sich alles verändert und auflöst, wenn die Entstehung eines Dinges stets nur der erste Schritt zu seinem Ende ist, wie sollte der Mensch von dem allgemeinen Gesetz ausgenommen sein, nach dem sich die Erde, die wir bewohnen, wandelt und zugrunde gehen wird.»
(Seite 147) Wetz lässt sich hier auf den Gedanken ein, dass ein Leben, wenn es vom Ende, also vom Tod her, gedacht und gesteuert wird, vom Tod her sogar gewinnen kann. «Der Tod ist das wirkliche Ende des Lebens, der Gedanke daran ein möglicher Neubeginn. Die Begegnung mit Freund Hein ermöglicht eine Wertschöpfung, der sich ein Mehrwert in Form einer bewussteren Lebensweise entlocken lässt. Gevatter Tod entfaltet seine Kraft nicht im Sterbeprozess, sondern im Lebensvollzug. Im Alltag laufen wir Gefahr, einer Vielzahl belangloser Dinge nachzujagen und uns an Nebensächlichkeiten zu verlieren. Das Bewusstsein des Todes vermag uns aus der geschäftigen Zerstreuung herauszureissen. Es ruft zur Besinnung, indem es die Begrenztheit der Lebenszeit in Erinnerung ruft. Dadurch schafft es Raum für das Eine, das nottut. Aber was ist das?»
(Anmerkung BB: Das ist eine Passage, die typisch ist für meine These, das Grundübel am Umgang mit der Vergänglichkeit des menschlichen Lebens sei die Erwartung, der Mensch verdiene etwas Besseres und sollte dies auch beanspruchen. Für mich ergibt die Forderung keinen Sinn, es brauche den Gedanken an die eigene Sterblichkeit, um bewusster und im Verzicht auf Nebensächlichkeiten zu leben. Es braucht meines Erachtens auch keinen Unfall mit lebensgefährlichen Verletzungen, um dem Leben einen Sinn zu geben. Wer a priori bewusst und sinnorientiert lebt, kann das sehr wohl ohne die Kränkung der eigenen Sterblichkeit.)
Die Passage, die meines Erachtens am besten zeigt, wohin die Betrachtungen von Wetz in letzter Konsequenz hinführen, befindet sich auf Seite 149:
Im 14. Jahrhundert befürwortet Francesco Petrarca solche drastischen Begegnungen mit dem Tod, weil sich Bilder stärker als Worte einprägen. In Mein Geheimnis rät er den Menschen, Sterbeprozessen ganz dicht beizuwohnen: «Wie die Arme und Beine schon kalt werden, während die Brust brennend heiss und unangenehmer Schweissgeruch sich verbreitet, wie die Glieder zittern und der Atem des Lebens beim Nahen des Todes immer schwächer wird. Dazu auch die tief in ihren Höhlen liegenden Augen, der von Tränen getrübte Blick, das verzerrte blau angelaufene Gesicht, die eingefallenen Wangen, die gelben Zähne, die steife und spitze Nase, die mit Schaum bedeckten Lippen, die wie ein Schwamm aufgedunsene Zunge, der ausgetrocknete Gaumen, das herabgesunkene Haupt, die schwer atmende Brust, das heisere Röcheln und die tiefen Seufzer, der unangenehme Geruch des ganzen Körpers und vor allem das schrecklich entstellte Antlitz.» Solche krassen Bilder verfolgen nur ein Ziel: Sie wollen die Menschen zu religiöser Umkehr bewegen. Der Triumph des Todes soll nicht das letzte Wort behalten.
(Anmerkung BB: Schöner könnte man nicht argumentieren, dass die tiefste Ursache für den irrationalen Umgang der Menschen mit der Endlichkeit im Anspruch der religiösen Eliten auf die Deutungshoheit liegt, egal ob diese nun christlich, islamisch, jüdisch, buddhistisch, schamanisch oder weiss der Teufel welcher Denomination sind. Dabei wäre es viel einfacher, anstelle der pathetischen Endlichkeitstrauer und Unendlichkeitsfantasien die Realität, dass für uns alle das Ende des Lebens das Ende der Dinge ist, anzuerkennen, anzunehmen und sich mit der Weisheit «That’s the way the cookie crumbles.» zu versöhnen.)
Besonders drastisch drückt Kierkegaard den drastischen und für jeden bewusst lebenden Menschen erniedrigenden Gedanken aus, dass es den Tod braucht, um richtig zu leben:
(Seite 151) «Der Tod gibt Lebenskraft wie nichts anderes… er macht wach wie nichts anderes. Der Gedanke an den Tod gibt die rechte Fahrt ins Leben und das rechte Ziel, die Fahrt dahin zu richten. Und keine Bogensehne lässt so straff sich spannen, keine vermag dem Pfeile solche Fahrt zu geben wie den Lebenden der Gedanke des Todes anzutreiben vermag. Da packt der Einzelne das Gegenwärtige noch heute, verschmäht keine Aufgabe als zu gering, verachtet keine Zeit als zu kurz.»
Da werden sogar Zeugen beschworen, die sonst nicht als Experten zu diesem Thema dienen dürfen.
(Seite 152) Mit den Worten des britischen Malers Francis Bacon wächst auf einmal die Erkenntnis, «dass neun Zehntel von allem unwichtig sind.» Der Tod nimmt den alltäglichen Dingen ihre Bedeutsamkeit und entlarvt die Mehrzahl der Hauptsachen als Nebensachen. Man fragt sich jetzt: Was möchtest du noch gerne unternehmen oder erleben? Was du tun möchtest, solltest du bald tun und nicht unaufhörlich aufschieben. Was liegt dir besonders am Herzen? «Pflücke den Tag und vertraue wenig auf den folgenden», schreibt der römische Schriftsteller Horaz. Marc Aurel wählt fast dieselben Worte: «Das Leben ist kurz. Nutze die Gegenwart mit weiser Überlegung!» Das Gleiche meint Carlos in Goethes Clavigo, wenn er herausstreicht: «… man lebt nur einmal in der Welt, hat nur einmal diese Kräfte, diese Aussichten, und wer sie nicht zum Besten braucht, wer sich nicht so weit treibt als möglich, ist ein Tor.» Die heutige Jugendkultur sagt hierzu ,Yolo’: «You only live once».
(Anmerkung BB: Franz Josef Wetz unterlaufen hier mindestens zwei kardinale Fehler: erstens übersieht er, dass Carlos in Clavigo ein Plädoyer zugunsten des heute verpönten und geächteten grenzenlosen Wachstums hält; und zweitens verwendet er das Yolo der heutigen Jugendkultur in krass sinnpervertiertem Sinn: Für die Jugend ist es das Motto für grenzenlosen Hedonismus; Wetz macht daraus einen Appell für ein unter dem Gesichtspunkt der menschlichen Endlichkeit sinnerfülltes Leben. Goht’s no?
Überhaupt: Wer sagt, dass der Sinn für das Wesentliche erst dank der Konfrontation mit der Endlichkeit des Lebens erweckt wird, verkennt zwei fundamentale Parameter:
Erstens ist das Wesentliche keine statische Grösse; was gestern für mich wesentlich war und heute nebensächlich ist, wird durch viel mehr Einflüsse als durch die Begegnung mit der Endlichkeit bestimmt. Ein normaler Mensch braucht nicht den Tod, um zu realisieren, dass für ihn als zwanzigjährigen Junggesellen andere Dinge wesentlich sind als für den gleichen Menschen, der fünf Jahre später eine Familie gründen will. Zweitens ist die Tatsache, dass viele Menschen (fast) ihr ganzes Leben gedankenlos und ziellos verplempern, bis eine Lebenskatastrophe sie animiert, endlich Bewusstsein für ihr eigenes Leben zu entwickeln, kein Beweis dafür, dass Katastrophen notwendig sind, um zu Sinnen zu kommen, sondern schlicht und ergreifend eine empirische Feststellung.)
Wetz relativiert den Mythos, es brauche den Tod, um den Sinn des Lebens zu finden und zu leben, selbst, und zwar mit seinen Ausführungen auf Seiten 155-156: «Den Tod vor Augen ist bei zahlreichen Zeitgenossen die Angst vorm Verpassen ziemlich gross. Aber oft wissen sie nichts Sinnvolles mit ihrer Zeit anzufangen. Doch erst beim Nachdenken wird ihnen bewusst, etwas Entscheidendes versäumt zu haben. Nur können sie häufig nicht sagen, was es ist. Das ist keineswegs so erstaunlich, wie es zu sein scheint. Denn im Grunde ist überhaupt nicht klar, worauf es im Leben ankommt. Woran lässt sich ein gelungenes Leben erkennen? Die meisten können froh sein, mit geschlossenen Augen durchs Leben gehen zu dürfen. Denn hinter ihren alltäglichen Beschäftigungen und vielfältigen Ablenkungen liesse sich vermutlich ausser leerer Langeweile nichts ausfindig machen, das der Verwirklichung harrt.» Dazu passt ziemlich sicher für die grosse Mehrzahl der Menschen durchaus auch Bertolt Brechts «Zuerst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.»
(Anmerkung BB: Das ganze Gedöhns um die Idee, es brauche den Tod, um zu merken, etwas verpasst zu haben und dadurch erst zum richtigen Leben zu gelangen, ist erstens etwas ausgesprochen Elitäres, und zweitens die sehr spezifische Anwendung eines sublimen Waswärewennismus. Die Gedankenfolge: Der Tod bringt mich dazu, mein bisheriges Leben zu reflektieren und lässt mich spüren, dass ich einiges oder vieles verpasst habe; mit dem Tod vor Augen vermag ich mein Leben neu auszurichten und mich dem wirklich Wesentlichen zu widmen, also ins richtige Leben zu kommen. Unausgesprochen steckt in dieser Logik die Frage: Was wäre, wenn ich damals nicht so flatterhaft gelebt und mein Leben vergeudet hätte?, und gleichzeitig die Antwort: Dann wäre alles besser. Aber: Kein Mensch kann wissen, wie sich sein Leben entwickelt hätte, wenn er als 25-Jähriger den ,richtigen’ Beruf gewählt, als 30-Jähriger sich von der ,falschen’ Frau hätte scheiden lassen, oder als 40-Jähriger den Managerberuf an den Nagel gehängt hätte und in ein buddhistisches Kloster eingetreten wäre. Rückwärtsgerichtete Was-wäre-wenn-Fragen sind müssig, sinnlos und illusionär, und erst recht sind Antworten darauf reine Spekulation. Wer mit seinem aktuellen Lebenszustand nicht zufrieden ist (auch ohne den Tod oder die eigene Endlichkeit vor Augen), muss nicht fragen, was habe ich wann falsch gemacht oder versäumt, sondern was kann ich heute tun, um meine heutigen Vorstellungen von Sinn und Erfüllung auszuleben und auszuprobieren – ohne Erfolgsgarantie.
Wetz gelingt es also, Geistesgrössen aller Epochen (allerdings fast ausschliesslich aus sogenannt abendländischen Kulturen) zu zitieren, welche insgesamt die ganze Bandbreite von denkbaren Einstellungen zu Leben und Tod rechtfertigen:
- Es gibt diejenigen, welche mit der Endlichkeit des menschlichen Lebens unzufrieden sind und den Tod am liebsten verleugnen, jedenfalls so lange wie möglich von sich fernhalten wollen.
- Und diejenigen, welche das Leben grässlich finden und am liebsten nie geboren wären – allerdings ohne sich bewusst zu sein, dass dies ein surrealer Wunsch ist, denn, um ihn haben und äussern zu können, muss man ja gerade erst geboren sein.
- Und dann gibt es diejenigen, welche den Tod als Menetekel vor sich hertragen, um ihr Leben ,sub specie’ des Todes jederzeit wieder auf neue Sinnhaftigkeit auszurichten.
- Und dann gibt es diejenigen, wohl die überragende Mehrheit der Menschen, die weder Zeit noch Lust haben, sich mit solchen Gedanken zu beschäftige, weil sie mit der Bewältigung des Alltags, mit der Sicherung der Existenzgrundlagen für sich selbst und ihre Angehörigen, und mit gelegentlichen kleinen Fluchten vor den Härten der Wirklichkeit vollständig ausgelastet sind. Ob das ein Indiz dafür ist, dass alle anderen Einstellungen der Lösung eines Luxusproblems nachjagen? Jedenfalls erscheint mitr folgender Standpunkt als sehr plausibel: Ich bin – ungefragt – auf die Welt gekommen; versuche mit den Umständen, in die ich hineingeworfen bin, so gut wie möglich zurechtzukommen; verfolge Ziele, die mir erstrebenswert vorkommen; gehe mit meinen Mitmenschen rücksichtsvoll um; anerkenne, dass das Leben keine Gerechtigkeitsveranstaltung ist, sondern eine Lotterie, bei der ich abwechslungsweise Nieten, kleine Gewinne und vielleicht einmal das grosse Los ziehe (wobei das grosse Los nicht zwingend der sprichwörtliche Lottosechser sein muss, sondern ,nur’ der Gewinn, der für mich in der aktuellen Lebenssituation die grösste Bedeutung hat); anerkenne und versöhne mich damit, dass jedes (organische) Leben endlich ist; und hoffe, dass mein Leben zu einem Zeitpunkt, den ich weder bestimmen noch im Voraus wissen kann, ohne grosses Leiden endet – das ist alles! Sum, ergo sum.
Im Kapitel Metaphysik der Metastasen behandelt Wetz den Umgang mit schweren, unheilbaren oder tödlichen Krankheiten. Letztlich sind dies jedoch nur ,in extremis’-Variationen der bisherigen Ausführungen. Er geht dabei auch auf die berühmte und berüchtigte ,Warum’-Frage ein: Warum ausgerechnet ich? Warum jetzt? Er betont aber, dass diese Frage sinnlos und müssig ist, weil sie a priori nicht beantwortet werden kann; «Mit dem Schicksal oder dem Zufall kann man keine Vereinbarung treffen.» (Seite 193) Nur beiläufig erwähnt er, mit einem Zitat von Christopher Hitchens, dass sich die Warum-Frage mit der Gegenfrage «Warum denn nicht?» ad absurdum führen lässt. Es trifft doch zu, dass in den allermeisten Lebensgeschichten grosse Katastrophen selten sind, dass also auch ein Anlass zur Warum-Frage eher selten ist. Anlass zur «Warum nicht?»-Frage bestünde jedoch tagtäglich, sekündlich. Da ist es, das Leben als Lotterie! Wetz auf Seite 194: «Jeder Sinn (Anmerkung BB: gemeint ist eine Sinnerklärung von Lebenskatastrophen) wäre schrecklich. Die Natur, deren vergängliche Teile wir sind, kennt weder Begünstigung noch Bosheit. Sie schlägt willkürlich zu, ohne darauf zu achten, wen sie trifft. Wo es den einen erwischt, hätte es genauso gut jeden anderen treffen können; hinterhältige Absicht war nicht im Spiel. Mal hat man Glück, mal hat man Pech. Das ist alles.»
Aber Wetz kann nicht aufhören. Im Kapitel 5 «Wo ist Trost möglich?», in dem Bestattungsmoden (Wortwahl Wetz), Trauerarbeit und ein «zeitgemässer Geleitschutz auf dem Weg ins Nirgendwo» im Brennpunkt stehen, wird die endlose Aneinanderreihung von Zitaten, Merksprüchen oder Weisheiten aus fast drei Jahrtausenden fortgesetzt. Der rote Faden bleibt aber konsequent die Kränkung, die dem Menschen mit seiner Sterblichkeit (angeblich) angetan wird. Nur wer sich vom erwarteten und unvermeidlichen Tod gekränkt fühlt, benötigt Trost, oder Instruktionen für eine gute Sterbekunst. Der Ruf nach gekonnter Trauerarbeit ist letztlich nichts anderes als Arbeitsbeschaffung für Psychologen, Schamanen, Deutungshohepriester, Religionen und Sekten.
Aus meiner Sicht sind auch die Versuche des Autors, «existenzielle Erleichterungen bei der Bewältigung des Todes in unserer säkularen Kultur» anzubieten, in dem Sinne fehlgeleitet, als sie die Haltung zum Tod als etwas, das der Mensch nicht verdient, unterstützen. Das Problem sehe ich nicht am Tod an sich, sondern an der unbegründeten Erwartung, der Mensch verdiene etwas Besseres. Wer den Tod als natürliches Ende (s)eines Lebenszyklus ansieht und ihn tatsächlich auch innerlich so annimmt, braucht keinen Trost; muss nicht sein ganzes Leben an den Tod denken und sein Leben darauf ausrichten; muss nicht den Sinn von allem, was sie oder er tut oder unterlässt, ständig unter einer Sterblichkeitsperspektive hinterfragen. Dies gilt erst recht, wenn man bedenkt, dass der Tod – vom Suizid einmal abgesehen – nicht planbar ist. Wir alle erleben es fast tagtäglich, dass Mitmenschen, eben noch gesund, lebenslustig und aktiv in Familie, Beruf und Gesellschaft integriert und engagiert, von einer Sekunde auf die andere tot sind: Unfall, Schlaganfall, Herzversagen, Verbrechen.
Wenn schon Trost oder Trauerarbeit, gehören vielmehr die Hinterbliebenen in den Blick. Nicht nur, weil sie einen lieben, geliebten, vorbildlichen oder einfach umgänglichen und hilfsbereiten Menschen verlieren, sondern weil sich für einige von ihnen mit dem Tod eines Mitmenschen die Lebensverhältnisse radikal verändern und sie mit Aufgaben und Schwierigkeiten umgehen müssen, mit denen sie nie gerechnet haben, und auf die sie entsprechend völlig unvorbereitet sind.
«Tot ohne Gott» ist ein lesenswertes Buch, auch wenn die Fülle an Zitaten Leserinnen und Leser manchmal erschlägt. Es ist also voller Redundanz. Die Trennschärfe zwischen den fünf Kapiteln ist nicht sehr ausgeprägt. Dies illustriert wohl unfreiwillig, dass das zugrundeliegende Kernproblem in der irrationalen, aber in der menschlichen Zivilisation tief verwurzelten Illusion besteht, der Mensch sein ein besonderes Lebewesen, «die Krone der Schöpfung», und in der daraus abgeleiteten Erwartung, er müsste seine Sterblichkeit überwinden können.
Ob die Illusion und die darauf gestützte Erwartung des ,Ausgenommenseins’ vom Zyklus «Werden, Sein, Vergehen» ein Urbedürfnis des Homo Sapiens ist, oder ob sie ihm ab der Zeit, in der er reden und denken gelernt hat, kulturell eingeredet wurde, ist eine Frage, mit der sich Wetz nicht auseinandersetzt, und die wohl unbeantwortet bleiben muss.