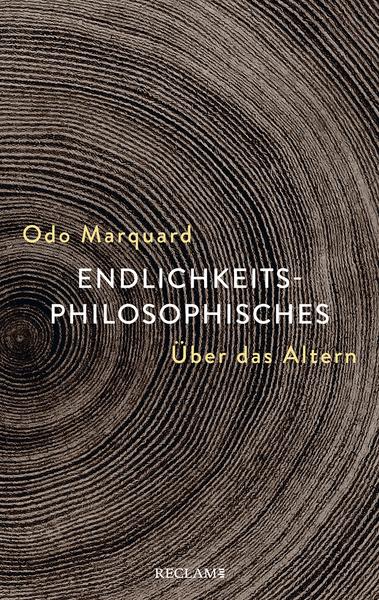
Der schön aufgemachte kleine Band (125 Seiten) versammelt die wichtigsten philosophische Essays von Odo Marquard zum Thema Endlichkeit. Diese werden eingerahmt von einem Vorwort von und einem ausführlichen Gespräch mit Franz Josef Wetz (deutscher Philosoph und ehemaliger wissenschaftlicher Mitarbeiter und Assistent Marquards an der Universität Giessen). Wetz ist auch der Herausgeber des Bandes, der 2013 zu Marquards 85. Geburtstag erschien.
In einem der Essays kokettiert Marquard damit, dass seine Gedankenwelt und seine Art, sie zu erklären und zu begründen, von zeitgenössischen (vielleicht neidischen) Zunftkollegen als ,marquardisieren’ qualifiziert wird. Wenn damit das gemeint ist, was ich in meiner früheren Marquard-Lektüre (vor allem in «Zukunft braucht Herkunft» kennen und schätzen gelernt habe, dann verstehe ich, dass Marquard diese Qualifikation primär als Kompliment genossen hat. Sein Stil ist nämlich einzigartig: zwar schwierig und anstrengend zu lesen, denn Marquard schreibt unmöglich lange Sätze, mit gelegentlich mehrstufig verschachtelten Einschüben zuhauf; für mich sind diese Sätze jedoch in erster Linie prototypische Exemplare der «allmählichen Verfertigung des Gedankens beim Schreiben» (Anmerkung BB: je nach Quelle auch ,des Redens’). Wenn man diese Sätze quasi per Retro-Engineering gedanklich mitschreibt, oder mitspricht, dann werden sie leicht verständlich. Ich habe überhaupt den Eindruck, dass Marquards Texte eigentlich Reden oder Vorlesungen sind, die ein fleissiger Helfer mitschreibt und später schriftlich editiert. Darüber hinaus sind Marquards Texte gespickt mit Humor, kreativen Wortschöpfungen und immer wieder mit einem guten Mass an Selbstironie. Das zeigen schon die Titel der im Bändchen versammelten Essays:
- «Einwilligung in das Zufällige»: Marquard zeigt hier anhand seiner eigenen Biografie, dass wir viel mehr durch Zufälle werden, was wir sind, als durch kluge persönliche Wahl und Planung.
- «Verweigerung der Bürgerlichkeitsverweigerung»: Marquard stellt fest, dass neben der Bürgerlichkeit eigentlich nur Totalitarität als Gestaltungsprinzip für unsere Gesellschaft möglich ist; Marquard sieht als Haupteigenschaften der Bürgerlichkeit: Friede mit dem Alltag; Status der Ordinarienuniversität; «Skeptische Generation» (Helmut Schelsky), Ablehnung der Flucht aus dem Gewissenhaben in das Gewissensein; im Gegensatz dazu sieht er den Nazi-Totalitarismus und den Kommunismus (als Extrem aller linken Weltverbesserungsutopien), die beide die Bürgerlichkeit gleichermassen verweigern; und Marquard plädiert für die Verweigerung der Verweigerung
- «Zeit und Endlichkeit»: Das Menschenleben ist kurz; deshalb hält Marquard alle Bemühungen, «sich von den vorgegebenen bürgerlichen Institutionen und Traditionen zu lösen, um sie kritisch zu überprüfen und gegebenenfalls zu verändern» (Wetz im Vorwort), für illusorisch. «Das Leben ist zu kurz, als dass wir jedes Mal von vorne anfangen und alles neu regeln könnten. Deshalb geht es nicht ohne bewährte Konventionen. Zugleich aber ist das Leben auch zu kurz, um mit allem beliebig lange zu warten. Was neu getan werden soll, sollte möglichst bald getan werden. Die Moderne zwingt den Menschen also ein ,temporales Doppelleben’ auf, nämlich gleichermassen schnell und langsam zu leben» (Wetz, ebenda).
- «Vernunft und Humor»: Hier argumentiert Marquard, «dass es von Vernunft zeuge, sich auf diese zweigeteilte Wirklichkeit, so wie sie ist, einzulassen. Und als bewährtes Mittel, den Härten des Lebens zu widerstehen und empfiehlt er den Humor.
- «Lebensabschnitt der Zukunftsverminderung»: das ist Marquards plastuische Umschreibung für ,das Alter’; «es gehöre zur Eigenart des Alters, keine grosse Zukunft mehr zu haben und infolgedessen von irreführenden Illusionen verschont zu bleiben. Darum seien ältere Menschen besser als jüngere geeignet, nüchtern zu erkennen, was ist.» (Wetz im Vorwort) Dies führt Marquard konsequent zu Ende, mit dem Postulat für den «Sieg des So-ist-es über das So-hat-es-zu-sein.
- Im letzten Teil der Sammlung, im Gespräch zwischen Odo Marquard und Franz Josef Wetz gesteht Marquard offen und berührend ein, dass das Alter zwar den Sinn für die Wirklichkeit schärfen kann, dass aber die Wirklichkeit für ihn überaus schlimm ist.
Zusätzlich zu den Endlichkeits-Gedanken tauchen zwei Elemente, die bereits in «Zukunft braucht Herkunft» zum roten Faden gehören, mehrfach auf: Zum ersten die These, dass ein erfolgreiches ,temporales Doppelleben’ voraussetzt, dass wir uns stets bewusst sind, woher wir kommen, und hohen Respekt vor den tradierten Konventionen und Leistungen haben, welche uns unsere Geschichte anvertraut und zum Fundament dessen gehören, was ist. Und zweitens, dass das ,So-ist-es’ keine Rechtfertigung benötigt, weil es schon allein deswegen legitimiert ist, dass es ist. Die Beweislast, dass das ,So-hat-es-zu-sein’ besser ist als das ,So-ist-es’ liegt beim Veränderer. Es wäre für unsere Gesellschaft konsequenterweise sehr hilfreich, wenn sie die von vielen dogmatisch vertretene Gleichung «Progressiv ist gut; konservativ ist schlecht.» ablehnen und jeden Vorschlag zur Veränderung des ,So-ist-es’ mit der Forderung «Beweise, dass und warum das ,So-hat-es-zu-sein’ besser ist» zu kontern – und die postulierte Veränderung erst dann zu akzeptieren, wenn dieser Beweis erbracht ist.
Die Essay-Sammlung «Endlichkeitsphilosophisches» hat mich darin bestärkt, mein eigenes Altern und Alter bewusst zu erleben und zu leben und den Primat des So-ist-es über das So-hat-es-zu-sein anzuerkennen.
Marquard umschreibt dies so (Seiten 81-82): «Denn dort – im Alter – wird der Tod, der jedermanns gewisseste Zukunft ist, immer aufdringlicher: Er besiegelt, dass wir – wenigstens in diesem Leben – immer weniger Zukunft und schliesslich gar keine Zukunft mehr haben. Darum werden gerade im Alter jene Illusionen überflüssig und können entfallen, die durch Zukunftskonformismus – sozusagen durch future correctness – entstehen, und es gelingt gerade dadurch: zu sehen und zu akzeptieren, wie es ist: durch Vernunft und Humor. Sie sind das So-ist-es-sagen-Können. Vernunft ist, was man macht, wenn nichts mehr zu machen ist; Humor ist, dass man lacht, wo nichts mehr zu lachen ist. Das ist die Lage des Alters angesichts des näher kommenden Todes. Vernunft ist, wenn man trotzdem denkt; Humor ist, wenn man trotzdem lacht.»
Marquard beschliesst das Kapitel «Vernunft und Humor» mit dem bekannten Zwölfzeiler über den Humor von Wilhelm Busch:
«Es sitzt ein Vogel auf dem Leim,
Er flattert sehr und kann nicht heim.
Ein schwarzer Kater schleicht herzu,
Die Krallen scharf, die Augen gluh.
Am Baum hinauf und immer höher
Kommt er dem armen Vogel näher.
Der Vogel denkt: weil das so ist,
Und weil mich doch der Kater frisst,
So will ich keine Zeit verlieren,
Will noch ein wenig quiquilieren
Und lustig pfeifen wie zuvor,
Der Vogel, scheint mir, hat Humor.»
Fazit:
Humor und Philosophie – das passt. Humor und Ideologie – pfui Teufel!