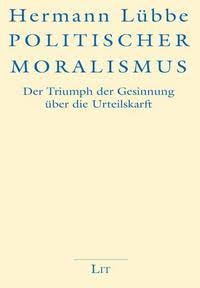
Der kompakte Essay (121 Seiten) beruht auf Vorträgen, die Hermann Lübbe 1984/85 gehalten hat; er ist aber auch heute brandaktuell. Deshalb ist die 2019 neu aufgelegte Ausgabe des Essays hoch willkommen.
Lübbe hat vor 35 Jahren erahnt oder vorausgesehen, dass das von ihm untersuchte und kritisierte Phänomen des ‚politischen Moralismus‘ offenbar am Anfang einer Karriere stand, das heute vielleicht, hoffentlich, seinen Höhe- und Wendepunkt erreicht hat.
Er definiert (leider erst) am Schluss des Essays, was er unter ‚politischem Moralismus‘ versteht und fasst seine Definition in vier Sätzen zusammen:
- «Politischer Moralismus – das ist die Selbstermächtigung zum Verstoss gegen die Regeln des gemeinen Rechts und des moralischen Common sense unter Berufung auf das höhere Recht der eigenen, nach ideologischen Massgaben moralisch besseren Sache.
- Politischer Moralismus – das ist die rhetorische Praxis des Umschaltens vom Argument gegen Ansichten und Absichten des Gegners auf das Argument der Bezweiflung seiner moralischen Integrität; statt der Meinung des Gegners zu widersprechen, drückt man Empörung darüber aus, dass er es sich gestattet, eine solche Meinung zu haben und zu äussern.
- Politischer Moralismus – das ist die zivilisationskritische Praxis, die Folgelasten moderner Zivilisation, die in etlichen Lebensbereichen inzwischen rascher als ihre Lebensvorzüge wachsen, statt als entwicklungsbegrenzende Kosten als Beweis für die geschichtsphilosophische These zu interpretieren, dass die moderne Zivilisation das Endstadium einer bis in die Moral unseres kulturellen Naturverständnisses hineinreichenden Verfallsgeschichte ist.
- Politischer Moralismus – das ist das appellative Bemühen, die Verbesserung gesellschaftlicher Zustände über die Verbesserung moralischer Binnenlagen, durch pädagogische und sonstige Stimulierung guter Gesinnung zu erwarten statt von einer Verbesserung rechtlicher und ordnungspolitischer Institutionen in der Absicht, uns zu bewegen, auch aus Eigeninteresse zu tun, was das Gemeinwohl erfordert.»
Im ersten Teil untersucht Lübbe die Voraussetzungen, die normale Bürgerinnen und Bürger (mehrheitlich natürlich Bürger) dazu brachten, im Namen von totalitären Systemen (Nationalsozialismus und Kommunismus) grauenhafte Verbrechen zu begehen. Antwort: siehe obigen Satz 1). Gemäss Lübbe beginnen die meisten der Täter als Mitläufer, ob aus Überzeugung oder Opportunismus spielt keine Rolle; irgendwann wird der Punkt erreicht, an dem sie sich zwischen ‚Umkehren‘ – unter Inkaufnahme schwerer persönlicher Nachteile – und ‚Weitermachen‘ entscheiden müssen. Die meisten machen weiter und beruhigen spätestens ab diesem Zeitpunkt ihr Gewissen damit, dass sie sich als Vertreter einer überlegenen, besseren Moral sehen. Er macht dabei keinen Unterschied zwischen Nationalsozialismus und Kommunismus, ausser dass er darauf hinweist, dass der Nationalsozialismus Rassen-orientiert, der Kommunismus Klassen-orientiert agierte.
Er macht einen deutlichen Unterschied zwischen Terrorismus und politischem Moralismus, indem er den Terrorismus der gewöhnlichen Kriminalität zuweist. Ob er das heute, mehr als 35 Jahre nach der Niederschrift seiner Gedanken, immer noch so machen würde, bezweifle ich.
Danach widmet er sich ‚kleineren‘ Schuhnummern und behandelt den politischen Moralismus des Alltags. Wenn auch teilweise eher umständlich und schwer verständlich geschrieben (ich nehme an, dass die Texte eher eine Rede als eine Schreibe sind), liest sich der Essay auf Schritt und Tritt als aktuelle Beschreibung der ‚cancel culture‘ und als Spiegel und Kritik der dümmlichen Gesellschaftskritik, die hinter jedem Baum einen Verschwörer sieht und die Entwicklung der Zivilisation unbedingt als Ergebnis bösartigen Zerstörungswillens verstehen will.
In Kapitel V widmet sich Lübbe der Darlegung und teilweise beissenden Kritik der Manie zahlloser zeitgenössischer Moralisten, Sachfragen in moralische Fragen zu verwandeln, oder den Sachverstand durch Betroffenheit zu ersetzen. Er postuliert, dass jede noch so berechtigte Empörung über Missstände in dieser Welt keine Rechtfertigung dafür ist, den Sachverstand ausser Betrieb zu setzen, und dass moralische Empörung allein letztlich wirkungslos ist und damit ein Leerlauf bleibt.
Auch die Kapitel VI und VII über das moralische Selbstverständnis unserer Zivilisation sind sehr lesenswert. Sätze wie «Moralisten neigen dazu, die unleugbar anwachsenden Folgelasten unserer Zivilisation als Beweis originärer moralischer Defizienz der in dieser Zivilisation massgebenden Lebensorientierungen zu nehmen.» bereiten gekonnt die Kernthese von Lübbe vor, dass nämlich Moralismus eine Sackgasse ist und es klüger wäre, die Menschen daran zu erinnern, «aus Eigeninteresse zu tun, was das Gemeinwohl erfordert.» (siehe Satz 4)
Auf Seiten 98-100 schreibt Lübbe: «
«Bei der Irreversibilität des Zivilisationsprozesses, den wir seit sechstausend Jahren hinter uns haben, sind daraus keinerlei praktischen Folgen absehbar, und auch in moralischer Hinsicht ergibt sich nichts als eine Bekräftigung der alten Einsicht, dass Leben, weder individuell noch kollektiv, in der Orientierung am Zweck der Lebensverlängerung als einem höchsten Lebenszweck nie sich hat führen lassen. Das bedeutet: Wenn sich aus unserer zivilisatorischen Situation wirklich unabweisbar die Einsicht ergäbe, dass unsere kollektive Lebensperspektive sich verkürzt hat, so lässt sich darauf auf der Ebene moralischer Operationen gar nicht sinnvoll reagieren. Weder moralische Anklagen an die Adresse sei es neolithischer, sei es industrieller Revolutionäre sind sinnvoll noch auch der Aufruf zu innerer Umkehr. Dass man im übrigen für einen Fortgang der Dinge das Mögliche tun muss, ist als moralische Forderung von pathosunfähiger Trivialität. Was aber tatsächlich möglich ist, will sowohl in naturaler wie in sozialer Hinsicht nicht zuletzt in Kategorien der Zweck-Mittel-Relation ausgewiesen sein. Die rationale Form der Reaktion auf die Einsicht in Grenzen unserer Möglichkeiten hingegen war nie Moral, vielmehr stets Religion. (Anmerkung BB: Ich verstehe nicht, weshalb Lübbe hier plötzlich die Religion aus dem Hut zaubert; die einzige Erklärung für mich ist, dass er das sarkastisch-ironisch meinen muss.)
Das ist es, was die aktuellen Propheten der überfälligen grossen moralischen Wandlung, unbeschadet der erwiesenen Medientauglichkeit ihres Charismas, über die Erzeugung von Gestimmtheiten hinaus unproduktiv bleiben lässt. Die gute Gesinnung, die sich an der Realität reibt, zerreibt sich selbst, wenn sie nicht zum Impuls verstandeskontrollierter Handlungen wird und sich an die Klugheit bindet.»
…
«Tatsächlich ist unsere Zivilisation reich und differenziert genug, um Aussteiger dieses respektablen Typs (Anmerkung BB: gemeint sind Aussteiger, die verlassene Bergbauernhöfe wieder in Betrieb nehmen, sich in der Entwicklung durchaus universalisierungsfähiger Alternativkulturen erfinderisch zeigen, usw.) in wachsender Zahl in sich auszuhalten. Dennoch handelt es sich bei diesen Randgruppen um Alternativkulturen innerhalb unserer Zivilisation und nicht um Alternativen zu ihr. Mit der alternativkulturellen Disponibilität aufgelassener Bergbauernhöfe nähme es rasch ein dramatisches Ende, wenn die innere Wandlung, die ins alternative Leben treibt, wirklich einmal die Massen ergriffe, und ein Verteilungssystem auf Kriegsrechtsbasis wäre unvermeidlich, wenn wir massenhaft unseren Milch- und Käsebedarf durch die Haltung von Ziegen sichern wollten, wie man sie hier und da auf Neubrachen weiden sieht. Die verbreitete Sackgassenmetaphorik passt nicht auf unsere Lage. Sackgassen erzwingen in der Tat Umkehr, in sei es in stets prekären Rückwärtsfahrten. In der zivilisatorischen Evolution hingegen wäre ihre Revolution, die Umkehr ihrer Bewegungsrichtung, mit ihrer Katastrophe identisch. Die angemessene Metaphorik zur Verständigung über unsere Lage ist daher die des point of no return, den man bereits hinter sich hat: Einzig vorn sind noch Auswege offen.»
Wenn nicht a priori klar wäre, dass unsere zeitgenössischen Erzmoralisten und Katastrophenpropheten nicht mehr fähig oder willens sind, sich mit Gedanken von Menschen ausserhalb ihrer eigenen Blase zu befassen, müsste man alle Kapitalismuskritiker und Greta-Jünger dazu verpflichten, Lübbes Essay zu lesen und Satz für Satz mit Argumenten, d.h. nicht mit Diffamierungen à la Satz 2) von Lübbe, zu kritisieren. Wishful thinking.