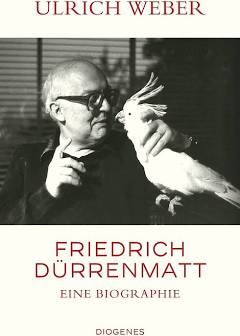
Ulrich Weber kann aus dem Vollen schöpfen. Seit fast 30 Jahren betreut er als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Schweizerischen Literaturarchivs (unter anderem) den literarischen Dürrenmatt-Nachlass; während 10 Jahren verantwortete er im Centre Dürrenmatt in Neuchâtel (also am ehemaligen Wohnsitz Dürrenmatts) die Erschliessung des von Dürrenmatt hinterlassenen Bildwerks. Er kannte zahlreiche Freunde und Kollegen Dürrenmatts persönlich und hatte direkten Zugang zu deren Erinnerungen an den Schriftsteller und Denker, der sich zeitlebens aus allen denkbaren Perspektiven mit dem Zeitgeschehen, mit dem Zustand und den Zukunftsperspektiven der Gesellschaft sowie mit dem Grenzbereich zwischen Kunst und Wissenschaft auseinander setzte.
Webers Biographie ist in dem Sinne umfassend, als er in überwiegend chronologischer Reihenfolge ausführlich das Leben und das künstlerische Werk des Künstlers, seine familialen Beziehungen und zahlreichen Freundschaften, aber auch den ‚Citoyen‘ Dürrenmatt nachzeichnet und anhand unzähliger Primärquellen dokumentiert. Dabei fliessen Leben, Entwicklung der persönlichen Einstellung zur Literatur und zum Verhältnis zwischen Werk und Autor sowie das eigentliche Werk ständig ineinander über. Webers Biographie ist aber auch in einem gewissen Ausmass ausufernd, als er gewisse Aspekte des Lebens und Arbeitens von Dürrenmatt in einem Grad von Detailliertheit schildert, die bei der Lektüre ermüdet bis langweilt. Die von Dürrenmatts zweiter Ehefrau Charlotte Kerr ‚angeordnete‘ neue räumliche Einteilung, Möblierung und künstlerische Ausschmückung von Dürrenmatts Atelierhaus oberhalb von Neuchâtel diene als besonders offensichtliches Beispiel.
Die Biographie präsentiert Dürrenmatt allerdings nicht nur als Titanen der deutschsprachigen Literatur, sie zeigt ihn auch als menschlichen Zeitgenossen, als gemütlichen Emmentaler, als Geniesser und masslosen Genussmenschen, der regelmässig mit seinen Gesprächspartnern an einem einzigen Abend mehrere unerschwinglich kostbare Flaschen Bordeaux (pro Teilnehmer) ‚vertilgen‘ konnte, oder auch als spendablen Gastgeber, der jederzeit grössere Gruppen von Freunden oder Theaterleuten in Zürichs Nobelrestaurant Kronenhalle, im Grillstand Vorderer Sternen oder in Hans Liechtis Neuenburger ‚Beiz‘ verköstigen konnte.
Dürrenmatt erscheint in Webers Darstellung als ein Mensch voller Widersprüche, der sein ganzes Leben lang auf einer Suche war, deren Ziel er im Grunde genommen nicht kannte.
- Einerseits kämpfte er sich philosophisch und persönlich permanent mit Religion und Glauben ab; es scheint, dass er ständig danach sucht, seinen geistigen Bruch mit der Welt seines Vaters, der Pfarrer war, zu rechtfertigen. Er positioniert sich zwar als Atheist (manchmal macht er dabei allerdings den Eindruck, damit bloss zu kokettieren), kann sich aber von Themen wie Gott, Erlösung oder Glauben nie vollständig befreien.
Sein enger Freund Hans Liechti bezeichnet ihn in einem der nächtelangen Gespräche, welche die beiden miteinander führen, als den ‚religiösesten Menschen‘, den er kenne – und er meint das nicht etwa ironisch.
- Anderseits vertritt Dürrenmatt konsequent die Auffassung, dass Leben und Werk eines Schriftstellers strikt voneinander zu trennen seien. Seine Werke haben denn auch, vor allem in den Jahren des rauschenden Erfolgs als Dramatiker, kaum einen Bezug zu Dürrenmatts Leben. Er meinte auch, dass sein Leben nicht interessant genug sei, um Stoff für ein Stück, eine Biographie, schon gar nicht für eine Autobiographie herzugeben. Das ist ein Giftpfeil in Richtung seines zeitweiligen Schriftstellerfreundes und -konkurrenten Max Frisch, dessen Werk sich sehr häufig und intensiv um das eigene Leben Frischs und dessen Frauengeschichten rankt. Trotzdem verbringt Dürrenmatt die letzten 10 – 20 Jahre seines künstlerischen Lebens, um in den sogenannten ‚Stoffen‘ sein Werk im Rückblick aufs Engste mit seinem Leben zu verbinden. Vielleicht war das eine für Dürrenmatt typische ironische Kehrtwendung.
Leider hilft die Biographie nicht, mein Rätsel betreffend die Quelle für «Der Besuch der alten Dame» zu lösen. Bei fast allen Werken Dürrenmatts liefert Ulrich Weber Hinweise auf die Art und Weise, wie Dürrenmatt auf die Idee zum ‚Stoff‘ gekommen ist; ausgerechnet bei diesem Drama fehlen diese. Es bleibt für mich also offen, ob Dürrenmatt Mark Twains Erzählung «Wie Hadleyberg verderbt wurde» kannte. In dieser Geschichte kommt mitten in einer stürmischen Gewitternacht ein Unbekannter nach Hadleyburg und hinterlässt bei der Frau des Posthalters einen prallgefüllten grossen Sack (voller Geld) und die Bitte, den Mann zu finden, der dem Unbekannten vor Jahrzehnten einen lebensrettenden Gefallen getan haben soll und ihm das Geld zur Belohnung zu geben. Zuerst stürzen der Posthalter und seine Frau in das Dilemma, ob sie diese Bitte ernst nehmen oder nicht besser das Geld für sich behalten sollen; sie entscheiden sich für die Ehrlichkeit und informieren die Dorfgemeinschaft über die seltsame Bitte. Jetzt beginnt, mit umgekehrten Vorzeichen, eine Entwicklung à la «Besuch der alten Dame»; die Geschichte sickert durch, in Hadleyburg beginnen Spekulationen, ob es nicht gescheiter wäre, das Geld einfach an die Einwohner zu verteilen, anstatt hoffnungslos nach einem wohl nie identifizierbaren Wohltäter zu suchen. Die Bewohner fangen bereits damit an, in Erwartung des Geldsegens Anschaffungen zu tätigen, die sie sich nie leisten könnten. Schliesslich wird, nachdem kein Wohltäter zu finden ist, unter Anteilnahme der Medien des ganzen Landes, der Sack geöffnet. Er enthält nichts als wertlose Papierschnitzel.
Der Gegensatz zwischen Hadleyburg und Güllen bringt das Dürrenmatt’sche Gestaltungsprinzip: «Eine Geschichte ist er dann fertig erzählt, wenn sie die schlimmstmögliche Wendung genommen hat» sehr schön auf den Punkt. Dem steht Mark Twains implizites Gestaltungsprinzip gegenüber: «Eine Geschichte ist erst dann fertig erzählt, wenn die Protagonisten der grösstmöglichen Lächerlichkeit ausgesetzt sind.» Das ist der Humorist Twain gegenüber dem Zyniker Dürrenmatt. Man kann sich allerdings fragen, ob im Sinne Dürrenmatts die grösstmögliche Lächerlichkeit nicht die ideale Verkörperung der schlimmstmöglichen Wendung sein könnte.
Webers Biographie hat mir sehr geholfen, Dürrenmatt besser zu verstehen. Ich halte seine ‚Bestseller‘ (Alte Dame, Herkules und der Augiasstall, Physiker, sowie die Kriminalromane) nach wie vor für etwas vom literarisch Besten, was im 20. Jahrhundert in der deutschsprachigen Literatur geschaffen wurde. Sie sind tief im wirklichen Leben verwurzelt, behandeln Probleme mit einer sehr menschlichen Dimension und strotzen von Humor und Ironie – und sind per Saldo das Gegenteil von ‚abgehoben‘. Sein späteres ewiges Ringen mit dem Glauben, der Metaphysik und seine zwar etwas dilettantische Beschäftigung mit den Naturwissenschaften sind beeindruckend, berühren mich aber kaum. Für mich sind das Luxusprobleme, mit denen sich eigentlich nur Menschen beschäftigen, die keine existentiellen Sorgen haben, oder die nicht wissen, wozu sie auf der Welt sind. Wenn ich es mit Kunst zu tun habe (egal ob Literatur, Malerei oder Musik), zählt für mich das Werk allein; was sich der Künstler dabei gedacht hat, oder – wie Dürrenmatt mit den ‚Stoffen‘ – 20 Jahre später, also im Nachhinein, dazu nach-gedacht hat, interessiert mich weniger bis gar nicht. Ein Wort noch zu Dürrenmatts politischer Haltung: Mir scheint, er hat nicht wie Frisch stets an der Schweiz gelitten. Dazu war er zu sehr distanziert, ironisch und auch in dem Sinn realistisch, als er felsenfest davon überzeugt war, dass Politik, politische Gestaltung letztlich Menschenwerk ist und damit fehlerhaft sein muss; er erwartete keine perfekte Welt und bildete sich auch nicht ein, eine solche schaffen zu können. Allerdings geriet er gegen Schluss seines Lebens doch noch auf eine Art schiefe Ebene, und zwar mit seiner Havel-Rede, in der er die Schweiz als Gefängnis darstellte, in das sich die Schweizer freiwillig begeben haben, in dem die Gefangenen gleichzeitig die Wärter sind und sich selber bewachen… So weit, so gut: typisch Dürrenmatt’sche Ironie und Paradoxie. Aber am Schluss dieser Rede führt Dürrenmatt aus: «Was sind wir Schweizer für Menschen? Vom Schicksal verschont zu werden ist weder Schande noch Ruhm, aber es ist ein Menetekel (gemäss Wikipedia: eine unheilverkündende Warnung, ein ernster Mahnruf oder ein Vorzeichendrohenden Unheils)». Nur schon die Idee, dass das vom Schicksal-verschont-Sein Schande oder Ruhm sein könnte, ist abwegig. Warum genügt als Erklärung nicht auch eine Kombination von Glück, Umständen, kluger Politik und Opportunismus? Womit begründet Dürrenmatt, dass dies ein Menetekel sein soll – weshalb soll daraus ein Unheil resultieren? Überhaupt nicht. Ich schliesse daraus, dass auch Dürrenmatt die Schweiz als etwas ganz Besonderes sieht, als ein Land, das irgendwie Vorbild für alle anderen sein sollte. Ob das nur eine Ausprägung des besonders für Frisch prägenden, vom Germanisten, Querdenker und ehemaligen ETH-Rektor Karl Schmid formulierten ‚Unbehagen im Kleinstaat‘ ist, oder der Ausdruck des Anspruchs, die Schweiz könnte oder sollte Vorbild für alle anderen sein, wenn Intellektuelle oder Künstler wie Dürrenmatt das Sagen hätten – das bleibt offen, und so oder so ein Rätsel.