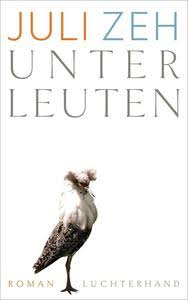
Zehs 650-Seiten-Schmöker beginnt gut strukturiert.
Die Handlung spielt in Unterleuten, einem kleinen Kaff irgendwo in Brandenburg nördlich von Berlin, in dem die ostalgische Mentalität der Alt-Einwohner mit der Aussteiger-Mentalität moderner Städter zusammenprallt. In den ersten Kapiteln (Teil I) werden die dramatis personae wie in der Exposition eines klassischeen Dramas eingeführt und charakterisiert (siehe ausführliches Verzeichnis Seiten 637ff):
- Gerhard Fliess, der Vogelschützer, und seine 20 Jahre jüngere, emotional vollständig auf ihr erstes Baby fixierte Frau Jule; beide frische Aussteiger aus Berlin
- Linda Franzen, die Pferdenärrin mit ihrem Jahrhundertpferd Bergamotte, und ihr Freund Frederik; ebenfalls frisch aus Berlin zugezogen; ihr Zuzugsgrund ist allerdings nicht ein Ausstieg, sondern ein Neuanfang; Linda möchte in Unterleuten eine Pferdezucht aufbauen, benötigt dafür aber zusätzlich zum bereits erworbenen Grundstück etwa vier Hektar Land, das sie von Konrad Meiler zu erwerben hofft; dieser konnte dem Drängen von Linda nicht widerstehen und ist, obwohl er immer klar gemacht hat, dass er nicht verkaufsbereit ist, für Gespräche nach Unterleuten gekommen
- Konrad Meiler, Beratungs-Unternehmer, d.h. äusserst erfolgreicher Self-Made-Man aus Ingolstadt, der, einfach weil er es sich leisten kann, an einer Auktion 250 Hektar Land bei Unterleuten gekauft hat
- Schaller, Allround-Handwerker, der sich mit kleinen, an der Grenze der Legalität liegenden Geschäften, vor allem Reparaturen und Verkauf von maroden Autos, über Wasser hält
- Gombrowski, Sohn einer vormaligen einheimischen, also vor-kommunistischen Grossgrundbesitzerfamilie, der sich nach der Wende für die Rettung der ehemaligen LPG «Gute Hoffnung» engagierte und nach der erfolgreichen Gründung der Nachfolgegesellschaft «Ökologica GmbH» deren Führung übernahm
- Kron, Alt-Ossi und alt-Unterleutner, graue Dorf-Eminenz, kennt alle alteingesessenen Dorfbewohner, kennt sich dank ausgiebiger Lektüre in der grossen weiten Welt bestens aus, und begegnet dieser natürlich mit eingefleischt zynischer Haltung; erfährt an einer Dorf-Vollversammlung zum ersten Mal von einem Projekt, dessen Ziel die Errichtung einer grossen Windfarm im direkten Vorland von Unterleuten ist; an der Versammlung wird das Projekt vom Bürgermeister Arne zusammen mit dem jungen Schnöselverkäufer Pilz vorgestellt; mit Entsetzen begegnet er an dieser Gemeindeversammlung erstmals seit der Auktion wieder dem Landkäufer Konrad Meiler; an der Versammlung nehmen auch Gerhard Fliess und Jule teil (die über das Windpark-Projekt entsetzt sind); auch Linda, ihr Freund und auch ihr zufällig gleichzeitig anwesender Besucher Konrad Meiler; beide Paare sehen sich, wenigstens auf Distanz, bei diesem Anlass zum ersten Mal; für Linda ist es ein Schock, weil sie am gleichen Morgen ein Schreiben von Gerhard bekommen hat, mit dem er seitens des Vogelschutzes harten Widerstand gegen Lindas Pferdezucht-Pläne ankündigt; noch vor der Versammlung hatte Meiler Linda klar gemacht, dass er ihr, wenn möglich, bei ihrem Projekt zwar helfen will, einen Landverkauf aber kategorisch ausschliesst; Gerhard wittert hinter jedem Busch eine von aufs Materielle fixierten Westlern angezettelte Verschwörung gegen alle, die sich für eine bessere Welt – wie er selbst – einsetzen
- Kessler, Erik, Hilde und Betty; Erik, Kumpan von Kron und Mitstreiter bei dessen Kampf um die richtige Auflösung der LPG «Gute Hoffnung»; Hilde, Eriks Frau, Sekretärin der LPG und angebliche Geliebte von Gombrowski, von dem viele in Unterleuten annahmen, er sei der Vater von Hildes Tochter Betty; Betty hatte von ihrer Mutter das Sekretariat der LPG übernommen; Hilde hatte sich nach dem Tod ihres Mannes kurz nach der Wende vollständig in ihr Haus zurückgezogen
- Arne, jetziger Bürgermeister von Unterleuten; versank nach der Wende, weil sein DDR-Diplom von der Bundesrepublik nicht anerkannt und er deshalb arbeitslos wurde und in einer tiefe Krise; Gombrowski holte ihn da heraus, indem er Arnes Wahl zum Bürgermeister orchestrierte
- Püppi, Gombrowskis Tochter, studierte und promovierte dank Unterstützung durch ihren Vater in Freiburg Germanistik; hat kaum mehr Beziehungen zu Unterleuten.
- Kathrin Kron-Hübschke, Tochter Krons, Pathologin am Spital in der nächstgelegenen grösseren Stadt Neu-Ruppin; schwierige Beziehung mit ihrem Vater, und schwierige Freundschaft mit Arne; verheiratet mit Wolfi Hübschke, gemeinsame Tochter Krönchen
Mit dem Schluss von Teil I, also mit der Offenlegung des Windparkprojekts, beginnt wie in der klassischen Struktur eines Dramas die Steigerung der Spannung, die Zuspitzung der Konflikte, die zu DDR-Zeiten zwar be- oder entstanden, aber unter den Teppich gekehrt wurden, und seit der Wende durch die neuen sozialen und politischen Gegebenheiten zugedeckt geblieben waren.
Dies wird überlagert von der Tatsache, dass das Projekt, analog zu Dürrenmatts «Alter Dame» Gewinner und Verlierer erzeugen wird. Beispiele:
- Gewinner: Eigentümer von Grundstücken, auf denen der Windpark errichtet werden soll, oder die als Trittbrettfahrer vom zu erwartenden Anstieg von Immobilienpreisen profitieren werden; Unterleutner Bürger und Politiker, die auf einen Einnahmensegen hoffen können.
- Verlierer: Vogel- und Naturschützer, Techno- oder Fortschrittsphobe, oder Menschen, die grundsätzlich gegen Veränderungen (Aussicht auf Windräder statt unverstelltem blauem Himmel) sind, oder alle, die auf die realen oder potentiellen Gewinner neidisch sind.
Die Exponenten des jahrzehntelang unter dem Teppich des Wendeschweigens mottenden Konflikts sind Gombrowski einerseits und Kron anderseits, natürlich zusammen mit ihren jeweiligen Anhängern. Zwietracht, Streit, gegenseitigen Intrigen und letztlich Hass entwickelten sich aus der Auseinandersetzung um die Art der Auflösung der ehemaligen LPG «Gute Hoffnung»; Gombrowski setzte sich für eine Umwandlung in eine «Ökologica GmbH» ein, in die er auch seinen Anspruch auf Rückerstattung des ursprünglichen Besitzes der Familie Gombrowski einbringen wollte (das waren immerhin rund 70% des gesamten LPG-Besitzes). Kron befürwortete eine Mischung von Auflösung in kleine Güter (entsprechend dem seinerzeit mehr oder mehr weniger freiwillig eingebrachten Besitz) und Genossenschaft. Gombrowski gewann und übernahm in logischer Fortsetzung seiner früheren Funktion als LPG-Chef auch den Vorsitz der GmbH, und natürlich deren Kapital- und Stimmen-Mehrheit.
Die wirkliche Ursache lag jedoch in einem dramatischen Unglück, das sich während der Zuspitzung des LPG-Auflösungs-Konflikts ereignete. Gombrowski wollte den Konflikt in einer direkten Aussprache mit seinem Kontrahenten Kron lösen und lud diesen und dessen Freund Erik Kessler zu einem Gespräch in einer Lichtung im LPG-Wald ein. In genau diesem Zeitpunkt entlud sich über Unterleuten ein heftiges Gewitter; nachdem sich das Gewitter verzogen hatte, lag Erik tot unter einem von einer hohen Buche ‚abgeblitzten‘ Ast; Kron lag neben ihm mit einem völlig zertrümmerten Bein, das zwar geflickt werden konnte, ihn aber lebenslänglich zum Gehen an Krücken verurteilte
Kron oder Gombrowski äusserten sich nie zu diesem Unfall. Nach der Gerüchteküche von Unterleuten soll Gombrowski Erik ermordet und Kron zum Krüppel gemacht haben, um seine LPG-Lösung endgültig durchzusetzen und um seine angebliche Geliebte, Eriks Witwe Hilde Kessler, heiraten zu können. Obwohl er sich nie von seiner Frau Elena trennte, Hilde also nicht heiratete, ihr aber in seiner unmittelbaren Nachbarschaft ein Haus besorgte und ihr immer beistand, wenn sie in Schwierigkeiten geriet, bestärkte er die im Dorf zirkulierenden Gerüchte.
Im Zusammenhang mit der Frage «Windkraft im Vorland von Unterleuten – ja oder nein?» eskalierte der Streit zwischen den beiden ‚Clans‘ (Gombrowski pro; Kron kontra) immer mehr. Dabei spielt Linda Franzen, der ein Teil des am besten geeigneten potentiellen Windpark-Geländes gehört, eine zentrale Rolle.
Die Schilderung dieses Konflikts gelingt Zeh sehr gut. In aller Ausführlichkeit breitet sie die heimlichen Motive der wichtigsten Akteure aus; sie macht die Steigerung bis zum Klimax und letztlich zur Auflösung des Konflikts sehr spannend.
Denis Scheck (Moderator von «Druckfrisch», ARD) schreibt auf dem Klappentext: «Juli Zehs furchtlos vor jedem Klischee ins Herz der bundesrepublikanischen Wirklichkeit zielender Gesellschaftsroman ist ein literarischer Triumph.» Ich sehe weniger einen literarischen als einen kommerziellen Triumph, der in einer Grossauflage und mehrteiligen ZDF-Verfilmung des Romans gipfelt; für mich liegt die Betonung eher auf «furchtlos vor jedem Klischee». Zeh bemüht wirklich jede denkbare und tatsächlich verbreitete Klischeevorstellung über Ost und West, Kommunismus und Kapitalismus, Ökologie versus Ökonomie, Jugend versus Alter, Ostalgie versus westliche Konsumräusche, etc.). Die Klischees an sich stören mich nicht so sehr, sie entsprechen ja der Wirklichkeit; literarisch schlecht finde ich, dass Zeh diese Klischees in die Gehirne ihrer Protagonisten hineindenkt; sie äussern sich weder in konkreten Handlungen oder Dialogen, sondern sind gewissermassen ‚Hirngespinste‘. Die Tatsache, dass plötzlich (fast) alle Leute in Unterleuten kritische, kluge Gedanken zu Gesellschaftsordnung und Politik in ihren Köpfen herumwälzen, und alle in der gleichen – sehr wohl brillanten – Sprache Zehs, ist schlicht und ergreifend unrealistisch. Die Denkmuster und Ausdrucksfähigkeiten eines Kron oder Schaller müssten sich doch wirklich von denen eines Gerhard Fliess unterscheiden.
Ausserdem: diesen abstossenden abgrundtief negativen Denkmustern fehlt jegliche kritische Distanz und Reflexion; keiner fragt sich, welchen Anteil am ‚Elend dieser Welt‘ sie oder er selbst zu verantworten hat, oder was sie oder er selbst tun könnte, um die Welt zu verbessern. Es sind immer ‚alle anderen‘, welche die Welt dazu machen, was sie ist. Das riecht sehr nach der selbstgerechten, besserwisserischen Haltung des so genannten und selbst ernannten intellektuellen Mainstreams der zeitgenössischen bundesrepublikanischen Gesellschaft.
Der Roman ist mit seinen rund 650 Seiten viel zu lang geraten. Er erinnert mich an Voltaires Diktum in einem Brief an einen Freund: «Entschuldige, Du erhältst heute einen langen Brief; ich habe nämlich keine Zeit.» Zeh hätte die ganze Geschichte sehr stark verdichten können, wenn sie sich mehr Zeit dafür genommen hätte, und wenn sie darauf verzichtet hätte, ihre eigene Sicht auf die Welt und Gesellschaft von heute in allen Variationen ihren Protagonisten immer wieder ins Gehirn zu implantieren. Die Geschichte wäre viel überzeugender, wenn der so entstandene ideologische Überbau sich in konkreten Handlungen oder direkten, aber charaktergerechten Dialogen der Protagonisten ausdrücken würde.Trotzdem: als Zeugnis für die heutige deutsche Wirklichkeit lesenswert.