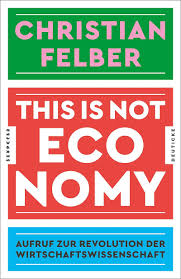
Warum das Pamphlet einen englischen – und darüber hinaus noch irreführenden – Titel haben muss, ist unerfindlich. Und der Untertitel erhebt einen Anspruch, dem es in keiner Art und Weise gerecht wird.
Das Buch ist inklusive Anhängen 300 Seiten lang, zu lang, denn es enthält 300 Seiten Schrott! Zu diesem Urteil gelange ich nach 30 Seiten Einleitung, einigen Stichproben quer durchs Buch, und nach mühseliger Einnahme des Schlusskapitels ‚Alternativen‘ (Seiten 243 – 267).
Felber ist ein Eiferer, Geiferer und Politaktivist (u.a. auch Mitbegründer von Attac in Österreich), der unter dem Schafspelz der wissenschaftlich verbrämten Besserwisserei und der moralischen Überheblichkeit den klassischen Wirtschaftswissenschaften den Garaus machen will. Er verwendet im Überfluss und bis zum Überdruss Begriffe, die er nicht definiert, zitiert Gott und die Welt, ohne die Leser über die Relevanz der Quellen zu informieren. Felber verzichtet durchwegs darauf, die Verbindung und impliziten oder expliziten Interessenbindungen seiner Referenzpersonen mit seinem eigenen Projekt offen zu legen. Von A – Z ist das Buch ein grossflächig redundanter Amoklauf gegen die etablierten Wirtschaftswissenschaften; es kann nicht ernst genommen werden.
Er vergeudet mehr Druckseiten,
- um zu zeigen (gar nicht überzeugend), dass der von der schwedischen Reichsbank gestiftete Preis für Wirtschaftswissenschaftler ‚im Gedenken an Alfred Nobel‘ (häufig fälschlicherweise ‚Wirtschafts-Nobelpreis‘ genannt) ein Machtmittel zur Dominanz der klassischen Wirtschaftswissenschaften sowie ein Unterdrückungsvehikel gegen heterodoxe Wirtschaftstheoretiker (zu denen Felber natürlich gehört) ist, oder für Klagen über eine Entfernung seines eigenen Porträts aus einem österreichischen Schulbuch,
- als um darzulegen, was die von ihm vertretene ‚Gemeinwohl-Ökonomie‘ tatsächlich ist, und weshalb sie der klassischen Wirtschaftslehre überlegen sein soll.
Nach Einlesen in den Wikipedia-Eintrag ‚Gemeinwohl-Ökonomie‘ wird auch sehr schnell klar, dass Felbers Anspruch, Begründer dieser Voodoo-Lehre zu sein, völlig hohl ist, denn der Ansatz, das Gemeinwohl zum Mass aller Dinge zu machen, wurde von zahllosen Gemeinschaften schon lange vor Felber ausprobiert und ad absurdum geführt.
Auf Seiten 194 – 195 begründet Felber, warum er die klassische Wirtschaftslehre für ein ‚ideologisches Glaubenssystem‘ hält. Anschliessend (Seiten 195 – 197) zählt er ‚Die 25 Todsünden der neoklassischen Ökonomik‘ auf. Die meisten seiner Vorwürfe bestehen zunächst in einem von Felber behaupteten Anspruch der Wirtschaftswissenschaften, den diese jedoch gar nicht erheben, und in einer aus der Luft gegriffenen Behauptung, dass dieser Anspruch falsch, demokratisch nicht legitimiert und unmoralisch sei. Er stellt Scheiben auf, um dann auf sie zu ballern. Beispiel: Felber behauptet, die klassische Wirtschaftslehre behaupte, sie sei wertfrei, bestehe jedoch bei ‚richtiger‘, d.h. Felbers Betrachtung aus lauter impliziten, nicht offengelegten Werten und normativen Vorstellungen, die überdies von einer totalen Negierung der Wirklichkeit zeugen sollen. Felbers Argumentation selbst strotzt jedoch von genau denjenigen Mängeln und Fehlern, die er den Wirtschaftswissenschaften an den Hals hängen will.
Im Klappentext wird Felber als ‚Autor und Tänzer‘ vorgestellt. Die Wikipedia-Biografie bestätigt dies. Ja, er ist Autor von Pamphleten, die – jedenfalls im vorliegenden Buch – zu 80 bis 90% selbstreferentiell sind, und ein geistiger Irrwisch-Tänzer (der auch in der realen Welt Tanzperformances aufführt, u.a. für Attac, in jedem Fall für einen guten Zweck).
Natürlich kann man darüber streiten, ob die klassischen Wirtschaftswissenschaften die Wirklichkeit verzerrt darstellen, wenn sie in ihren makroökonomischen Betrachtungen mit dem Modell des ‚homo oeconomicus‘ arbeitet und die stillenden, fürsorglichen Mütter in ihren Modellen nicht abbildet. Aber wenn man die Lösung aller Probleme der Menschheit im Phantom ‚Gemeinwohl-Wirtschaft‘ sehen will, müsste man mindestens in der Lage und gewillt sein, zu erklären, was den ‚Gemeinwohl‘ konkret sein soll; wie man die Menschen dazu bringen will, dieses Gemeinwohl prinzipiell über die Eigeninteressen zu stellen, wie man so etwas demokratisch legitimieren will, und wie man verfahren würde, wenn die Menschen gegen die damit verbundenen Wohlstandsverluste rebellieren würden.
Das Kernproblem sehe ich darin, dass Felber aus den Wirtschaftswissenschaften, die sich primär mit ‚marktfähigen‘ Gütern befasst (Nachfrage/Angebot, Geldmenge, Inflation, Privateigentum, freie Marktwirtschaft und deren gesellschaftlich angeordnete Leitplanken, Wirkungen von politischen direktiven Massnahmen, etc.) eine umfassende Bedürfnisbefriedigungsbehörde (BBB) machen will. Für Felber gehören dazu Aspekte wie Genderperspektiven, Ethik, Ökologie, Psychologie, Neurobiologie, etc.; er bezieht sich dabei auf Verfassungsbestimmungen, wie etwa «Die Wirtschaft des Landes hat die Aufgabe, dem Wohl des ganzen Volkes und der Befriedigung seines Bedarfs zu dienen» (Hessen), oder auf die Verfassungsvorgabe in Bayern «die Befriedigung der Bedürfnisse aller Bewohner». Die zitierten Verfassungsbestimmungen sind zunächst kaum repräsentativ; und die Interpretation, die Felber in sie hineinprojiziert, ist sehr waghalsig und vom Verfassungsgeber kaum so gemeint. Normalerweise wird die Bedeutung von Verfassungsparagraphen durch die einschlägige Gesetzgebung konkretisiert und umgesetzt, und nicht von jedem Bürger auf seine individuelle und willkürliche Weise. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass die Gesetze von Hessen oder Bayern der Wirtschaft eine BBB institutionalisieren, welche einen alle Bedürfnisse der Menschen umfassenden Auftrag hat.
Felber hält «es für sinnvoller, auf die gesamte Palette menschlicher (Grund-)Bedürfnisse abzustellen, als nur auf materielle oder marktvermittelte Bedürfnisse» (Seite 257). Er macht also die Wirtschaftswissenschaft für das Glück, die Lebenszufriedenheit und Lebensqualität der Bevölkerung verantwortlich. Und das ist totaler Unsinn. Erstens gibt es keinen gesellschaftlichen Konsens für die Definition dieser Grundbedürfnisse; zweitens sind die interindividuellen Unterschiede und erst recht die Unterschiede zwischen verschiedenen Ländern, Regionen oder Kontinenten bei diesen Bedürfnissen so gross, dass ein Aggregat (und damit verbunden ein Ziel als Steuerungsgrösse und Erfolgskriterium) über alle diese verschiedenen und teilweise widersprüchlichen Bedürfnisse keinen Sinn ergibt. Die ‚Felber’sche BBB‘ ignoriert ausserdem die Eigenverantwortung der Menschen für die Festlegung der eigenen Bedürfnisse sowie deren Befriedigung vollständig; sie ist ein traumtänzerisches Hirngespinst und auch nicht wünschbar.
«Dieses Buch wird weltweit Ökonom*innen in eine Sinnkrise stürzen» prophezeit die Werbung auf dem Buchdeckel.
Denkste!