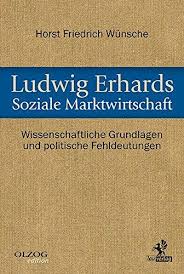
Die unten eingefügte Besprechung des Buchs von Gerhard Schwarz bestätigt meinen intuitiven Verdacht, dass es stark hagiografisch geprägt ist – was bei der Biografie des Autors durchaus nahe liegt.
Es ist in der Tat penetrant, wie sehr Wünsche bemüht ist, Erhard als ‚Anti-Liberalen‘ à la Eucken, Hayek, etc. zu positionieren.
Trotzdem der häufigen Wiederholungen, die zudem meistens noch durch Präambeln wie «wie bereits gesagt wurde…» besonders auffällig gemacht werden, und trotz der Tendenz, Erhard in eine heiligenähnliche und von aller Welt missverstandene Aussenseiterposition zu bringen, enthält das Buch einige bemerkenswerte Zitate Erhards oder Würdigungen Wünsches. Beispiele:
- Zitat Seite 45:
Soziale Sicherheit ist gewiss gut und in hohem Masse wünschenswert, aber soziale Sicherheit muss zuerst aus eigener Kraft, aus eigener Leistung und aus eigenem Streben erwachsen. Soziale Sicherheit ist nicht gleichbedeutend mit Sozialversicherung für alle – nicht mit der Übertragung der individuellen menschlichen Verantwortung an irgendein Kollektiv. Am Anfang muss die eigene Verantwortung stehen, und erst dort, wo diese nicht ausreicht oder versagen muss, setzt die Verpflichtung des Staates und der Gemeinschaft ein.
- Würdigung Wünsches, Seite 278-279:
Erhard ging es um eine wirtschaftliche und soziale Ordnung, in der die Freiheit jedes Einzelnen gewahrt ist, in der also keine obrigkeitlichen Lenkungen, Gängelungen und Bevormundungen stattfinden: um eine Ordnung, in der sich jeder Einzelne in sozialer Sicherheit geborgen fühlen kann, und um ein gesellschaftliches Klima, in dem jedem Einzelnen die Rücksichtnahme gegenüber anderen und die Solidarität mit anderen selbstverständlich sind, in der nicht Hass und Missgunst, sondern Sympathie und Anteilnehme am Schicksal der Anderen herrschen.
Zu dieser Haltung führten vor allem die Kriegs- und Lazaeretterfahrungen Erhards und seine dabei entstandene Wertschätzung Albert Schweitzers. Er hat diesen bewundert und anerkennt, dass Schweitzer mit seiner Kritik an der geistigen Situation nach dem Ersten Weltkrieg eine politische Direktive ausgearbeitet habe, die mit seinen Vorstellungen von liberaler Ordnungspolitik perfekt übereinstimme.
Wie weit hinter solchen Wertvorstellungen der insgeheime Wunsch nach der Wiederherstellung des Paradieses auf Erden steckt (und die Illusion, dies sei möglich), lasse ich offen.
- Würdigung Wünsches, Seite 388:
Erhard hat kein theoretisch begründetes Ideal einer Marktwirtschaft verwirklichen, sondern eine Politik betreiben wollen, mit der das Leitbild von der menschlichen Würde und personaler Autonomie gewahrt wird. Er hat dieses Leitbild konkretisiert und festgestellt, dass unter den Gegebenheiten des modernen Wirtschaftens Freiheit und soziale Sicherheit einen Wohlstand verlangt, an dem alle teilhaben, so dass sich eine freiheitliche Politik mit den Grundzielen umschreiben lässt: Wohlstand für alle, Vollbeschäftigung, leistungsgerechte Entlohnung, Preisstabilität und stetige Wirtschaftsentwicklung.
Mir scheint, dass diese ‚Formel‘ in der singulären Schönwetterphase Phase des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg funktioniert haben mag, aber in turbulenteren Phasen der Wirtschafts- und Gesellschaftsentwicklung versagen muss (Verlagerung der Produktionswirtschaft in die Dienstleistungsgesellschaft, rasant zunehmende Globalisierung, Informatisierung mit der laufenden Auslöschung ganzer Berufszweige, demografische Entwicklung und deren Folge der Invalidisierung des Modells der Schneeballwirtschaft (die zahlenmässige immer mehr werdenden Jungen finanzieren das Wohlergehen und die soziale Sicherheit der dank Aussterbens nie mehrheitlichen Älteren, etc.).
Besprechung des Buchs aus der NZZ vom 3. Februar 2016 (Seite 31, Wirtschaftsteil):
Die falsch verstandene Soziale Marktwirtschaft (Gerhard Schwarz)
War Ludwig Erhard kein Neoliberaler?
Die Wirtschaftsgeschichte Deutschlands, aber auch der Schweiz und Österreichs nachdem Zweiten Weltkrieg ist untrennbar mit der «Sozialen Marktwirtschaft» verbunden. Das «Wirtschaftswunder» der 1950er und 1960er Jahre wird oft auf diese ordnungspolitische Konzeption zurückgeführt. Der verführerische Slogan half zudem, Bevölkerungen, die lange in einer staatlich gelenkten Kriegswirtschaft gelebt hatten oder sich von sozialistischen Planwirtschaften beeindrucken liessen, eine halbwegs freie Wirtschaftsordnung zu «verkaufen». Das war vor allem das Verdienst Ludwig Erhards, der als erfolgreicher Wirtschaftsminister (1949–1963) und als politisch glückloser Bundeskanzler (1963–1966) mit Zivilcourage gegen den «Mainstream» kämpfte und sein Versprechen des «Wohlstands für alle» einlöste. Inzwischen haben sich Parteien von rechts bis links der Formel bemächtigt, und da alle «Soziale Marktwirtschaft» anders interpretieren, ist sie zu einem inhaltsleeren Schlagwort verkommen.
Deshalb greift man gerne zu einem Buch, das Begriffsklärung verspricht. Sein Autor, Horst Friedrich Wünsche, war von 1973 bis zu Erhards Tod 1977 dessen wissenschaftlicher Mitarbeiter und hat danach lange Jahre die Ludwig-Erhard-Stiftung geleitet. Doch die Erwartungen werden enttäuscht. Das liegt an der hagiografischen Herangehensweise, der ausholenden, durch viele Wiederholungen geprägten Auslegeordnung und dem Ausblenden von Erkenntnissen der Public-Choice-Schule, vor allem aber an einer weit hergeholten, wenig überzeugenden These.
Natürlich enthält das Buch viel Richtiges. So kann man kaum genug betonen, dass die politische Ökonomie der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wertorientiert war und sich nicht als technokratische Instrumentenlehre verstand. Ein Lehrer Erhards, Adolf Günther, bezeichnete das Bemühen um Werturteilsfreiheit gar als Flucht aus der Verantwortung – und Erhard scheint diese Einschätzung geteilt zu haben. Zentral für das Verständnis der Sozialen Marktwirtschaft ist ferner, dass in ihr das Ökonomische kein Selbstzweck ist, sondern es um die Würde des Menschen geht. Immer wieder betont Wünsche, dass die Absage an jede Bevormundung durch den Staat zwar auch mit Wohlstand zu tun hat, aber vor allem mit Entscheidungsfreiheit und Selbstverantwortung. Dankbar ist man für den Hinweis auf Erhards Freiheitsbegriff, der weit weg ist von der modischen Neigung, jeden Mangel als Unfreiheit zu interpretieren. Und da man das Soziale der Marktwirtschaft ausufernd interpretieren kann, ist Wünsches Hinweis wichtig, Erhard habe vor der Verselbständigung der Sozialpolitik gewarnt und soziale Sicherheit nicht durch Einkommensumverteilung angestrebt, sondern durch eine Wirtschaftspolitik, die es jedem ermöglicht, durch eigene Anstrengung für sich und die Seinen vorzusorgen.
Solche Ansichten findet man auch bei den «Ordoliberalen» zuhauf. Umso unverständlicher ist, mit welcher Penetranz Wünsche versucht, einen Keil zwischen sie und Erhard zu treiben. Besonders betont er den Gegensatz zwischen Erhard und Walter Eucken, er hebt aber auch die Unterschiede zu anderen Liberalen der Nachkriegszeit wie Friedrich von Hayek, Wilhelm Röpke oder Alfred Müller-Armack hervor. Das Leitsätzegesetz von 1948, das eine Freigabe vieler bis dahin regulierter Preise deklarierte, sieht er nicht als Ausdruck «von unerschütterlichem liberalem Urvertrauen», sondern als Versuch eines reibungslosen Übergangs von der behördlichen Produktionslenkung zur Steuerung mittels Preisen. Nicht nur hier gewinnt man den Eindruck, Wünsche wolle Erhard unbedingt als Mann der Mitte positionieren. Gegen Schluss schreibt er reichlich anmassend, Erhards Ordnungsvorstellungen seien in Deutschland nie recht verstanden worden. Vielleicht liegt das ja auch daran, dass es sich bei der «Sozialen Marktwirtschaft» entgegen den Behauptungen Wünsches eben nicht um eine stringente wissenschaftliche Konzeption handelt, sondern eher um ein erfolgreiches wirtschaftspolitisches Programm – was ja nicht ehrenrührig ist.
PS:
Eine konkrete Auswirkung der Missachtung der Erhard’schen Grundsätze wird im nachstehenden NZZ-Artikel dargelegt:
Artikel auf Seite 10 der NZZ vom Sa, 06.04.2019
Meinung & Debatte · Seite 10, Artikel 2/2
Wenn Hochqualifizierte gehen und wenig Gebildete kommen
Deutschlands doppeltes Migrationsproblem, Gastkommentar von Heribert Dieter
In Deutschland und anderen europäischen Ländern wird das Thema Migration weiterhin intensiv diskutiert. Der französische Präsident hat Migration und deren Regulierung zu einem zentralen Thema seines Europawahlkampfes gemacht. Dabei stehen die Einwanderung, deren Folgen und Regulierung im Mittelpunkt. Allenfalls wird die Auswanderung aus süd- und osteuropäischen Ländern diskutiert. Übersehen wird dabei ein anderes Problem: dass etwa aus dem wirtschaftlich prosperierenden Deutschland viele Hochqualifizierte auswandern. Deutschland ist, wie einst im 19. Jahrhundert, wieder ein Auswanderungsland, ohne dass dieses Phänomen in der deutschen Öffentlichkeit diskutiert werden würde.
Es sind aber keine deutschen Erntehelfer, sondern Hochqualifizierte, die heute fortgehen, um im Ausland zu arbeiten. Deutsche Ärzte in der Schweiz und Norwegen, aber auch deutsche Ingenieure in Australien gehören zu diesen leisen Auswanderern. Daten über sie sind etwas versteckt, auch weil die Entscheidung für eine (oft temporär geplante) Auswanderung heute weniger schwerwiegend ist als im 19. Jahrhundert. Wohnungen werden auf Zeit untervermietet, und der Kontakt zur alten Heimat bleibt aufrechterhalten. Ökonomisch ist dieser Export von Humankapital ein bemerkenswertes Phänomen. Da es sich nicht um Geringqualifizierte handelt, hat schon eine kleine Zahl von Emigranten nennenswerte Effekte.
Überweisungen als Indikator
Messen kann man die Überweisungen in die Heimat im Ausland arbeitender Staatsbürger. Die Weltbank bezeichnet Menschen, die länger als zwölf Monate im Ausland tätig sind, als Auswanderer und berechnet deren Geldtransfers. 2017 lag Deutschland gemäss Weltbank auf Platz 9, hinter klassischen Auswanderungsländern wie Indien, China oder den Philippinen. Immerhin 16,6 Milliarden Dollar wurden von im Ausland tätigen Deutschen in die Heimat überwiesen. Amerikaner, trotz vierfacher Bevölkerungszahl, überwiesen 2017 lediglich 6 Milliarden Dollar nach Hause.
Wenig überraschend ist, dass die USA die Liste der Länder anführen, aus denen Geld in die Heimat überwiesen wird: 2017 sandten in den USA tätige Bürger anderer Staaten 66,6 Milliarden Dollar nach Hause, vor Saudi-Arabien mit 37,8 Milliarden Dollar. Auf Platz 3 der Liste steht die Schweiz mit 26,3 Milliarden Dollar, vor Deutschland mit 20,6 Milliarden Dollar.
Deutschland unterscheidet sich damit deutlich von klassischen Einwanderungsländern wie Australien, Kanada oder den USA. Diese weisen kein nennenswertes Volumen von Überweisungen in die Heimat eigener Staatsbürger auf. Dies liegt daran, dass die eigenen Staatsbürger offenbar eine geringe Neigung verspüren, temporär oder dauerhaft das Land zu verlassen und im Ausland eine besser vergütete Beschäftigung zu suchen. Angestammte Einwanderungsländer sind in der Lage, wirtschaftliche Anreizstrukturen für hochqualifizierte Zuwanderer und Einheimische zu schaffen. Deutschland hingegen verbindet die Auswanderung Hochqualifizierter mit der Einwanderung Geringqualifizierter. Die auf Kosten der deutschen Steuerzahler ausgebildeten Mediziner und Ingenieure maximieren ihren persönlichen Nutzen, was nachvollziehbar und legitim ist. Vergleicht man etwa die Arbeits- und Einkommensverhältnisse von Ärzten im deutschen Gesundheitswesen mit denen in Australien oder der Schweiz, zeigt sich, dass die Einkommen in Deutschland deutlich geringer und die Arbeitsbedingungen häufig schlechter sind. Angestellte Ärzte in leitender Funktion verdienen in Deutschland ein Drittel dessen, was für vergleichbare Positionen in Australien oder den USA gezahlt wird. Dort reichen Jahresgehälter angestellter Ärzte bis zu 450 000 Euro. In Dänemark oder der Schweiz liegen die Gehälter immerhin beim Doppelten des deutschen Wertes.
International abgeschlagen
Gesundheitsminister Jens Spahn ist die Auswanderung von in Deutschland ausgebildeten Ärzten ein Dorn im Auge. Wie er dies verhindern kann, weiss er aber nicht. Schwer vorstellbar erscheint, Sanktionen über im Ausland tätige Ärzte zu verhängen. Seltsam ist, dass die naheliegende Lösung, höhere Gehälter, nicht in Erwägung gezogen wird. Es wird schwierig bleiben, Hochqualifizierte in Deutschland zu halten, solange es im Ausland sehr viel mehr zu verdienen gibt. Die Gehälter etwa von angestellten Ärzten sind in
Deutschland bescheiden, zumindest im internationalen Vergleich. Selbst gering medizinisch Qualifizierte kommen in anderen Ländern auf einen ähnlichen Lohn: Ein Assistenzarzt an einem deutschen Krankenhaus verdiente 2018 brutto rund 81 000 Euro und damit gerade einmal 4300 Euro mehr als ein Lastwagenfahrer, der in den USA für die Handelskette Walmart arbeitet. Nach Steuern und Sozialabgaben hat der Trucker ein höheres Nettoeinkommen als der deutsche Mediziner.
Für die Einwanderungsländer ist die Einwanderung Hochqualifizierter ein lohnendes Geschäft. Diese Arbeitskräfte erhöhen die Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung des Landes und tragen so zu einer Festigung des Lebensstandards der einheimischen Bevölkerung bei. Besonders die Schweiz darf sich zu den Nutzniessern des deutschen Ärzte-Exports rechnen. Jeder fünfte Arzt in der Schweiz wurde in Deutschland ausgebildet. Gegenwärtig arbeiten etwa 6500 Mediziner aus Deutschland in der Schweiz, vorwiegend in Spitälern. Die Ausbildung dieser Ärzte hat den deutschen Steuerzahler etwa 250 000 Euro pro Person gekostet. Insgesamt hat die Schweiz damit Humankapital im Wert von rund 1,9 Milliarden Franken importiert. Sie spart damit beachtliche Ausbildungskosten; Deutschland dagegen hat mit seinem «brain drain» das Nachsehen.
Die Lage in Deutschland ist auch noch aus einem anderen Grund ungemütlich: Die grosse Zahl von Zuwanderern mit geringer Qualifikation senkt zum einen die durchschnittliche Wirtschaftsleistung, zum anderen werden die Sozialsysteme belastet. Gerade bei den in Deutschland lebenden Flüchtlingen zeigt sich diese Problematik deutlich. Im August 2018 bezogen 6,6 Prozent der Gesamtbevölkerung, aber 63,7 Prozent der Flüchtlinge die Grundsicherung Hartz IV. Von den 1,7 Millionen Flüchtlingen, die in Deutschland registriert sind, gehen 361 000 einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach. Da viele Migranten nicht über eine auf dem deutschen Arbeitsmarkt nachgefragte Qualifikation verfügen, bleiben ihnen nur Hilfstätigkeiten: putzen, kellnern, schleppen. Diese schlechtbezahlten Jobs erlauben den Zuwanderern auch keine üppigen Überweisungen in die Heimat.
Übersehen wird bei der Analyse der ökonomischen Effekte von Migration gerne die Umverteilung innerhalb der Sozialsysteme. Viele Beobachter meinen, dass allein die Aufnahme einer Hilfstätigkeit schon dazu führt, dass ein Zuwanderer sich selbst finanziert. Dies ist nicht der Fall. Deutschland gehört nicht nur zu den Ländern mit der höchsten Belastung von Arbeitseinkommen durch Steuern, sondern auch durch Sozialabgaben. Die Krankenversicherungsprämien eines Gutverdienenden belaufen sich in der gesetzlichen Versicherung derzeit auf etwa 830 Euro pro Monat einschliesslich des hälftigen Anteils der Arbeitgeber. Der Bundesfinanzminister überweist den Krankenkassen aber lediglich rund 100 Euro pro Person und Monat. Die Besserverdienenden subventionieren die Bezieher von Sozialleistungen einschliesslich der Zuwanderer.
Doppelt misslich
Für Deutschland ist die gegenwärtige Migrationspolitik doppelt misslich. Das Land verliert auf Kosten des Steuerzahlers ausgebildete Hochqualifizierte – nicht anders als afrikanische Länder oder Indien. Zugleich wandern weiterhin Geringqualifizierte ein und belasten den Sozialstaat. Steuern und Abgaben bleiben im internationalen Vergleich hoch. Nicht zuletzt deshalb können deutsche Arbeitgeber Hochqualifizierten nicht mehr in gleichem Mass wie früher attraktive Angebote machen.
Mittel- und langfristig steuert Deutschland auf eine strukturelle Krise in der Wirtschafts- und Sozialpolitik zu. Leistungsträger verlassen das Land und schwächen die wirtschaftlichen Perspektiven. Den gleichen Effekt hat die Zuwanderung von Geringqualifizierten. Um diese problematische Entwicklung zu ändern, müsste die deutsche Politik dafür sorgen, dass die Steuer- und Abgabenlast sinkt und zugleich die Gehälter von Hochqualifizierten so stark steigen, dass sie im internationalen Vergleich wettbewerbsfähig werden. In der heutigen politischen Atmosphäre, die von einer übergrossen Koalition von Umverteilungsbefürwortern im Bundestag geprägt ist, ist diese Forderung nach mehr Ungleichheit und weniger Sozialleistungen indes utopisch. Es fehlt an Einsicht, welche Folgen es für Deutschland hat, dass es seine eigenen Talente nicht mehr im Land halten kann.
Heribert Dieter ist Gastprofessor für internationale politische Ökonomie an der Zeppelin-Universität Friedrichshafen. Zusätzlich ist er in der Forschungsgruppe Globale Fragen der Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin.