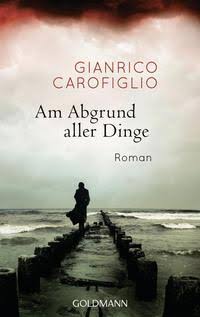
Dieser Roman kommt ohne den ‚avvocato‘, d.h. ohne Guerrieri, aus. Er erzählt die Geschichte eines zunächst namenlosen Mannes, der aus seinem langjährigen Wohnort Florenz in seine Geburtsstadt Bari, in der er seine Jugendzeit verbracht hat, zurückfährt. Auslöser ist eine zufällig gelesene Zeitungsnotiz, dass in der Nähe von Bari ein Mann namens Salvatore bei einem Bankraub erschossen wurde. Das weckt im Leser der Zeitungsnotiz intensive Jugenderinnerungen, denen er bei einem Besuch in Bari nachgehen will.
Mit der Zeit ‚enthüllt‘ sich dieser Mann als Enrico Vallesi; er hat nach seinem Studium Bari verlassen, sich in Florenz ein Leben eingerichtet, in dem Bari und seine Jugendfreunde oder Familienbeziehungen kaum noch vorkommen, hat sich seinen Jugendtraum, Schriftsteller zu werden, erfüllt, und mit seinem Erstling einen sehr erfolgreichen Bestseller publiziert. Dann lähmt ihn ein Schreibblock; er ist nur noch fähig, Auftragsbücher zu verfassen, die er unter fremden Namen publiziert. Er ist zwar auch damit erfolgreich, auch wirtschaftlich, leidet aber immer wieder unter seinem schlechten Gewissen darüber, dass er seine offenkundigen Talente verschleudert.
Salvatore war ein Jugendfreund, der ihm wesentlich geholfen hat, erwachsen zu werden und sich in einem rauen süditalienischen gesellschaftlichen Klima zu behaupten und seine eigenen Wege zu gehen.
Der Roman ist die sehr berührende und manchmal aufwühlende Geschichte des ‚sich selbst Findens‘, der Selbsterforschung und der Suche nach der eigenen Identität. Das gelingt Carofiglio sehr gut, unter anderem auch mit dem Stilmittel, den Helden des Romans – also Vallesi – weder in der Ich-Form erzählen zu lassen, noch in der dritten Person Einzahl; der Autor des Buchs spricht Vallsi, dessen Namen und Hintergrund wir lange nicht kennen lernen, mit ‚Du‘ an, z.B. «Du bist im Zug von Florent via Bologna nach Bari…». Das wirkt zunächst etwas gesucht; mit der Zeit wird aber offenkundig, dass damit stilistisch dargestellt werden soll, dass die so angesprochene Person sich selbst verloren hat. Gegen Ende des Romans, sozusagen mit dem zunehmenden Erfolg der Suche nach sich selbst, taucht dann immer wieder die ‚Ich-Form‘ auf. Vallesi kann mit sich selbst Frieden machen.
Ein sehr lesenswerter Roman, der wohl auch autobiografische Züge hat.