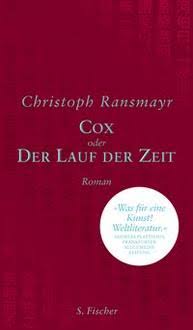
Die Hauptfiguren dieses Romans sind Alister Cox, bekanntester englischer Erbauer von Uhren und Automaten seiner Zeit, sowie Qíanlóng, chinesischer Kaiser, passionierter Uhrensammler und Zeitgenosse von Cox. Im Roman selbst finden sich keine Zeitangaben. Da aber sowohl Cox als auch Qíanlóng realen Personen nachempfunden sind, und der chinesische Kaiser von 1711bis 1799 lebte, kann angenommen werde, dass der Autor Christoph Ransmayr die Handlung des Romans im 18. Jahrhundert ansiedelt. Jedenfalls passen die geschilderten kulturellen und gesellschaftlichen Zeitumstände in jene Zeit.
Der reale Cox und der reale chinesische Kaiser sind sich nie begegnet. Cox war auch nie in China. Der originelle und konsequent durchgezogene Faden, den Ransmayr spinnt, lässt Qíanlóng den berühmten Cox nach China einladen. Dort erhält dieser die Aufgabe, zusammen mit drei mitgereisten Gehilfen, gemäss den Wünschen Qíanlóngs besonders einzigartige Uhren zu kreieren, die ganz spezielle Vorstellungen Qíanlóngs über das Zeitempfinden abbilden und nachempfinden lassen sollen. Beispiele dafür sind die Zeit eines kleinen Kindes, die zwischen völligem Stillstand und rasendem Ablauf hin- und her fluktuiert; oder das Zeitgefühl eines zum Tode Verurteilten, der den exakten Zeitpunkt seiner Hinrichtung kennt. Die Krönung besteht im Wunsch nach einer Uhr, die ohne menschliche Intervention ewig läuft und jedenfalls die Lebensspanne des Kaisers, die in seinem Beinamen Herr der zehntausend Jahre ausgedrückt wird, abdeckt. Dieser Wunsch konvergiert mit der fixen Idee von Cox und dessen seinerzeitigen Berufskollegen, das Perpetuum mobile zu erfinden. Aber die Gefahr, die in diesem Auftrag steckt, besteht darin, dass jemand, der ein Werk schafft, das länger als der Kaiser leben wird, sich verbrecherisch über den Kaiser erhebt und dafür den Tod verdient.
Cox und seine Gehilfen schaffen es, die Wünsche Qíanlóngs zu erfüllen, und zwar so, dass sie auch der Todesgefahr, die mit dem letzten Wunsch verbunden ist, entgehen.
Der Roman ist vollständig deskriptiv, d.h. es gibt keine direkte Rede, keine Dialoge, nur Beschreibungen. Die Sprache Ransmayrs ist sehr schön, elegant, blumig – manchmal bis an die Kitschgrenze –, und sehr schwer zu lesen. Die Schilderungen des Milieus am chinesischen Kaiserhof sind packend und plastisch. Ransmayr versteht es, auch die grössten Grausamkeiten so beiläufig, unaufgeregt und ohne Moralkeule zu beschreiben, dass man erst beim dritten Nachlesen realisiert, was da gerade passiert.
Eine eigentliche ‚Botschaft‘ oder ‚Moral von der Geschicht’ erkenne ich im Roman nicht. Insofern handelt es sich beim Roman um ‚brotlose Kunst‘ – oder einfach um die Gelegenheit, für einige Lektürestunden in eleganter schöner Sprache zu schwelgen. Gleichzeitig regt der Roman an, über eine Kultur zu staunen, die sich innert gut 200 Jahren von einer despotisch beherrschten, kristallin-toten, in finstersten abergläubischen Mythen befangenen und verstrickten Gesellschaft zur weltgrössten Wirtschaftsmacht zu entwickeln