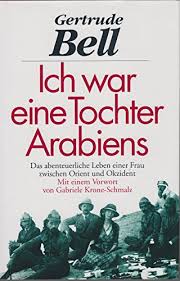
Diese Sammlung von Briefen Gertrude Bells – vorwiegend an ihren Vater und ihre Stiefmutter – ist eine hervorragende Ergänzung zur Bell-Biografie «Desert Queen» von Janet Wallach (1996).
Gertrude Bell, 1868 – 1926, führte ein ganz ausserordentliches Leben, dessen Qualifikation als ‚abenteuerlich’ eine krasse Untertreibung wäre. Sie war eine der ersten Frauen überhaupt, die in Oxford studieren durfte. Dass ihr dies möglich wurde, ist nicht nur ihrer Herkunft – sie war Tochter einer schwerreichen englischen Industriellen-Familie – zu verdanken, sondern mindestens ebenso sehr ihrer Hartnäckigkeit und Zielstrebigkeit. Wegen einer unglücklichen und gesellschaftlich ‚unmöglichen’ Liebe zu einem verheirateten Offizier ‚flüchtete’ sie auf zahlreiche Reisen, die sie unter anderem in den Vorderen Orient (Persien und den heutigen Nahen Osten) brachten. Dort blieb sie emotional und auch wegen ihres tiefen Interesses für die Geschichte des Orients hängen. Es ist auch aus heutiger Sicht unvorstellbar, dass und wie sie auf eigene Faust in die Wüsten Syriens, Mesopotamiens und des heutigen Arabiens reiste. Dort entdeckte, erforschte und kartographierte sie nicht nur Stätten des Ursprungs der menschlichen Zivilisation (u.a. Petra); sondern sie schloss auch dauerhafte, lebenslange Freundschaften mit den Chefs aller wichtigen Beduinenstämme. Sie selbst war sich bewusst, dass sie in ihrer Identität zwischen ihrer okzidentalen Herkunft und ihrer grossen Liebe zur orientalischen Geschichte, Kultur und zu den Menschen Arabiens hin und her schwankte und manchmal verloren zu gehen schien.
Ihre einzigartig intimen Kenntnisse des Nahen Ostens sowie ihr persönliches Beziehungsnetzwerk konnten – obwohl sie eine Frau war – weder von der englischen Regierung, welche nach dem Zusammenbruch des Ottomanischen Reichs und der Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg ein Mandat des Völkerbundes für Palästina und Mesopotamien übernommen hatte, noch von den arabischen Führungsschichten, die nach Unabhängigkeit strebten, übersehen und übergangen werden. Deshalb spielte sie zunächst als Beraterin beider Seiten, als ‚beamtete’ Orientsekretärin Englands und später sogar als Ministerin des jungen und im Aufbau begriffenen Staats Irak eine Schlüsselrolle in der konkreten strukturellen Ausgestaltung des arabischen Raums.
Ihre letzten knapp10 Lebensjahre lebte und wirkte sie in Bagdad; sie erwarb sogar die irakische Staatsbürgerschaft.
Sie war massgebend daran beteiligt, dass Feisal erster König des Iraks wurde. Aus ihren Briefen geht sehr klar hervor, dass sie bis zu ihrem Tod – und wie sich im Nachhinein zeigt, zu Recht – skeptisch blieb, ob die von den europäischen Mächten (vor allem Frankreich und England) geschaffene neue Ordnung des Nahen Ostens auf Dauer tragfähig sein konnte. Ihre intimen Kenntnisse
- der Feindschaft zwischen den arabischen Stämmen, der zivilisatorischen Herausforderungen, welche die nomadischen Stämme mit festen Grenzen und stammesübergreifenden Führungsstrukturen überwinden mussten,
- des unüberbrückbaren Hasses zwischen Sunniten und Schiiten,
- der im kurdischen Unabhängigkeitsstreben schlummernden Bruchstelle innerhalb des neuen Gebildes Irak,
- der generellen zivilisatorischen Kluft zwischen dem Entwicklungsstand des Orients und des Westens,
liessen sie bis an ihre Lebensende an der Sinnhaftigkeit ihres Wirkens zweifeln.
Mir scheint, dass Gertrude Bell es verdienen würde, in der Diskussion über die Zukunft des Nahen Ostens vermehrt Gehör zu bekommen. Aber es scheint, dass die Tatsache, dass sie als Frau in ‚ihrer’ Phase der Geschichte eine Fehlbesetzung war, auch heute noch nachwirkt.
Ein Zitat eines der bedeutendsten irakischen Scheichs ist wohl auch heute noch gültig: «Ich las ihnen (gemeint sind dessen untergebene Scheichs) deinen Brief vor und sagte zu ihnen: O Scheichs, dies ist eine Frau – wie müssen erst die Männer sein!» Gertrude Bells Reaktion darauf war «Dieser köstliche Redeschluss rückte mich im Handumdrehen wieder an meinen wahren Platz.»
Daraus spricht nicht nur eine realistische Einschätzung der Bedeutung des Zitats, sondern erst recht eine tiefe Enttäuschung.Man muss kein Feminist sein, um diese auch heute noch nachwirkende Verkennung Bells zu bedauern.